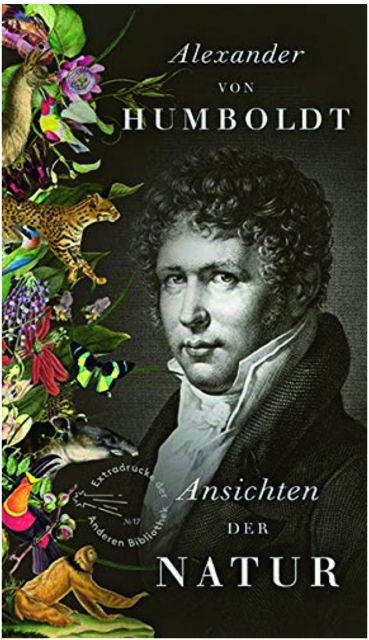Suchergebnisse für
"buen vivir"
Wir haben 5.287 Ergebnisse für Ihre Suchanfrage gefunden.
Lateinamerika: Steigende Sicherheitsausgaben schaffen nicht mehr Sicherheit
 Die Länder Lateinamerikas und der Karibik haben in den letzten zehn Jahren ihre Sicherheitsausgaben um gut ein Drittel erhöht. Die erhofften Auswirkungen auf die Kriminalitätsrate blieben jedoch weitestgehend aus. Im Gegenteil: In den meisten Ländern stieg diese sogar an. Und so sitzen in der Region heute 1,5 Millionen Menschen im Gefängnis, zwei Fünftel davon in Untersuchungshaft. Seit dem Jahr 2000 stieg die Zahl der Gefängnisinsassen um 120 Prozent, weltweit lag der Anstieg bei „nur“ 24 Prozent. Doch Kriminalität und die damit verbundene Unsicherheit sind teuer. In Lateinamerika und der Karibik verschlingt sie jährlich 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das entspricht der Hälfte der Ausgaben für Gesundheit und Bildung. Kürzlich haben deshalb Sicherheitsexperten der Region beraten, wie sie ihren Bürgern mehr Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit garantieren können. Die Vorschläge sind zumindest interessant – mehr Digitalisierung von Polizei und Justiz, Entwicklung der Humanressourcen, Kriminalprävention. Ein genauerer Blick ist allerdings ernüchternd. Digitalisierung meint im Wesentlichen eine bessere Erfassung von Kriminalität und wohl auch die bessere Vernetzung der zuständigen Behörden. Entwicklung der Humanressourcen heißt bessere Ausbildung der Beamten. Und die Kriminalprävention scheint sich vor allen Dingen auf die dringend erforderliche Verbesserung der Bedingungen in den Haftanstalten zu richten, um die Rückfallquote zu verringern. Das alles sind ohne Zweifel wichtige, aber ebenso zweifellos nicht ausreichende Maßnahmen bei der Kriminalprävention. Die Kriminalitätsrate, das belegen zahlreiche Studien, hat nicht zuletzt etwas mit gesellschaftlicher Ungleichheit zu tun. Und Lateinamerika ist die Region der Welt mit der größten Einkommensungleichheit. (Bildquelle: Quetzal-Redaktion_gt)
Die Länder Lateinamerikas und der Karibik haben in den letzten zehn Jahren ihre Sicherheitsausgaben um gut ein Drittel erhöht. Die erhofften Auswirkungen auf die Kriminalitätsrate blieben jedoch weitestgehend aus. Im Gegenteil: In den meisten Ländern stieg diese sogar an. Und so sitzen in der Region heute 1,5 Millionen Menschen im Gefängnis, zwei Fünftel davon in Untersuchungshaft. Seit dem Jahr 2000 stieg die Zahl der Gefängnisinsassen um 120 Prozent, weltweit lag der Anstieg bei „nur“ 24 Prozent. Doch Kriminalität und die damit verbundene Unsicherheit sind teuer. In Lateinamerika und der Karibik verschlingt sie jährlich 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das entspricht der Hälfte der Ausgaben für Gesundheit und Bildung. Kürzlich haben deshalb Sicherheitsexperten der Region beraten, wie sie ihren Bürgern mehr Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit garantieren können. Die Vorschläge sind zumindest interessant – mehr Digitalisierung von Polizei und Justiz, Entwicklung der Humanressourcen, Kriminalprävention. Ein genauerer Blick ist allerdings ernüchternd. Digitalisierung meint im Wesentlichen eine bessere Erfassung von Kriminalität und wohl auch die bessere Vernetzung der zuständigen Behörden. Entwicklung der Humanressourcen heißt bessere Ausbildung der Beamten. Und die Kriminalprävention scheint sich vor allen Dingen auf die dringend erforderliche Verbesserung der Bedingungen in den Haftanstalten zu richten, um die Rückfallquote zu verringern. Das alles sind ohne Zweifel wichtige, aber ebenso zweifellos nicht ausreichende Maßnahmen bei der Kriminalprävention. Die Kriminalitätsrate, das belegen zahlreiche Studien, hat nicht zuletzt etwas mit gesellschaftlicher Ungleichheit zu tun. Und Lateinamerika ist die Region der Welt mit der größten Einkommensungleichheit. (Bildquelle: Quetzal-Redaktion_gt)
Lateinamerikanisten im Porträt (3)

Als ich im Oktober letzten Jahres für mein Studium an die Humboldt-Universität nach Berlin kam, war mir ihr heutiger Namensgeber noch völlig unbekannt. Mit der ältesten der Berliner Universitäten assoziierte ich eher Hegel und Marx. Nach Hegel wurde der Platz vor dem Literaturwissenschaftlichen Institut benannt, wo ...
Ecuador/UNASUR: Lenín lässt Néstor einpacken
 Die im Mai 2008 gegründete Internationale Organisation UNASUR, der einmal 12 südamerikanische Staaten angehörten, ist 2018, im Kontext der Konflikte um Venezuela, faktisch zerbrochen. Seit Anfang 2017 hat das Bündnis schon keinen Generalsekretär mehr. Nur Venezuela, Uruguay, Bolivien, Guayana und Suriname sind noch Mitglieder. UNASUR, die ihren Sitz in der Mitad del Mundo unmittelbar am Äquator im Nordwesten von Quito, der Hauptstadt von Ecuador, hat, ist ökonomisch zu schwach ist, diesen zu erhalten. Durch den Austritt von sieben Staaten hat sie 86,54 % ihres Finanzvolumens verloren. Daher hat sie das entsprechende, von Diego Guayasamin entworfene futuristische Gebäude dem Staat Ecuador zurückgegeben. Am 17. September 2019 beschloss nun das Parlament von Ecuador, dem Wunsch des Präsidenten Lenín Moreno nachzukommen und die Mitgliedschaft des Landes in UNASUR aufzukündigen. Laut Artikel 24 des Tratado Constitutivo de UNASUR kann aber der ecuadorianische Präsident das Dekret über den Austritt seines Landes erst in einem halben Jahr verhängen. Dieser ist kein Freund der Idee des „Sozialismus‘ des 21. Jahrhunderts“ und beklagt, dass UNASUR zu sehr von dieser vereinnahmt gewesen sei. Das Gebäude sei ohnehin eine „Ode an die Verschwendung“. Schon werden die Möbel, Bilder, Archive und Bücher der García Márquez-Bibliothek, die das UNASUR-Gebäude zierten, eingepackt, um sie an die Donatoren zurückzugeben. Dabei erfüllt das Gebäude zurzeit sogar noch seine Funktion als UNASUR-Sitz. Es soll laut Präsident Moreno eine indígena-Universität werden, doch die Präfektur Pichincha reklamiert den Grund und Boden für sich. Das neben dem Gebäude aufgestellte 2,28 Meter hohe und 600 Kilogramm schwere Denkmal Nestor Kirchners mit erhobenem Arm und im Winde wehender Krawatte, ein Geschenk Argentiniens an UNASUR, als der argentinischen Regierung noch Kirchners Frau Cristina vorstand, ist bereits in einen schwarzen Plastiksack verpackt worden und soll an Argentinien zurückgegeben werden. Vielleicht kehren ja auch Argentinien und Nestor Kirchner – als Denkmal – wieder zu UNASUR zurück, wenn, wie zu vermuten, Cristina Kirchner die nächsten Wahlen gewinnt, wo auch immer dann der Sitz von UNASUR sein mag und falls er dann überhaupt noch nötig sein wird… (Bildquelle: CC_jg-ketterer).
Die im Mai 2008 gegründete Internationale Organisation UNASUR, der einmal 12 südamerikanische Staaten angehörten, ist 2018, im Kontext der Konflikte um Venezuela, faktisch zerbrochen. Seit Anfang 2017 hat das Bündnis schon keinen Generalsekretär mehr. Nur Venezuela, Uruguay, Bolivien, Guayana und Suriname sind noch Mitglieder. UNASUR, die ihren Sitz in der Mitad del Mundo unmittelbar am Äquator im Nordwesten von Quito, der Hauptstadt von Ecuador, hat, ist ökonomisch zu schwach ist, diesen zu erhalten. Durch den Austritt von sieben Staaten hat sie 86,54 % ihres Finanzvolumens verloren. Daher hat sie das entsprechende, von Diego Guayasamin entworfene futuristische Gebäude dem Staat Ecuador zurückgegeben. Am 17. September 2019 beschloss nun das Parlament von Ecuador, dem Wunsch des Präsidenten Lenín Moreno nachzukommen und die Mitgliedschaft des Landes in UNASUR aufzukündigen. Laut Artikel 24 des Tratado Constitutivo de UNASUR kann aber der ecuadorianische Präsident das Dekret über den Austritt seines Landes erst in einem halben Jahr verhängen. Dieser ist kein Freund der Idee des „Sozialismus‘ des 21. Jahrhunderts“ und beklagt, dass UNASUR zu sehr von dieser vereinnahmt gewesen sei. Das Gebäude sei ohnehin eine „Ode an die Verschwendung“. Schon werden die Möbel, Bilder, Archive und Bücher der García Márquez-Bibliothek, die das UNASUR-Gebäude zierten, eingepackt, um sie an die Donatoren zurückzugeben. Dabei erfüllt das Gebäude zurzeit sogar noch seine Funktion als UNASUR-Sitz. Es soll laut Präsident Moreno eine indígena-Universität werden, doch die Präfektur Pichincha reklamiert den Grund und Boden für sich. Das neben dem Gebäude aufgestellte 2,28 Meter hohe und 600 Kilogramm schwere Denkmal Nestor Kirchners mit erhobenem Arm und im Winde wehender Krawatte, ein Geschenk Argentiniens an UNASUR, als der argentinischen Regierung noch Kirchners Frau Cristina vorstand, ist bereits in einen schwarzen Plastiksack verpackt worden und soll an Argentinien zurückgegeben werden. Vielleicht kehren ja auch Argentinien und Nestor Kirchner – als Denkmal – wieder zu UNASUR zurück, wenn, wie zu vermuten, Cristina Kirchner die nächsten Wahlen gewinnt, wo auch immer dann der Sitz von UNASUR sein mag und falls er dann überhaupt noch nötig sein wird… (Bildquelle: CC_jg-ketterer).
Lunas

El corazón se le estrujó tanto que parecía totalmente seco. Escuchaba los gritos desde su cama, algunos esbozaban un pedido de auxilio, otros simplemente parecían aullidos. Tuvo la impresión de que aquel ser se transfiguraba, que con cada alarido se convertía en un animal distinto y agresivo, hambriento y desesperado. No pudo más y se levantó con los ojos ...
Argentinien: Erinnerung an León Rozitchner (1924-2011)
 Der argentinische Philosoph León Rozitchner wäre gerstern 95 Jahre alt geworden. Am 24. September 1924 in Chivilcoy, einer kleiner Stadt in der argentinischer Pampa, geboren, zog er einige Jahre später zusammen mit seinen jüdischen Eltern nach Buenos Aires. Nach dem Schulabschluss ging er nach Paris, um in der Sorbonne zu studieren. 1952 schloss er Studium in Literatur ab und promovierte 1960 in Philosophie unter der Betreuung Jean Wahls. Rozitchner beteiligte sich in den 1950er Jahren an der Redaktion der legendären, von den Geschwistern Ismael und David Viñas geleiteten argentinischen Kultur-Zeitschrift Contorno. Nach dem Sieg der kubanischen Revolution fuhr er nach Kuba, um von 1961 bis 1962 an der Universidad de La Habana zu unterrichten. Der Putsch 1976 in Argentinien zwang ihn ins Exil nach Venezuela, wo er bis 1985 an der Universidad Central de Venezuela unterrichtete und das Institut für Praxisphilosophie leitete. Aufgrund seines scharfen, kritischen Geistes in Bezug auf intellektuelle Trends, die argentinische Hochschulpolitik, den Katholizismus, den Peronismus und die Politik des Staates Israel wurde sein Werk eher ignoriert – kennzeichnend dafür ist, dass sein Name in der fast 1.500 Seiten umfassenden Historia de la Filosofía en Argentina 1600-2000 nicht erscheint. Kurz nach seinem Tod im Jahr 2011 unternahm die Nationalbibliothek Argentiniens die Veröffentlichung seines Gesamtwerkes, welches neben der Neuauflage der bereits publizierten 13 Bücher auch mehrere bislang unveröffentlichte Schriften umfasst. Das unvollständige Projekt wurde nach dem Regierungswechsel 2015 abgebrochen und die bisher veröffentlichten 18 Bände eingestellt. Auch wenn Rozitchner aus der Universität Buenos Aires ausgeschlossen blieb, war er doch ein ständiger und gern gesehener Gast in alternativen Lehrbereichen und politischen Diskussionsforen. León Rozitchner war ein leidenschaftlicher Redner und Zuhörer, ein großherziger Mensch, jedoch ungehorsam gegenüber allen Formen der Macht und des Kolonialismus (Bild: BuchCover).
Der argentinische Philosoph León Rozitchner wäre gerstern 95 Jahre alt geworden. Am 24. September 1924 in Chivilcoy, einer kleiner Stadt in der argentinischer Pampa, geboren, zog er einige Jahre später zusammen mit seinen jüdischen Eltern nach Buenos Aires. Nach dem Schulabschluss ging er nach Paris, um in der Sorbonne zu studieren. 1952 schloss er Studium in Literatur ab und promovierte 1960 in Philosophie unter der Betreuung Jean Wahls. Rozitchner beteiligte sich in den 1950er Jahren an der Redaktion der legendären, von den Geschwistern Ismael und David Viñas geleiteten argentinischen Kultur-Zeitschrift Contorno. Nach dem Sieg der kubanischen Revolution fuhr er nach Kuba, um von 1961 bis 1962 an der Universidad de La Habana zu unterrichten. Der Putsch 1976 in Argentinien zwang ihn ins Exil nach Venezuela, wo er bis 1985 an der Universidad Central de Venezuela unterrichtete und das Institut für Praxisphilosophie leitete. Aufgrund seines scharfen, kritischen Geistes in Bezug auf intellektuelle Trends, die argentinische Hochschulpolitik, den Katholizismus, den Peronismus und die Politik des Staates Israel wurde sein Werk eher ignoriert – kennzeichnend dafür ist, dass sein Name in der fast 1.500 Seiten umfassenden Historia de la Filosofía en Argentina 1600-2000 nicht erscheint. Kurz nach seinem Tod im Jahr 2011 unternahm die Nationalbibliothek Argentiniens die Veröffentlichung seines Gesamtwerkes, welches neben der Neuauflage der bereits publizierten 13 Bücher auch mehrere bislang unveröffentlichte Schriften umfasst. Das unvollständige Projekt wurde nach dem Regierungswechsel 2015 abgebrochen und die bisher veröffentlichten 18 Bände eingestellt. Auch wenn Rozitchner aus der Universität Buenos Aires ausgeschlossen blieb, war er doch ein ständiger und gern gesehener Gast in alternativen Lehrbereichen und politischen Diskussionsforen. León Rozitchner war ein leidenschaftlicher Redner und Zuhörer, ein großherziger Mensch, jedoch ungehorsam gegenüber allen Formen der Macht und des Kolonialismus (Bild: BuchCover).
Der russische Bär in der lateinamerikanischen Selva – oder warum außenpolitische Dyaden Weltpolitik gestalten können

Als ich, befragt nach meinen Wochenendplänen, einem Freund erzählte, ich würde einen Artikel über die russländisch-lateinamerikanischen Beziehungen schreiben, lachte der auf und meinte sarkastisch: “Das wird ja ein Kracher!” Das traf mich, und ich suchte nach einer Alternative: „Und wie würdest du eine Geschichte über den russischen Bären ...
Brasilien: Morde an Umweltschützern bleiben meist straflos
 Der Rauch über dem deutschen Blätterwald, der die Brände am Amazonas beklagte, hat sich wieder etwas verzogen. Es gab sehr laute Überlegungen darüber, dass „unsere Lunge“ vernichtet wird und sehr leise darüber, ob „wir“ nicht auch Schuld tragen an diesem Inferno. Die Bundesrepublik sieht sich indes nach wie vor nicht veranlasst, das Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur infrage zu stellen, da dieses zwar keine Handhabe gegen Brandrodungen biete, aber doch ein Kapitel über Nachhaltigkeit enthalte. Derweil gehen die Brandrodungen in Brasilien weiter, und die Morde ebenso. In der vergangenen Woche wurde im Amazonasgebiet ein Inspektor der Nationalen Stiftung für Indigene Funai durch zwei Schüsse getötet. Allein seit 2015 zählten NGOs 28 Morde und vier Attentate, von den zahlreichen Drohungen gegen Umweltaktivisten ganz zu schweigen. Nur zwei dieser Morde kamen vor Gericht. Die Polizei tut sich schwer mit den Ermittlungen und zeigt häufig keine Interesse an einer Suche nach den Tätern. Das politische Klima im Land ermutigt die Verantwortlichen für das illegale Abholzen offensichtlich noch, mit Gewalt gegen Umweltschützer vorzugehen. Schließlich propagiert Brasiliens Präsident Bolsonaro die forcierte wirtschaftliche Nutzung des Regenwaldes. Und um Störungen zu vermeiden, wird Umweltorganisationen die finanzielle Unterstützung gestrichen und die Arbeit der staatlichen Umweltbehörde Ibama massiv blockiert. Brasilien hat übrigens das Pariser Übereinkommen zum Klimaschutz unterzeichnet; und, so ließ das deutsche Landwirtschaftsministerium verlauten, das Land wird selbstverständlich auch nach Annahme eines Freihandelsabkommens an dessen Bestimmungen gebunden sein. Jair Bolsonaro zeigt heute schon, wie das geht (Bild: Agencia Brasil).
Der Rauch über dem deutschen Blätterwald, der die Brände am Amazonas beklagte, hat sich wieder etwas verzogen. Es gab sehr laute Überlegungen darüber, dass „unsere Lunge“ vernichtet wird und sehr leise darüber, ob „wir“ nicht auch Schuld tragen an diesem Inferno. Die Bundesrepublik sieht sich indes nach wie vor nicht veranlasst, das Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur infrage zu stellen, da dieses zwar keine Handhabe gegen Brandrodungen biete, aber doch ein Kapitel über Nachhaltigkeit enthalte. Derweil gehen die Brandrodungen in Brasilien weiter, und die Morde ebenso. In der vergangenen Woche wurde im Amazonasgebiet ein Inspektor der Nationalen Stiftung für Indigene Funai durch zwei Schüsse getötet. Allein seit 2015 zählten NGOs 28 Morde und vier Attentate, von den zahlreichen Drohungen gegen Umweltaktivisten ganz zu schweigen. Nur zwei dieser Morde kamen vor Gericht. Die Polizei tut sich schwer mit den Ermittlungen und zeigt häufig keine Interesse an einer Suche nach den Tätern. Das politische Klima im Land ermutigt die Verantwortlichen für das illegale Abholzen offensichtlich noch, mit Gewalt gegen Umweltschützer vorzugehen. Schließlich propagiert Brasiliens Präsident Bolsonaro die forcierte wirtschaftliche Nutzung des Regenwaldes. Und um Störungen zu vermeiden, wird Umweltorganisationen die finanzielle Unterstützung gestrichen und die Arbeit der staatlichen Umweltbehörde Ibama massiv blockiert. Brasilien hat übrigens das Pariser Übereinkommen zum Klimaschutz unterzeichnet; und, so ließ das deutsche Landwirtschaftsministerium verlauten, das Land wird selbstverständlich auch nach Annahme eines Freihandelsabkommens an dessen Bestimmungen gebunden sein. Jair Bolsonaro zeigt heute schon, wie das geht (Bild: Agencia Brasil).
Nicaraguas Schicksalsfrage oder: Die vertrackte Geschichte eines (noch) nicht gebauten Kanals

... Seit 1914 gibt es bereits einen Kanal, der den Atlantischen und den Stillen Ozean miteinander verbindet. Dieser verläuft quer durch Panama, einen Staat, den es ohne diese Wasserstraße aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht geben würde. Weshalb ist dann für Nicaragua ein Kanal, den es dort gar nicht gibt, zu einer Schicksalsfrage geworden? Die Antwort darauf reicht weit in die ...
Chile: Der Jahrestag des Militärputsches ist für die Regierung ein ganz normaler Tag
 Vor 46 Jahren putschte das Militär in Chile und stürzte die rechtmäßig gewählte Regierung unter Dr. Salvador Allende. Für die chilenische Regierung ist der heutige Tag fast ein Tag wie jeder andere. Ein offizieller Akt der Erinnerung fand nicht statt. Präsident Sebastián Piñera erinnerte lediglich in einer kurzen Rede an den Putsch, in welcher er zwar Allende die Schuld an dem Staatsstreich gab („die Unidad Popular führte Chile in eine nie dagewesene Krise“), aber immerhin betonte er, dass der 11. September 1973 die chilenische Demokratie beendete. Für Andrés Chadwick, Minister für Inneres und Öffentliche Sicherheit (und auch Cousin des Präsidenten), ist heute im Regierungspalast La Moneda ein ganz normaler Arbeitstag. Im El Mercurio erschien unter dem Titel „Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela“ eine ganzseitige Anzeige zur Verteidigung des Militärputsches, die nicht nur in den sozialen Medien sehr kontrovers diskutiert wird. Die Chile-Korrespondentin der spanischen El País erinnert indes daran, was diese „Rettungsaktion“ konkret bedeutete. Sie verweist auf das Buch „Así se torturó en Chile (1973-1990)“ des chilenischen Journalisten Daniel Hopenhayn, welches bereits vor einigen Monaten erschien. Hopenhayn hatte den vor 15 Jahren erschienenen Valech-Bericht noch einmal aufgearbeitet und inhaltlich auf knapp ein Drittel seines Umfangs zusammengefasst, um diesen so einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die sogenannte Valech-Kommission hatte 2004 ihren „Bericht über Politische Gefangenschaft und Folter“ vorgelegt, in dem nach dreijähriger intensiver Arbeit die Folterpraxis während der Pinochetdiktatur aufgearbeitet und dargestellt wurde. Der Inhalt des Berichts ist über weite Strecken schwer zu ertragen, weil, so drückte es Hopenhayn aus, die beschriebenen Misshandlungen unsere Vorstellung von der menschlichen Natur erschüttern. Vor allen Dingen machte der Bericht der Valech-Kommission deutlich, dass die Folterpraxis keine Exzesse Einzelner waren, sondern eine systematisch betriebene staatliche Politik (Bild: Quetzal-Redaktion, solebiasatti).
Vor 46 Jahren putschte das Militär in Chile und stürzte die rechtmäßig gewählte Regierung unter Dr. Salvador Allende. Für die chilenische Regierung ist der heutige Tag fast ein Tag wie jeder andere. Ein offizieller Akt der Erinnerung fand nicht statt. Präsident Sebastián Piñera erinnerte lediglich in einer kurzen Rede an den Putsch, in welcher er zwar Allende die Schuld an dem Staatsstreich gab („die Unidad Popular führte Chile in eine nie dagewesene Krise“), aber immerhin betonte er, dass der 11. September 1973 die chilenische Demokratie beendete. Für Andrés Chadwick, Minister für Inneres und Öffentliche Sicherheit (und auch Cousin des Präsidenten), ist heute im Regierungspalast La Moneda ein ganz normaler Arbeitstag. Im El Mercurio erschien unter dem Titel „Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela“ eine ganzseitige Anzeige zur Verteidigung des Militärputsches, die nicht nur in den sozialen Medien sehr kontrovers diskutiert wird. Die Chile-Korrespondentin der spanischen El País erinnert indes daran, was diese „Rettungsaktion“ konkret bedeutete. Sie verweist auf das Buch „Así se torturó en Chile (1973-1990)“ des chilenischen Journalisten Daniel Hopenhayn, welches bereits vor einigen Monaten erschien. Hopenhayn hatte den vor 15 Jahren erschienenen Valech-Bericht noch einmal aufgearbeitet und inhaltlich auf knapp ein Drittel seines Umfangs zusammengefasst, um diesen so einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die sogenannte Valech-Kommission hatte 2004 ihren „Bericht über Politische Gefangenschaft und Folter“ vorgelegt, in dem nach dreijähriger intensiver Arbeit die Folterpraxis während der Pinochetdiktatur aufgearbeitet und dargestellt wurde. Der Inhalt des Berichts ist über weite Strecken schwer zu ertragen, weil, so drückte es Hopenhayn aus, die beschriebenen Misshandlungen unsere Vorstellung von der menschlichen Natur erschüttern. Vor allen Dingen machte der Bericht der Valech-Kommission deutlich, dass die Folterpraxis keine Exzesse Einzelner waren, sondern eine systematisch betriebene staatliche Politik (Bild: Quetzal-Redaktion, solebiasatti).
Allende, Isabel: Dieser weite Weg

... Mit diesen Worten beginnt Isabel Allende ihre Danksagung für ihr Buch „Dieser weite Weg“. Ich hatte die Danksagung vor dem Roman gelesen, weshalb ich davon ausging, dass dieser die Geschichte jener beispiellosen Rettungsaktion aus dem Sommer des Jahres 1939 erzählt. Damals konnten, angeregt vom chilenischen Präsidenten Pedro Aguirre Cerda und organisiert von dem Dichter Pablo Neruda ...
 Die Länder Lateinamerikas und der Karibik haben in den letzten zehn Jahren ihre Sicherheitsausgaben um gut ein Drittel erhöht. Die erhofften Auswirkungen auf die Kriminalitätsrate blieben jedoch weitestgehend aus. Im Gegenteil: In den meisten Ländern stieg diese sogar an. Und so sitzen in der Region heute 1,5 Millionen Menschen im Gefängnis, zwei Fünftel davon in Untersuchungshaft. Seit dem Jahr 2000 stieg die Zahl der Gefängnisinsassen um 120 Prozent, weltweit lag der Anstieg bei „nur“ 24 Prozent. Doch Kriminalität und die damit verbundene Unsicherheit sind teuer. In Lateinamerika und der Karibik verschlingt sie jährlich 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das entspricht der Hälfte der Ausgaben für Gesundheit und Bildung. Kürzlich haben deshalb Sicherheitsexperten der Region beraten, wie sie ihren Bürgern mehr Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit garantieren können. Die Vorschläge sind zumindest interessant – mehr Digitalisierung von Polizei und Justiz, Entwicklung der Humanressourcen, Kriminalprävention. Ein genauerer Blick ist allerdings ernüchternd. Digitalisierung meint im Wesentlichen eine bessere Erfassung von Kriminalität und wohl auch die bessere Vernetzung der zuständigen Behörden. Entwicklung der Humanressourcen heißt bessere Ausbildung der Beamten. Und die Kriminalprävention scheint sich vor allen Dingen auf die dringend erforderliche Verbesserung der Bedingungen in den Haftanstalten zu richten, um die Rückfallquote zu verringern. Das alles sind ohne Zweifel wichtige, aber ebenso zweifellos nicht ausreichende Maßnahmen bei der Kriminalprävention. Die Kriminalitätsrate, das belegen zahlreiche Studien, hat nicht zuletzt etwas mit gesellschaftlicher Ungleichheit zu tun. Und Lateinamerika ist die Region der Welt mit der größten Einkommensungleichheit. (Bildquelle: Quetzal-Redaktion_gt)
Die Länder Lateinamerikas und der Karibik haben in den letzten zehn Jahren ihre Sicherheitsausgaben um gut ein Drittel erhöht. Die erhofften Auswirkungen auf die Kriminalitätsrate blieben jedoch weitestgehend aus. Im Gegenteil: In den meisten Ländern stieg diese sogar an. Und so sitzen in der Region heute 1,5 Millionen Menschen im Gefängnis, zwei Fünftel davon in Untersuchungshaft. Seit dem Jahr 2000 stieg die Zahl der Gefängnisinsassen um 120 Prozent, weltweit lag der Anstieg bei „nur“ 24 Prozent. Doch Kriminalität und die damit verbundene Unsicherheit sind teuer. In Lateinamerika und der Karibik verschlingt sie jährlich 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das entspricht der Hälfte der Ausgaben für Gesundheit und Bildung. Kürzlich haben deshalb Sicherheitsexperten der Region beraten, wie sie ihren Bürgern mehr Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit garantieren können. Die Vorschläge sind zumindest interessant – mehr Digitalisierung von Polizei und Justiz, Entwicklung der Humanressourcen, Kriminalprävention. Ein genauerer Blick ist allerdings ernüchternd. Digitalisierung meint im Wesentlichen eine bessere Erfassung von Kriminalität und wohl auch die bessere Vernetzung der zuständigen Behörden. Entwicklung der Humanressourcen heißt bessere Ausbildung der Beamten. Und die Kriminalprävention scheint sich vor allen Dingen auf die dringend erforderliche Verbesserung der Bedingungen in den Haftanstalten zu richten, um die Rückfallquote zu verringern. Das alles sind ohne Zweifel wichtige, aber ebenso zweifellos nicht ausreichende Maßnahmen bei der Kriminalprävention. Die Kriminalitätsrate, das belegen zahlreiche Studien, hat nicht zuletzt etwas mit gesellschaftlicher Ungleichheit zu tun. Und Lateinamerika ist die Region der Welt mit der größten Einkommensungleichheit. (Bildquelle: Quetzal-Redaktion_gt)