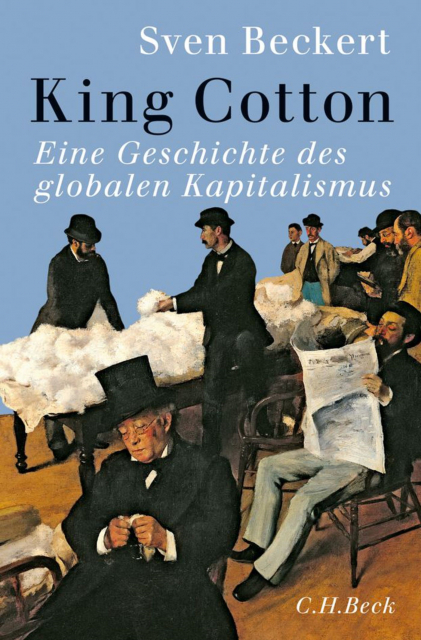Ernesto Che Guevara war nicht nur Arzt, Revolutionär und Guerillaführer. Er war auch für eine kurze Zeit kubanischer Industrieminister. Vom 23. Februar 1961 bis April 1965 lenkte er die wirtschaftlichen Geschicke des Karibikstaates. Was waren die Leitlinien seiner Wirtschaftspolitik? Wie sah sein sozialistisches Wirtschaftsmodell aus? Was waren seine Ideale? Und warum gab er das Amt des Industrieministers so schnell wieder auf? Die folgenden Ausführungen sollen etwas Licht in dieses Lebenskapitel von Che Guevara bringen, das mit der Expedition in den Kongo ein Ende fand.
——————————————-
Vorrede
Che Guevaras wirtschaftspolitisches Denken und Handeln stellte zu keinem Zeitpunkt eine geschlossene Theorie oder ein abgeschlossenes Denkgefüge dar. Viele ökonomische Fragen – auch zu zentralen Punkten seiner Tätigkeit als Industrieminister – wurden von ihm nur im Ansatz gestreift. Auch fehlten ihm vielfach die essentiellen Grundlagen der Wirtschaftspolitik und -theorie. Wahrscheinlich kam Guevara erst durch seine erste Frau Hilda Gadea (1925-1974) überhaupt in Kontakt mit diesem Thema. Inwiefern er jedoch tiefschürfend auf deren Wissen zurückgriff, ist ungewiss. Fest steht, die Peruanerin hatte Wirtschaftswissenschaften studiert und führte ihn während der gemeinsamen Jahre in Guatemala (1953-1954) und Mexiko (1955-1956) in die Grundlagen der marxistischen Wirtschaftstheorie ein. Eine wichtige Rolle spielten sicherlich auch Professor Harold White, der Guevara in Guatemala die wichtigsten Bestandteile des Werkes von Karl Marx erklärte, sowie Professor Anastasio Mancilla, der ihn in Kuba einmal pro Woche in einem marxistischen Arbeitskreis mit dem „Kapital“ vertraut machte. Das meiste Wissen aber eignete sich Guevara wohl im Selbststudium an. Nicht unwichtig waren dabei die täglichen Diskussionen der praktischen Probleme beim Aufbau des Sozialismus in Kuba, die seine Kenntnisse der wirtschaftlichen Zusammenhänge maßgeblich verbesserten, ohne jedoch zu einem kohärenten Gesamtbild zu gelangen.
Che Guevaras sozialistische Wirtschaftsphilosophie
Guevara näherte sich der Wirtschaft von der moralisch-philosophischen Seite an. Ziel war der „neue Mensch“ – hervorgebracht durch den Sozialismus. Entsprechend forcierte er den Übergang zur Planwirtschaft, wobei er als Minister äußerst dogmatisch an deren reiner Form festhalten wollte. Wirtschaftliche Entwicklung war für ihn allerdings nur ein Feld unter anderen, um den Sozialismus aufzubauen. Er richtete den Fokus daher nicht allein auf die staatliche Lenkung der Wirtschaft, die seiner Meinung nach notwendig war, sondern sah zugleich jeden einzelnen Kubaner und jede Kubanerin in der Pflicht, ihren Beitrag zum Gelingen der kubanischen Revolution und zum sozialistischen Aufbau zu leisten. Die „neuen Menschen“ sollten freiwillige Arbeitseinsätze und Aufbaudienste erbringen – zum Wohle der Gesellschaft und des wirtschaftlichen Fortschritts. Diese freiwilligen Arbeitseinsätze müssten durch die Gewerkschaften und die Partei gelenkt und organisiert werden. Er selbst ging mit Ernst und Eifer bei der praktischen Umsetzung dieser Idee voran und leitete das Batallón Rojo, das „rote Bataillon“, das die freiwillige Arbeit in der Landwirtschaft, Industrie oder auf dem Bau in gelenkte Bahnen brachte.
Im Denken Che Guevaras konnte der (wirtschaftliche) Sozialismus nur mit einer kommunistischen Moral einhergehen; die Wirtschaft musste Teil des Ganzen sein. Eine wesentliche Rolle in seiner Wirtschaftsphilosophie kommt dabei seinem Verständnis des Materialismus zu. Er verneint, dass erst eine bessere („materiellere“) Basis diesen „neuen Menschen“ schafft. Vielmehr müsse das neue soziale Gewissen parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung hervorgebracht werden. Es geht also nicht vorrangig um die Schaffung der materiellen Lebensgrundlagen für den „neuen Menschen“ (durch die Wirtschaft), sondern um die Schaffung des „neuen Menschen“ als solchen (durch die Gesellschaft). Seine Sicht brachte er mit folgenden Worten auf den Punkt: „Der ökonomische Sozialismus ohne die Moral des Kommunismus interessiert mich nicht.“
Diese Argumentationslinie bildet auch den Kern von Che Guevaras Handeln als Industrieminister in der Revolutionsregierung. Immer wieder kommt er darauf zurück. Das Ideal stellt er über die Realität, selbst dann, wenn er aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Ergebnisse inkonsistente Entscheidungen verteidigen muss.
Welches Vorbild: Sowjetunion, China oder Jugoslawien?
War Guevara in den frühen Jahren der Revolution noch starker Anhänger der Sowjetunion und Stalins, distanzierte er sich später immer mehr von der stalinistischen Version des Marxismus. Im Gegensatz zu Osteuropa war sein politökonomisches Handeln darauf ausgerichtet, eine umfassende Kopie des sowjetischen Modells geradezu zu vermeiden. Sein zentrales Argument dabei lautete, dass die Massen imstande sein müssten, ihr Schicksal selbst zu bestimmen und beispielsweise selbst zu entscheiden, welcher Anteil der Produktion dem Sektor der Akkumulation bzw. des Konsums zugeführt wird. Gemäß Guevara sollten die Entscheidungen in Wirtschaftsfragen allein durch die Massen getroffen und durch sie umgesetzt werden. Die Diskrepanz zur Sowjetunion ergab sich also weniger aus seiner Sichtweise auf Zentralisierung, Verstaatlichung oder Planwirtschaft. Die Unterschiede entsprangen Guevaras Wirtschaftsphilosophie, nämlich der Rolle, die die „neuen“ Menschen im Sozialismus einnehmen sollten. Realpolitisch ließen sich hingegen zunächst nur wenig Unterschiede zwischen Kubas Entwicklungsplan und der sowjetischen Wirtschaftsentwicklung ausmachen. Analog zur Sowjetunion strebte auch Guevara für Kuba einen schnellen Übergang zum Sozialismus an. Das beinhaltete zunächst die vollständige Verstaatlichung der kubanischen Wirtschaft. Ein weiteres (damit kohärentes) Element bildete die Einführung der Planwirtschaft. Bei der sozialistischen Industrialisierung des Landes setzte Guevara auf die Schwerindustrie.
Bei dieser Entscheidung ließ er allerdings einige grundlegende Unterschiede zwischen der Sowjetunion und Kuba außer Acht: Erstens verfügte Kuba weder über Kohle noch Eisen. Zweitens, mangelte es dem Karibikstaat an ausgebildeten Fachkräften. Drittens war der kubanische Markt für Stahlerzeugnisse viel zu klein, da das Land nach der Revolution gerade erst am Anfang der Wirtschaftsentwicklung stand. Dennoch hatte sich Guevara gegenüber Chruschtschow vehement für den Bau eines Stahlwerks für eine Million Tonnen Stahl eingesetzt. Wahrscheinlich erst auf Intervention von Fidel Castro ließ er diese Pläne fallen.
Während Guevaras Zeit im Industrieministerium arbeiteten dort auch tschechische und sowjetische Berater, was dafür spricht, dass die Sowjetunion Pate für die Entwicklung auf Kuba stand. Außerdem waren die Erfolge der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion unübersehbar. Guevara selbst leistete hierbei einen bedeutenden Beitrag. Beispielsweise gelang es ihm auf seiner Wirtschaftsreise 1960, an die Sowjetunion vier Millionen Tonnen Zuckerrohr zu Preisen über Weltmarktniveau zu verkaufen. Außerdem erhielt Kuba einen Millionen-Peso-Kredit, um damit Kapital- und Konsumgüter zu importieren. Und nicht zuletzt wollte die Sowjetunion helfen, Ölraffinerien zu errichten, die nationalen Ölressourcen zu erkunden, Nickelbergwerke zu entwickeln und das nationale Stromnetz auszubauen. Guevara schloss zudem im Zeitraum von 1961 bis 1965 mehr als hundert Verträge zur Errichtung von Industrieanlagen ab.
Dennoch sah Guevara die Entwicklung in der Sowjetunion immer kritischer. Vor allem auf einen Punkt kam er regelmäßig zurück: Dass im Zuge der Reformen unter Chruschtschow anstelle von moralischen Anreizen vermehrt materielle Anreize gesetzt wurden, war für Che Guevara der falsche Weg. Es entstünde dadurch ein hybrides System. Er ging sogar so weit, dass er behauptete, in dem sozialistischen Bruderland hätte sich eine kapitalistische Superstruktur etabliert. Bestes Beispiel dafür wären die landwirtschaftlichen Genossenschaften (Kolchosen). Seine Kritik an dem sowjetischen Handbuch für Wirtschaftspolitik, die er 1964 verfasste, wurde in Kuba umgehend unter Verschluss gebracht und erst 40 Jahre später publiziert.
Che Guevara setzte also nur vordergründig auf die Karte Sowjetunion. Wohl wissend, dass sich der Konflikt zwischen der Sowjetunion und China weiter zuspitzte, besuchte er auch die Volksrepublik. Trotz der essentiell notwendigen finanziellen und militärischen Unterstützung aus Moskau verhandelte er mit China über den Verkauf von 200.000 Tonnen Zucker und die Gewährung eines Kredits über 60 Millionen US-Dollar für chinesische Waren. Ganz im Sinne seiner Industrialisierungspläne lobte er zudem Mao Tse-tung für die Errungenschaften der Volkskommunen, die ein Beispiel für die lateinamerikanischen Länder seien. Auch die „freiwilligen“ Arbeitsbrigaden Maos beeindruckten ihn. Unmittelbar nach seinem China-Aufenthalt propagierte er auf Kuba noch stärker als zuvor diese freiwilligen Arbeitseinsätze, was sich unschwer mit dem Einfluss des chinesischen Entwicklungsweges erklären lässt. Alles in allem zeigt sich in seiner praktischen Ausrichtung wie in seinem theoretischen ökonomischen Denken, dass Kuba einen eigenen Weg zum Sozialismus gehen sollte – mit Elementen und Anleihen aus der Sowjetunion (Schwerindustrie) und China (Volkskommunen, Freiwilligendienste).
Doch Che Guevara reiste nicht nur in die Sowjetunion und nach China. Auf seinem Reiseplan stand auch Jugoslawien, das offiziell mit dem sowjetischen Block gebrochen hatte. Er ließ sich dort das Selbstverwaltungssystem erklären und erhielt Einblick in das Genossenschaftswesen. Obwohl sich Jugoslawien weiterhin auf dem Weg zum Sozialismus sah und große Fortschritte bei der Industrialisierung erzielt hatte, stand Che Guevara diesem Modell sehr skeptisch gegenüber. Er zog es auch niemals als eine Alternative für Kubas Entwicklung ernsthaft in Betracht. Zwar begrüßte er die demokratischen Freiheiten in dem Land, vor allem die Diskussionskultur und die Mitsprache der Arbeiter. Aber zugleich sah er das System der Selbstverwaltung als einen vom Management getriebenen Kapitalismus mit einer sozialistischen Verteilung der Profite an. Der Wettbewerb zwischen den Betrieben liefe seiner Meinung nach der Idee des Sozialismus zuwider. Er hat jedoch nie weiterführende Fachliteratur zur Selbstverwaltung studiert. Vielmehr beendete er seine „Studien“ durch die praktischen Einsichten in Jugoslawien, die seiner sozialistischen Philosophie des „neuen“ Menschen entgegenstanden.
—————————-
Bildquellen: [1], [2] Quetzal-Redaktion, pg