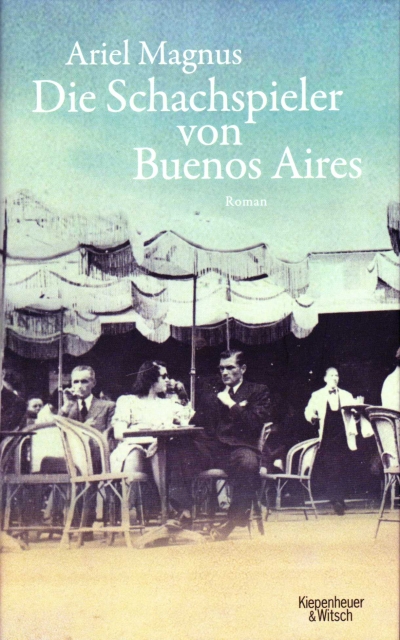Juan José Saer wurde zweimal geboren. Das erste Mal hat ein Datum und einen Ort: Er kam am 28. Juni 1937 in Serodino (Provinz Santa Fe, Argentinien) auf die Welt. Das zweite Mal geschah es in einer Zeit jenseits der Zeit der Uhren und Kalender (der Zeit seiner Romane) und in einem praktisch unendlichen Gebiet (dem riesigen Gebiet, das vom Paraná-Fluss und seinen zahlreichen Nebenflüssen begrenzt wird, wo sein gesamtes literarisches Werk spielt). Nun sind zwanzig Jahre seit seinem Tod in Paris am 11. Juni 2005 verstrichen (den Tod gibt es nur einmal). Um seiner Person in diesem kleinen Aufsatz zu gedenken, wird versucht, Saers Botschaft zu entschlüsseln. Denn genau das war sein Werk: eine in das aufgewühlte Meer der Literatur geworfene Flaschenpost. Man kann sogar behaupten, dass sie eine versteckte Botschaft enthält. So verborgen ein wenig gelesener Autor außerhalb Argentiniens auch sein mag (und noch weniger bekannt ist er im deutschsprachigen Raum, wo bislang lediglich drei seiner Romane aufgelegt wurden). Unterdessen schwächt der unaufhaltsame Lauf der Zeit die Glanzpunkte seiner Bücher mit anderen Schatten. Genau darin liegt der Wert eines runden Jahrestages: das willkürliche Licht der Jubiläen zu nutzen, um das zu beleuchten, was zeitlos ist, und dabei einige Schlüssel für uns, seine abgelenkten Leserinnen und Leser der Gegenwart, in Erinnerung zu rufen und darüber nachzudenken.
Saer war ein Erneuerer der Literatur. Wie Don Quijote stellte er sich einer neuen Welt mit alten, rostigen Waffen. Jede Revolution birgt in sich eine ausgewogene Mischung aus Anachronistischem und radikal Zeitgenössischem. In der Literatur besteht diese Alchemie nämlich darin, Form und Inhalt in Einklang zu bringen. Er entwarf eine Art Widerstandsprogramm, damit die Literatur nicht die Autonomie verliert, die notwendig ist, um die „Glücksformel“ zu finden. Er lehrte uns, dass man für ein solches Unterfangen keine Eile haben soll, denn der Mensch braucht Zeit zum Atemholen. Deshalb ist sein Werk so wichtig und es könnte immer mehr und besser gelesen werden. Deshalb warten seine Bücher insgeheim darauf, in Form eines verschlüsselten Manifests veröffentlicht zu werden, ganz im Stil eines Pariser Avantgardisten der 1920er Jahre, der sich noch immer in den Katakomben versteckt hält, nachdem jemand da oben die Schreibmaschine erfunden hat.
Schreiben nach Borges
Das Erzählen ist nicht das willkürliche Ergebnis launischer Kräfte. Es bedeutet vielmehr, Entscheidungen zu treffen und auszuwählen. Das heißt, es bedarf eines Subjekts, das in einer Welt, die darauf bedacht ist, uns nacheinander zu Objekten, zu Waren zu machen, Entscheidungen trifft. Denn nur das Subjekt ist in der Lage, den literarischen Berg, der vor uns liegt, einigermaßen unbeschadet zu bewältigen. Nur das Subjekt kann das Gefühl überwinden, dass bereits alles gesagt bzw. geschrieben wurde. Mehr noch: Nur das Subjekt kann das Gefühl besiegen, das den Schriftsteller nach dem großen Roman des 19. Jahrhunderts überkommt – und zwar die „Abneigung gegen das Erzählen” dessen, was scheinbar bereits erzählt wurde, bevor man überhaupt eine Erzählung beginnt.
Gleichzeitig gibt es Menschen, die sich von diesem Gefühl überwältigen lassen und letztendlich schweigen. Es ist anzunehmen, dass man, wenn man so beginnt, mit hoher Wahrscheinlichkeit in Kriminalromanen oder Mystik Zuflucht sucht – in Wirklichkeit zwei Seiten derselben Medaille (uns ist ja bekannt, wer die Medaille kontrolliert). Man wendet sich von der Realität ab, indem man das Wenige, was von der Realität in einem selbst übriggeblieben ist, literarisch ausschöpft (so genannte Autofiktion). Oder damit, wohl auch bewusst Opfer der Realität zu werden, indem man sich darauf beschränkt, ihre Auswirkungen abzuschwächen (wie jemand, der sein Gefängnis beschmückt – Autofiktion plus). Und wenn nichts davon funktioniert, wenn man kein „Ich“ hat und auch kein Verlangen danach, sucht man es schließlich woanders, was so etwas wie die literarische Version von Verschwörungstheorien ist. Es bedarf einer Verschwörung, die uns den Schlüssel zur Geschichte liefert (das Schreiben wird zur Übung eines Büroangestellten, der bereits weiß, was er schreiben muss, weil alles im Voraus festgelegt ist). Darüber hinaus könnte man eine Literaturgeschichte anhand dieser Frage betreiben. Wer hat sich mit den vermeintlichen Beweisen des Ichs abgefunden? Wer hat sich von der Melancholie einer von der Vergangenheit geprägten Gegenwart überwältigen lassen? Und wer hat trotz allem ohne Komplexe weitergesucht, auch in dieser Vergangenheit, nach der für seine Gegenwart am besten geeigneten Erzählform?
Jorge Luis Borges ist derjenige, von dem man die Antwort auf diese letzte Frage und den Ausweg aus den ersten beiden erhalten kann. Er war es, der in einer Bibliothek in Buenos Aires den Weg gefunden hat, das Gespenst der Literatur zu überwinden und einen neuen, seiner Zeit entsprechenden Ort zu erreichen. Denn Borges deaktivierte die „Versuchung des Ichs”, indem er sich darauf beschränkte, Kurzgeschichten zu schreiben. Zusammen mit seinem Kumpan Adolfo Bioy Casares stellte er den Kriminalroman auf den Kopf, indem er ihn in eine metaliterarische Übung verwandelte. Borges‘ Universalgeschichte der Niedertracht (Span.: Historia universal de la infamia, 1935) kann sich als ein in Fortsetzungen erstelltes Schreibhandbuch darüber verstehen, wie man aus Verbrechen literarische Substanz macht. Ihm es damit gelungen, Werkzeuge zu liefern, um das Romangenre zu überdenken – und zwar ohne es durchlaufen zu haben.
Saer musste nicht nur nach Marcel Proust und James Joyce Literatur betreiben. Wie bereits erwähnt, musste er auch nach Borges schreiben. Obwohl er aus demselben Land wie der Meister stammte, sah er sich dazu gezwungen, dies zudem aus der Provinz heraus zu tun – also außerhalb Argentiniens lebenswichtigem, politischem und kulturellem, allmächtigem Zentrum Buenos Aires. In einem Aufsatz, der als unumgänglicher Text der argentinischen Literatur gilt, bemerkt Borges, dass den Argentiniern aufgrund ihrer peripheren Lage gegenüber den großen literarischen Strömungen nichts anderes übrig bleibt, als sich mit dem Universellen auseinanderzusetzen. Saer musste diese Lektion an seine doppelte „Randlage“ (nicht nur als Argentinier, sondern auch als Einwohner Santa Fes) anpassen. Sein Aufenthalt in Frankreich 1968 verwandelte sich aufgrund des Militärputsches 1976 in ein Exil – wohl die Randlage schlechthin. Wie bekannt ist, war Borges‘ politische Haltung weit davon entfernt, dies durchmachen zu müssen.
Um sich mit Saers Werk auseinanderzusetzen, muss man diesen literarischen und politischen Kontext berücksichtigen, aber man sollte sich nichts vormachen: Saers Werk beschränkt sich nicht darauf, dass ohnehin wertvolle Zeugnis eines Exilanten zu sein – und seine Literatur ist nicht die eines Borges-Epigonen. Saer bot auch seine eigene Antwort auf die Frage, wie man gegenwärtige Literatur betreiben kann, eine Problematik, derer er sich als Schriftsteller voll bewusst war. In einer Erzählung aus seinem Erzählungsband La mayor (1976) formuliert er es etwa so: „Anderen ist es früher gelungen.“ Die Frage nun ist, ob es ihm wieder gelingen kann. Saer selbst drückt es an anderer Stelle mit Goethes‘ Worten aus: „Der Roman ist ein subjektives Epos, in dem der Autor um Erlaubnis bittet, das Universum auf seine Weise behandeln zu dürfen; das einzige Problem besteht darin, ob er einen Weg dazu findet oder nicht – der Rest ergibt sich von selbst.“ Wie die neulich verstorbene Beatriz Sarlo bemerkte: „Saer konnte es nicht, und dann kam ein Moment, in dem ihm es plötzlich gelang.“ Saer fand schließlich doch seinen Weg, die Realität literarisch zu behandeln. Die folgenden Seiten stellen nur einige Erläuterungen dazu dar, wie er dies tat.
Zunächst einmal gibt es zwei Szenen, die Saers Art verdeutlichen. Die argentinische Literatur ist voller Legenden, aber nur wenige können sich mit dieser messen. Bekanntlich ließ sich der polnische Schriftsteller Witold Gombrowicz zufällig in Buenos Aires nieder, als ihn dort 1939 der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs überraschte. Für viele war sein Erscheinen in Argentinien gleichbedeutend mit der Ankunft des Messias. Gombrowicz lernte Spanisch in den Billardhallen der Hauptstadt, wo er mithilfe der Stammgäste eine kollektive Übersetzung seines 1937 erschienen Romans Ferdydurke anfertigte, der weitere folgten. Obwohl nicht genau gesagt werden kann, ob es in den Kneipen oder durch das intensive Lesen polnischer Literatur geschah, wurde dank ihm eine neue Richtung in der argentinischen Literatur eingeschlagen, die auf unbekannten Pfaden auch zu Autoren wie beispielsweise Osvaldo Lamborghini, César Aira und Pablo Katchadjian führt.
Der Überlieferung nach rief Gombrowicz seinen jungen Freunden und Mitstreitern vom Deck des Schiffes, das ihn 1963 nach Europa zurückbrachte, zu: „Tötet Borges!”. Dieser Ruf erschien mir schon immer als Produkt eines schlechten bürgerlichen Gewissens: Der Vater musste getötet werden. Tatsache ist jedoch, dass jeder der Anwesenden den Befehl so interpretierte, wie man konnte. Saer, der sich aus dem hektischen Leben in Buenos Aires zurückgezogen hatte und weit entfernt von dieser Szene war, reagierte etwas subtiler: Er lud Borges nach Santa Fe ein.
Das besagte Treffen fand 1968 statt. Zu diesem Anlass hielt Borges einen Vortrag über Joyces‘ Ulysses, woraufhin beide einen öffentlichen Dialog führten (der 20 Jahre später in der Zeitschrift Crisis veröffentlicht wurde). Bei dieser Gelegenheit fragte Saer seinen Gast nach dessen politischer Einstellung (die bekanntlich zu diesem Zeitpunkt bereits umstritten war). Borges antwortete ihm mit einer Verteidigung der Autonomie der Literatur:
–Borges: …ich denke, dass die Meinung eines Schriftstellers das Unwichtigste ist, was er hat. Meinungen sind im Allgemeinen wenig wichtig. Eine Meinung, die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei oder das, was man als ‚engagierte Literatur‘ bezeichnet, können zu bewundernswerten, mittelmäßigen oder verachtenswerten Werken führen. Literatur ist nicht so einfach. Sie hängt nicht von unseren Meinungen ab, sie ist etwas, dass man nicht mit Meinungen macht. Ich glaube, dass Literatur viel tiefgründiger ist als unsere Meinungen, dass sich diese ändern können und unsere Literatur dadurch nicht anders wird, oder?“ (Crisis, S.48)
„Literatur ist nicht so einfach.“ Saer antwortete einige Sätze später, um die bereits erwähnte Autonomie der Literatur noch weiter zu bekräftigen – jedoch auf eine Weise, die nicht mehr die von Borges ist. Saer bemerkte ihm, dass dessen Erzählung El simulacro (dt.: „Das Scheinbild“ im Erzählungsband Borges und ich) offensichtlich peronistisch sei (eine selbst in Argentinien schwer zu erklärende politische Kategorie, die in diesem Zusammenhang das Gegenteil der von Borges vertretenen konservativen Haltung bezeichnet), obwohl er selbst in diesem Gespräch erwähnt, dass ihm der Peronismus zuwider sei:
–Saer: Das Kuriose daran ist, dass die Erzählung ein treffendes Bild des Peronismus vermittelt, ohne jegliche Feindseligkeit, und Dinge hervorhebt, die im Peronismus wirklich positiv waren.“ (Crisis, S.49)
Borges wird sich von Saers Interpretation distanzieren und sagen, dass dies ohnehin nicht mehr in die Zuständigkeit des Autors falle – und weicht der politischen Frage aus, indem er meint, dass sie es nicht wert sei, beantwortet zu werden. Saer entgegnet ihm, dass dessen Interesse an den politischen Ansichten nicht unbegründet sei. Letztendlich könnte man sagen, dass es eher irrelevant ist, was Borges vom Peronismus hält. Die Frage, so schlussfolgert Saer, sei vielmehr, dass Borges‘ Denken aufgrund seines Werks interessant ist – und dieses ist von grundlegender Bedeutung. Auf diese Weise gibt Saer Borges die Aussage, „Literatur ist nicht so einfach“, zurück. Das ist sie in der Tat nicht. Literatur hat ihre eigene Autonomie – auch in politischer Hinsicht. Saer greift zu Borges‘ Waffen, um die Autonomie der Literatur zu verteidigen. Dabei entwickelt er jedoch eine eigene Art, die Welt literarisch zu erschließen. Er folgt Borges in dessen Bekenntnis zur Fiktion, die nicht als Gegensatz zur Wahrheit oder Realität zu verstehen ist, sondern als eine Realität mit eigenen Regeln, die manchmal wahrer ist als die Realität selbst. Saer geht über Borges hinaus, um dieses Bekenntnis noch weiterzuführen. Er setzt alles auf eine Karte:
Das Paradoxon der Fiktion besteht darin, dass sie, wenn sie sich der Lüge bedient, dies tut, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Die schlammige Masse des Empirischen und Imaginären, die andere nach Belieben in Scheiben von Wahrheit und Lüge zerlegen möchten, lässt dem Autor von Fiktionen nur eine Möglichkeit: sich darin zu versenken.“ (Saer [1997] 2016, S.12)
Saer ist in der Lage, eine vollständige Welt mit ihren Ambivalenzen und Widersprüchen darzustellen. Seine Vorgehensweise ist insofern radikal, als die Erzählweise die Entfaltung dieser Realität selbst begleitet. Der Autor weiß nicht mehr als die von ihm geschaffenen Figuren und auch nicht mehr als die Leser:innen. Das Schreiben entsteht entweder aus dem Inneren der Erzählung heraus und nicht von außen (ausgehend von einer vorab festgelegten Handlung) oder gestützt auf die Erfahrungen eines Erzählers in der ersten Person (sei es der Autor oder eine andere Person). Er schreibt wie ein Ethnograf, der plötzlich inmitten einer beliebigen Gruppe auftaucht. Für ihn bedeutet das vollständige „Eintauchen” in die Fiktion, Literatur in Anthropologie zu verwandeln oder, wie er selbst sagte, in „spekulative Anthropologie”.
Daher geht seine Literatur von den bisherigen Lebenserfahrungen der Figuren und der sozialen Komplexität aus, die sie prägt – sowie von der Überschneidung von Zeit und Raum, die jedes Subjekt verkörpert. Denn Saer schafft Figuren, die ihr Leben mit sich herumtragen, mit den Unstimmigkeiten, Erwartungen und Misserfolgen, die den Einzelnen über sich selbst hinaus prägen. In seiner Erzählweise kommt eine komplexe „Stratigraphie der Erfahrung“ zum Ausdruck, ähnlich wie bei der anglo-irischen Schriftstellerin und Philosophin Iris Murdoch oder dem österreichischen Schriftsteller Peter Handke: Eine Literatur, die darauf abzielt, die Dichte der Realität einzufangen. Wir haben es hier also mit einem Schriftsteller zu tun, der in der Lage ist, ein literarisches Projekt zu entwerfen, ein ganzes System, in das seine Erzählungen und Romane integriert sind, ganz im Stil von William Faulkner.
Die technische Umsetzung dieses literarischen Projekts veranlasst ihn dazu, sich auf andere Kolleg:innen zu stützen, die bereits außerhalb des Borges-Kreises agierten – wie beispielsweise Antonio Di Benedetto. Noch wichtiger ist jedoch, dass Saer den Roman anhand eines avantgardistischen „Rezeptbuchs“ erneuert, wie der Schriftsteller Ricardo Piglia betont: Er wendet die Techniken der großen modernen Erzählkunst (Beschreibung, Zeitdetail, Verweilen) auf subtile und scheinbar unbedeutende Gesten an (die man aus traditioneller Sicht niemals auf diese Weise erzählen würde). Die Realität wird dabei auf verschlungenen Wegen erreicht (wie beispielsweise in Di Benedettos Erzählung El Silenciero – dt.: Stille), die immer von großer Bedeutung sind. Auch in dieser Hinsicht ist Saers Sichtweise äußerst politisch. Seine Art, das Kleine im Großen zu erzählen, dringt in das vor, was gewöhnlich in Schweigen gehüllt bleibt – selbst wenn gerade in diesem Schweigen, der Kern des Politischen liegt. Sein Werk beschäftigt sich mit den subtilsten Handlungssträngen: denen, die mit dem Alltag und den routinemäßigen Abläufen des täglichen Lebens zu tun haben. (Allerdings ist das ein ähnliches Motiv wie bei Miguel Espinosa, einem leider völlig unbekannten spanischen Schriftsteller.) Das literarische Anliegen führt ihn zum französischen Objektivismus (u. a. Alain Robbe-Grillet und Michel Butor) und, einmal in Frankreich angekommen, zur Phänomenologie.
Halb ausradiert
Zu Beginn wurde erläutert, dass Juan José Saer zweimal geboren wurde. Damit sollte nicht gemeint sein, dass Leben und Werk dieses Schriftstellers voneinander getrennt sind. Bei Saer sind Leben und Werk weder voneinander getrennt noch identisch, sondern vielmehr eng miteinander verbunden. Anders gesagt, es besteht eine Verbindung zur Literatur, die mit dessen Vorstellung von literarischer Fiktion als einer autonomen Welt, in die der Autor eintauchen muss, im Einklang steht. Für Saer soll das „Handwerk“ des Schreibens entweder beiseitegelassen oder unmittelbar präsentiert werden, und zwar ohne jegliche Beschönigungen und Übertreibungen. Beatriz Sarlo wies wiederholt darauf hin, dass Saer in seinen täglichen Begegnungen bezeichnenderweise nicht über Literatur sprach. Und wenn er es doch tat, dann eher auf eine viszerale Art und Weise, beispielsweise gegen jemanden oder etwas. Diese Haltung spiegelt sich auch in anderen Gesten des Autors wider.
Aus den Anekdoten, an die man sich anlässlich seines zwanzigsten Todestages erinnert, lässt sich ein Bild von Saer zeichnen, der die Schlichtheit eines Dorfbewohners und die zurückhaltende Ernsthaftigkeit eines Handwerkers besitzt, der sich nur durch seine Werke ausdrückt. Sarlo erzählt, dass es Saer war, der sie in das Werk Walter Benjamins einführte. Das geschah bei einem Treffen in einem Restaurant, als Saer ihr ohne weiteres ein Buch des deutschen Kulturkritikers in die Hand drückte. Das war alles, und genau in dieser Geste liegt alles enthalten. Sehr bedeutsam ist die Tatsache, dass seine Vorlesungen an ebenso peripheren, dezentralen Universitäten gehalten wurden, wie der Universidad del Litoral (Argentinien) oder der Université de Rennes (Frankreich), wo er von 1968 bis 2002 als Dozent tätig war. Dabei ist wohl denkbar, dass gerade diese „Distanz” es ihm weitgehend ermöglicht hat, weder ein Schriftsteller-Akademiker noch ein Akademiker-Schriftsteller zu werden.
 „Literatur ist nicht so einfach“: Wie er selbst einmal sagte, sie sei nicht die romanhafte Darstellung dieser oder jener Ideologie, sondern eine spezifische Auseinandersetzung mit der Welt, untrennbar verbunden mit dem, was sie behandele. Anders gesagt, die Literatur dürfte nicht auf ein weiteres akademisches Fach reduziert werden – wie es üblicherweise in den Hochschulen der Fall ist. Denn sie befasst sich mit dem Leben selbst und all den komplexen Beziehungen, die es beinhaltet. Sarlo erzählt weiterhin, dass eines Tages Saer in der Redaktion einer Zeitschrift erschien, bei der sie eine kurze Rezension eines seiner Romane veröffentlicht hatte, nur um sich bei ihr dafür zu bedanken. Manche sagen, Saer habe die Gelegenheit gehabt, tiefgründige Gespräche mit dem Dichter Juan Laurentino Ortiz (1896-1978) zu führen. Ortiz, der als einer seiner wichtigsten Referenten gilt, taucht sogar als Washington Noriega in Saers Werk auf. In diesem Sinne lässt sich feststellen, dass es darum geht, als Schriftsteller das zu verschweigen, was ein Dichter über die Poesie verschweigt: Wie ein Dichter zu schreiben, der Verse „aufbläht” und sie „dehnt”, bis sie die Form von Erzählungen und Romanen annehmen.
„Literatur ist nicht so einfach“: Wie er selbst einmal sagte, sie sei nicht die romanhafte Darstellung dieser oder jener Ideologie, sondern eine spezifische Auseinandersetzung mit der Welt, untrennbar verbunden mit dem, was sie behandele. Anders gesagt, die Literatur dürfte nicht auf ein weiteres akademisches Fach reduziert werden – wie es üblicherweise in den Hochschulen der Fall ist. Denn sie befasst sich mit dem Leben selbst und all den komplexen Beziehungen, die es beinhaltet. Sarlo erzählt weiterhin, dass eines Tages Saer in der Redaktion einer Zeitschrift erschien, bei der sie eine kurze Rezension eines seiner Romane veröffentlicht hatte, nur um sich bei ihr dafür zu bedanken. Manche sagen, Saer habe die Gelegenheit gehabt, tiefgründige Gespräche mit dem Dichter Juan Laurentino Ortiz (1896-1978) zu führen. Ortiz, der als einer seiner wichtigsten Referenten gilt, taucht sogar als Washington Noriega in Saers Werk auf. In diesem Sinne lässt sich feststellen, dass es darum geht, als Schriftsteller das zu verschweigen, was ein Dichter über die Poesie verschweigt: Wie ein Dichter zu schreiben, der Verse „aufbläht” und sie „dehnt”, bis sie die Form von Erzählungen und Romanen annehmen.
Für Saer ist das Schreiben so etwas wie sich bewusst zu sein, dass man lebt und gelebt hat. Die Erzählung bahnt sich seinen Weg durch den dichten Dschungel der Realität, als würde man das, was man liest, selbst erleben – oder genauer gesagt, als würde man sich beim Lesen an eine vergessene Erfahrung erinnern. Wie im Leben gibt es auch in der Literatur keine zwei gleichen Erlebnisse, genauso wenig wie es zwei gleiche Leseerlebnisse gibt. Und genau das bedeutete Literatur für Saer: ein Umschreiben, das im Laufe der Zeit seine eigenen Spuren verwischt. Saers Erzählungen gehen über sein unmittelbares, alltägliches Leben hinaus, und gleichzeitig auch über das Leben selbst, dank seiner meisterhaften Beherrschung der Erzählkunst, verstanden als eine Form der Intensivierung von Zeit und Raum der Erfahrung. Saer ließ sich weder von den Dringlichkeiten des Alltags noch von den Anforderungen des Marktes davon abbringen, auch nur ein einziges Komma seiner Texte zu ändern. Selbst wenn so etwas passieren konnte (La ocasión, 1987; El río sin orillas, 1991), gelang es ihm jedoch, seinem Vorhaben stets treu zu bleiben. Selten hat man als Leser:in die Gelegenheit, beim Lesen zu spüren, wie das Leben immer intensiver wird. Ebenfalls selten liest man so, als würde jede umgeschlagene Seite die vorherige auslöschen – so wie ein Tag den anderen ablöst. Die von diesen Aktionen hinterlassenen Spuren schaffen Erinnerung und daraus entsteht Erfahrung.
Saer gehört zu jenem Kreis von Schriftstellern, die die Thesen der Phänomenologie literarisch umgesetzt haben. Es wurde einmal gesagt, sein Projekt sei eine Art „Neufassung“ Marcel Prousts. Tatsächlich stellt Saer den Versuch dar, die „verlorene Erfahrung“ durch das Schreiben wiederzufinden. Bewies Proust bereits diese Unmöglichkeit, so verleiht der Argentinier dieser Suche Gestalt: Er verkörpert die Erfahrung ebenso wie das Schreiben und den Ort, von dem aus erzählt wird. Sowohl die Figuren als auch die erzählende Person haben einen Körper und einen irdischen Blick: Die Wahrnehmung ist in Saers Literatur niemals allwissend.
Man könnte sogar behaupten, dass Saer der Schriftsteller der „Sonnenaufgänge“ ist und seine Figuren immer wieder aufwachen, um zu sagen: „Hier beginnt die Handlung“, „hier geht die Geschichte weiter“ usw., sodass jeder Sonnenaufgang der Erzählung mehr Dichte verleiht. Was Proust in seiner Recherche versuchte, wendet Saer in der Regel auf seine Figuren an. Denn diese werden stets in die Komplexität ihrer eigenen und fremder Perspektiven versetzt. Dazu kommen Raum und Zeit: Ein Tag kann zweihundert Seiten in Anspruch nehmen, 20 Jahre können wiederum in einem einzigen Absatz zusammengefasst werden.
Wie im Leben selbst gleicht die Zeitlichkeit einer archäologischen Stratigraphie, deren Gestalt sich entsprechend der Erfahrung eines bestimmten Moments verändert. Das subjektive Bewusstsein verbindet Raum, Zeit und Handlung, jedoch eher auf fragmentarische Weise. Die Einheit, in die die Erzählung eingebettet wird, vermittelt die Illusion einer Kontinuität, die das Erinnern und die Erinnerung an das Geschehene begünstigt: Das heißt, das bereits erwähnte Umschreiben. Dies macht Saer zum Wegbereiter einer Erzählweise, die sich dadurch auszeichnet, dass Situationen aus einer gewissen Distanz geschildert werden – als würde man beobachten und gleichzeitig beobachtet werden. Diese Tendenz lässt sich auch bei jüngeren Autoren wiedererkennen, wie beispielsweise den Argentinierinnen Cecilia Pavón und Fernanda Laguna sowie dem Chilenen Alejandro Zambra.
Saer ist auch ein Erneuerer des Romans, indem er mit literarischen Strukturen spielt, um Schreiben und Erfahrung einander anzunähern. In der Handlung vergehen die Figuren und ihre Beziehungen, um dann wieder in Erinnerung gerufen zu werden und wieder aufzutauchen. In diesem Kontext registriert die Beobachtung Situationen, die sie anschließend verschlingt. Im Roman El limonero real (1974) beispielsweise gehen Wenceslao und Rogelio zu Teresas Haus:
Sie haben während der gesamten Strecke kein einziges Wort miteinander gewechselt; allmählich beginnt Rogelio zu keuchen. Sein riesiger Körper wankt bei jedem Schritt. In diesem Moment ist der Teil des Weges, den sie durch den kleinen Wald zurückgelegt haben, leer; und auch der diagonal verlaufende Weg, der die viereckige Lichtung durchquert, wird immer leerer, je weiter sie vorankommen. Später werden sie ihn in umgekehrter Richtung zurücklegen und ihn schließlich bis zum Haus füllen, bis er völlig leer ist; aber zuvor werden Teresa oder Teresita ihn füllen: Sie werden ihn füllen, während sie den Weg entlanggehen, und ihn leer lassen, bis er schließlich völlig leer ist.“ (El limonero real, S.58)
Daraus ergibt sich ein Bild, das wohl zum Nachdenken anregt. Wie der Schriftsteller Ricardo Piglia betonte, bedeutet für Saer das Schreiben eher Ausradieren. Doch wie man feststellt, ist das Löschen nie erfolgreich. Denn das Lesen von Saers Werk hinterlässt den Eindruck, dass doch immer etwas zurückbleibt. Das, was zurückbleibt, auch wenn schwach und fragmentarisch, ist nämlich die Erfahrung. Saer macht sich daran, etwas so Subtiles wie diesen Mechanismus literarisch einzufangen. Wie bereits erwähnt, ist dies die Geste eines Dichters, der zum Schriftsteller geworden ist. Doch er begnügt sich nicht damit, denn seine Literatur wagt es, die Grenzen des Sichtbaren zu sondieren: das, was weder Erfahrung, Erinnerung noch Gedächtnis in Form einer rationalen und strukturierten Erzählung artikulieren können.
Die kannibalische Realität
Im Roman Cicatrices (etwa „Narben“) wird die Geschichte von vier Peronisten erzählt, in der Zeit, nachdem Juan Domingo Peróns Partido Justicialista 1955 verboten wurde.. Saer schildert dort die Ereignisse auf eine völlig neue Weise. Denn Cicatrices ist nicht nur ein Roman über diesen Rückschlag für die Demokratie in Argentinien. Vielmehr handelt es sich um einen Roman, der die tiefgreifenden (manchmal unsichtbaren) Schäden thematisiert, die damals durch die politische Reaktion verursacht wurden. Der Autor beschreibt den sozialen und kulturellen Verfall, unter dem nun vereinzelte Individuen leiden, nachdem das große Volksprojekt, das ihr Leben geprägt hatte, unterdrückt wurde: Was geschieht, wenn es nicht mehr möglich ist, die Realität politisch zu steuern, und sie uns schließlich verschlingt. Daher kann man behaupten, dass Cicatrices ein Roman der Überschreitungen ist. Denn er schafft einen aus Albträumen und Unsicherheit bestehenden Raum, in den man infolge des Verlustes aller Bezugspunkte versetzt wird. Die Figuren bewegen sich in einem Wirrwarr von Beziehungen, die stark von Spannungen, Hass und fehlgeleitetem Verlangen geprägt sind.
Saer wählt einen subtilen, eindringlichen Weg, um uns den erstickenden Effekt dieser politischen Krise vor Augen zu führen. Es handelt sich um einen Akt, der zuweilen defätistisch und pessimistisch sein mag, gleichzeitig auch enorm anregend, um über die politischen Dimensionen der Gewalt nachzudenken, welcher die Niederlage in den Alltag und in die Intimität einzieht. Meiner Ansicht nach haben nur wenige Autor:innen es gewagt, sich literarisch mit den negativen Seiten der Politik auseinandergesetzt – und zwar mit der Lücke, die die Politik hinterlässt, wenn sie versagt. Anders gesagt: Wenn man sich der Realität ohne „Schutzmechanismen“ stellt, weil man nicht mehr sein darf, wie man ist. Offensichtlich eine harte, „kannibalische“ Realität, in der die kulturellen Ressourcen, die uns früher gestützt haben, nicht mehr gelten.
In diesem Zusammenhang erzählt Saer beispielsweise den Traum des Richters Ernesto Garay, um den Sinnverlust insofern als Verlust der eigenen Welt darzustellen. Dabei wird deutlich, dass kulturelle Mechanismen nicht ausreichen, um sich der Realität zu stellen. An einer Stelle des Traums beginnt eine Gruppe von sogenannten Gorilas (so werden in Argentinien die bedingungslosen Perón-Gegner:innen genannt) eine Orgie um ein Lagerfeuer herum. Anschließend wird erzählt, dass die Nacht hereinbricht und ein neuer Tag beginnt, denn vom Lagerfeuer sind nur noch Asche übrig. Nun holen die Gorilas das Fleisch für das Frühstück aus den Höhlen: „Stücke rohes Fleisch”, die sie essen, wobei sie sich völlig mit Blut bekleckern. Alles geschieht am selben Ort, aber niemand scheint die Unterschiede zu bemerken: „Sie bewegen sich darin, ohne zu verstehen” (Cicatrices, S. 217). „In dieser seltsamen Melancholie vergehen die Stunden der Muße…“ (Cicatrices, S. 218), bevor sie weiter „geopferte“ Tiere verschlingen. Der Traum lässt das Chaos erkennen, in dem die Besiegten leben müssen, gefangen in der Wildheit von Menschen, die die grausamste und unerträglichste Hierarchie als normal erscheinen lassen. Gewiss beschreibt Saer diese fressende Realität indirekt durch die Erzählung eines zuweilen surrealistischen Traums. Doch dieser „Ausflug“ an die Grenzen der Erzählung ermöglicht es ihm, etwas noch Wirklicheres zu erreichen. Hier verleiht die Fiktion dem, was die Realität nicht mehr leisten kann, eine neue Bedeutung, die jedoch als seltsame Melancholie empfunden werden kann.
In Der Vorfahre machte Saer aus der bereits geschildeten Sinnkrise eine Art anthropologischer Abhandlung. Dort geht er zurück ins 16. Jahrhundert, um die Geschichte eines jungen Spaniers zu erzählen, der von den Colastiné-Indianern an der Mündung des Río de la Plata entführt wurde. Kurz nach seiner Ankunft im Dorf wird der Mann Zeuge einer wilden Orgie, zu der sich kannibalistische Gewalt und Mord gesellen – was eine schwer zu verdauende Sinnlosigkeit beschreibt. Man stellt jedoch fest, dass die Sinnlosigkeit hier nur scheinbar ist. Nur für den Außenstehenden ist es Unsinn – für diejenigen, die die kulturellen Codes der Indianer noch nicht kennen.
Das im Roman Der Vorfahre dargestellte Chaos ist im Gegensatz zum bereits erwähnten Cicatrices in Wirklichkeit ein rituelles Mittel, das den Abgrund symbolisieren soll, auf dem die Kultur errichtet ist. Wenn die kulturellen Ressourcen einer Gruppe erschöpft sind, entsteht eine Art Kannibalismus – was hier im wörtlichen Sinne geschildert wird. Im Laufe der Jahre versteht der Neuankömmling, dass dieses Bedürfnis, Chaos zu schaffen, eine Möglichkeit ist, sich in einer Welt zu behaupten, die man nicht kontrollieren kann. Die Indianer gehen geschickt mit ihren Ressourcen um, aber die Welt, in der sie leben, ist hart, eine „Unwirtlichkeit, die sie malträtierte, bestehend aus Hunger, Regen, Kälte, Dürre, Überschwemmungen, Krankheiten und Tod“ (Der Vorfahre, S. 107), zu der noch eine tiefere Unwirtlichkeit hinzukommt: die Unwirtlichkeit einer Existenz, die ständig in Gefahr ist. Für sie „gewährleistet die bloße Präsenz der Dinge nicht deren Existenz” (Der Vorfahre, S. 154). Der Pakt mit der Welt muss immer wieder erneuert werden. Ihre Existenz muss erneut bestätigt werden, indem die Menschen die Trennung zwischen ihnen und dem Chaos wiederherstellen, das damit einhergeht, zu einem passiven Objekt zu werden, das den Launen der Welt unterworfen ist:
Ich dachte, dass sie, dankbar dafür, dass ihr materielles Wesen und ihre Wünsche mit der verfügbaren Seite der Welt übereinstimmten, auf Freude verzichten könnten. Langsam jedoch begriff ich, dass es eher umgekehrt war, dass sie diese Welt, die so solide erschien, ständig aktualisieren mussten, damit sie nicht wie eine Rauchwolke in der Abenddämmerung verschwand.“ (Der Vorfahre, S. 156)
In Cicatrices wird die Welt, in der man lebt, als etwas Selbstverständliches angenommen, aber das bedeutet nicht, dass sie jederzeit in eine Krise geraten kann. Die Gorilas bringen „Unwetter“ mit sich, aber im Gegensatz zur Handlung im Roman Der Vorfahre gibt es im Cicatrices keinen Ausweg für diejenigen, die darunter leiden. Daher erzeugt das Chaos unter den Gorilas nur Melancholie und seelische Unruhe und nicht zuletzt intime Perversionen.
Saer erweitert die Grenzen der Literatur, indem er, wie bereits erwähnt, den anthropologischen Hintergrund hervorhebt, der die „große“ Literatur stützt. Die Sinnlosigkeit erscheint in Saers Erzählung im Spannungsfeld mit der Kultur als Ganzes – und nicht als abstrakte und nihilistische Grenze. Damit erinnert Saer daran, dass die „wahre“ Grenze der Erzählung nicht das Nichts beziehungsweise die Stille sei, wie manche behaupten. Dort, wo die Literatur nicht hinreicht, da greift der Mythos. Der Roman El limonero real (etwa „Der echte Zitronenbaum“) kann wohl als eine literarische Erkundung dieses Gebiets verstanden werden. Hier weiß man beispielsweise nicht, wo die Erzählung beginnt und wo der Mythos endet – was der Roman wohl zu ein Remake Homers Odyssee macht.
Die Härte der Realität, dargestellt dort durch den Verlust eines Sohnes, löst sich von ihrer realen Grundlage, während die Erzählung das Ereignis zu dem Fundament macht, auf dem die Welt errichtet ist. Wenceslao, der Protagonist, macht sich, wie Odysseus, auf den Weg auf die andere Seite des Flusses, um mit seinen Verwandten Silvester zu feiern; während seine Frau, die in Trauer versunken ist, zu Hause bleibt und schwarze Streifen an die Hemden ihres Mannes näht. Diese eher banale, fast anekdotische Tatsache ist doch entscheidend, um uns später die Ereignisse dieses Tages zu offenbaren. In einem Auf und Ab gewinnt die Erzählung an Dichte und vereinfacht sich gleichzeitig, bis sie zu einem Mythos wird. Dort gibt Saer seine ehrlichste Antwort darauf, wie Literatur auf die Sinnlosigkeit der Realität reagieren kann, indem sie sie durch Fiktion bereichert. Doch wer die Lösung des Dilemmas wissen möchte, muss das Buch lesen.
Schreiben, umschreiben und wieder umschreiben
Der italienische Kritiker Francesco De Sanctis sagte mal, dass derjenige, der die Realität nicht im Außen suchen kann, gezwungen sei, sie im Inneren zu suchen. In diesem Sinne gab Saer niemals auf, über die Realität mit den Mitteln der Subjektivität nachzudenken. Auf den ersten Blick erscheint diese Geste nicht nur avantgardistisch, sondern auch unmöglich. Doch Saer tat dies mit der Geschicklichkeit eines Menschen, der seine eigenen Ressourcen beherrscht: eine Erzählweise à la Proust, à la Joyce, angewandt auf völlig neue Themen (u. a. ein Grillfest, die Erinnerung an ein Geburtstagsessen, die Fahrt zweier Bauern, die Wassermelonen auf dem Markt verkaufen wollen, eine Gruppe Verrückter auf dem Weg in die Irrenanstalt, die Perspektive eines marginalisierten Jugendlichen, der von Indianern entführt wurde). Scheinbar wohl unbedeutende Themen, die jedoch mit der kaltblütigen Präzision eines Metzgers aufgegriffen werden.
Saer erneuerte die Technik des Umschreibens. Durch Wiederholung (immer gleich und immer anders) gelang es ihm, die komplexe „Stratigraphie“ sichtbar zu machen, die sich im Schreiben des Schreibenden niederschlägt. Man schreibt über das Geschriebene, genauso wie man über das bereits Erlebte lebt – und dabei erreicht man etwas Neues. Es ist so, als würde Saer uns sagen: Macht Euch keine Sorgen, auch wenn alles erzählt wurde, bleibt immer noch die Pflicht, alles erneut zu erzählen. Gegen die mächtigen Zwänge des Marktes und dessen bedauerliche Art, Unterschiede zu vereinheitlichen, versteht Saer die Wiederholung als etwas organisches, das sich nicht reduzieren lässt.
Damals war das Fernsehen noch der Gegenspieler der Literatur, so wie es heute das Internet ist. Zwei „kannibalische“ Gegebenheiten, die „gezähmt“ werden müssen. Saers Lehre könnte lauten: die „Autonomie“ der Literatur zu stärken, um das zu retten, was in einer zunehmend verarmten und fressenden Realität noch menschlich ist. Wo es scheinbar keine Geschichte gibt, bietet die Literatur einen Ort des Widerstands, um die Orientierung nicht zu verlieren. In dieser Hinsicht teilt Saer die Ansicht seines chilenischen Kollegen Roberto Bolaño: Beide schreiben um, weil sie im Grunde genommen beide Dichter sind, die Verse „mästen“. Wenn die Literatur erschöpft oder ausgelaugt erscheint, speist sie sich aus der unerschöpflichen Quelle der Poesie. Das scheinen beide im Schatten von Borges zu sagen – allerdings tut Saer dies auf eine andere Art und Weise.
Als Bolaño sich beispielsweise mit der Gaucho-Literatur auseinandersetzte, schuf er bekanntlich einen „unerträglichen Gaucho“[i] (im Gegensatz zu Piglias Erzählung „Der unsichtbare Gaucho“[ii]), der in etwa so ist, als würde sich ein Programmierer aus Chicago als Cowboy verkleiden und ins Landesinnere von Wyoming ziehen. Somit betont der Chilene die Absurdität der romantischen Fantasien der städtischen Kreise, die die argentinische Pampa weiterhin so betrachten, als lebten dort noch die Gauchos wie im 19. Jahrhundert. Saer thematisiert diese historische Zäsur nicht, denn seine Figuren tragen sie in sich. In Saers Werk bewahrt sich das Landleben eine relative Autonomie gegenüber der Stadt: Die Charaktere können in Lehmhütten leben und das Städtische wohl als fremd oder neuartig empfinden. Das mindert jedoch nicht im Geringsten die Komplexität und Einheit ihres Lebens. Seine Art, über das ländliche Milieu zu erzählen, unterscheidet sich deutlich von derjenigen der Autor:innen, die das Umland stets aus der Perspektive der Metropole beschreiben.
Saer beschreibt das ländliche Argentinien – und zwar aus der Perspektive des ländlichen Raums, woraus er stammt. Seine Figuren werden nicht aus der Stadt betrachtet, sondern werfen selbst einen Blick auf die Stadt. Der Schriftsteller scheint uns mit einem leichten Lächeln im Gesicht sagen zu wollen: „Das Leben ist nichts anderes.“ Erst dann kam Bolaño und meinte, dass es dort weder Leben noch Literatur noch Poesie gebe, sondern dass es die Voraussetzung dafür sei, dass so etwas wie Leben, Literatur und Poesie existiert. Doch es war Saer, der diesen „Rückzieher” einleitete, um die Realität mit den Mitteln der Fiktion zu „retten“. Selbst wenn wir, als Bewohner:innen der vom Neoliberalismus verursachten Ruinen, diese Aufgabe schwer zu bewältigen haben, bedeutet das nicht, dass sie sich nicht bewältigen lassen könnte: Andere vor uns konnten es.
Nun scheint es, als gäbe es weder draußen noch drinnen eine Realität. Jeder Roman über das „Draußen“ läuft Gefahr, zu einem Krimi oder Science-Fiction-Roman zu werden. Gleichzeitig laufen die Romane über das „Drinnen“ nicht selten Gefahr, zu Tagebüchern eines kitschigen, trägen und langweiligen Ichs zu werden. Anscheinend bewegt sich die Literatur zwischen diesen beiden Grenzen: Krimi und Autofiktion. Saer sendet uns eine Botschaft aus der Ewigkeit: man muss das Terrain doch zurückerobern. In diesem Kampf zeigt er uns, weder literarisches Mittel noch Form noch Thema noch Stil seien zu verachten. Der Schlüssel liegt darin, sich stets vor Augen zu halten, dass „andere es früher doch konnten” und es nun darum geht, es wieder zu können. Das könnte die Aussage sein, die uns dieser 20. Todestag vermittelt. Wer Juan José Saer noch nicht gelesen hat, kann sich freuen. Der Verlag, der sein Œuvre noch nicht vollständig auf Deutsch auflegte, ebenfalls. Denn vor ihnen liegt eine Welt, die auf die Welt zugeschnitten ist. Eine Welt, die es durchaus wert ist, entdeckt zu werden.
Literatur:
Bolaño, Roberto: El gaucho insufrible, Santiago de Chile 2003. Dt. Der unerträgliche Gaucho, München 2006
Borges, Jorge Luis: Historia universal de la infamia [1935]. Dt. Der Schwarze Spiegel, München 1961; Universalgeschichte der Niedertracht und andere Prosastücke, Berlin 1972
De Martino, Ernesto: La fine del mondo: Contributo all’analisi delle apocalissi culturali. Turin 2019
Di Benedetto, Antonio: El Silenciero. Buenos Aires 1964. Dt. Stille, Berlin 1968
Piglia, Ricardo: La ciudad ausente, Buenos Aires 1992. Dt. Die abwesende Stadt, Köln 1994
Piglia, Ricardo: Cuentos Morales. Buenos Aires 1997
Piglia, Ricardo: Las tres vanguardias: Saer, Puig, Walsh. Buenos Aires 2019
Revista Crisis: El patetismo de la novela – Diálogo entre Juan José Saer y Jorge Luis Borges. Crisis, Ausgabe 63 (1988), S. 46-49
Saer, Juan José: Unidad de lugar. Buenos Aires 1967
Saer, Juan José: Cicatrices [1969]. Barcelona 2022
Saer, Juan José: El limonero real [1974]. Barcelona 2018
Saer, Juan José: La mayor. Barcelona 1976
Saer, Juan José: El entenado [1983]. Barcelona 2024. Dt. Der Vorfahre, München 1993; Der fremde Zeuge, Berlin 2011
Saer, Juan José: La ocasión [1987]. Barcelona 2019. Dt. Die Gelegenheit, München 1992
Saer, Juan José: El río sin orillas [1991]. Barcelona 2020
Saer, Juan José: La pesquisa [1994] Barcelona 2024. Dt. Ermittlungen, Köln 2005
Saer, Juan José: El concepto de ficción [1997]. Barcelona 2016
Sarlo, Beatriz: Zona Saer. Santiago de Chile 2016
Bildquellen: [1: Saers Geburtshaus; 2: Serodino; 3: Saers Geburtshaus]_Quetzal-Redaktion, soleb
Übersetzung aus dem Spanischen: Gonzalo Compañy
[i] Im Erzählungsband Der unerträgliche Gaucho
[ii] Im Erzählungsband Die abwesende Stadt