Rassist rettet rassisch Verfolgte. Es war die Dominikanische Republik, deren Hauptstadt Santo Domingo zu jener Zeit bereits Ciudad Trujillo hieß, in der die Jüdin Hilde Löwenstein, verheiratete Palm (1909 – 2006), Zuflucht vor dem deutschen Nazi-Regime erhielt und zur Dichterin wurde …. zu Hilde Domin, der Meisterin der Lyrik mit freien Rhythmen. Von Literaturkritikern wird sie in eine Reihe mit den bedeutendsten deutschsprachigen Autorinnen wie Annette von Droste-Hülshoff, Else Lasker-Schüler oder Ingeborg Bachmann gestellt. Domins Gedichte sind in 26 Sprachen übersetzt. Marcel Reich-Ranicki (2006) attestierte diesen Gedichten „eine Vorliebe für die knappe und prägnante, die schmucklose und weitgehend auf Metaphern verzichtende Sprache mit gedanklicher Klarheit“. Rafael Leónidas Trujillo Molina (1891 – 1961) hingegen, ihr – wie sie ihn später nannte – „furchterregender Retter“ (Domin, zitiert in Vogel 2009), ist unter die „sultanistisch“ regierenden und besonders bestialischen Diktatoren des lateinamerikanischen Subkontinents einzuordnen, zu denen auch ein Fulgencio Batista (der nach dem Sieg der kubanischen Revolution auch in das Land Trujillos floh), ein „Papa Doc” Duvalier im Nachbarland Haiti oder ein Anastasio Somoza Debayle in Nikaragua gehören. Domin war eine vom Nazi-Regime verfolgte Jüdin sozialdemokratischer Überzeugung, Trujillo – General,  brutaler Rassist und Bewunderer Adolf Hitlers, mithin des Deutschen, vor dem Hilde Domin fliehen musste. Doch – auch das trifft zu – Trujillo hat, nachdem er in seinem Land in einem Massaker mehr als 18.000 Haitianer hatte niedermetzeln lassen, ihr Leben und das hunderter anderer Juden gerettet, sodass Hilde, da schon verheiratete Palm, auf seiner Insel (korrekter gesagt, auf dem dominikanischen Teil der Insel Hispaniola) „landen“ durfte, um fürderhin gar den Namen dieses Inselstaates anzunehmen:
brutaler Rassist und Bewunderer Adolf Hitlers, mithin des Deutschen, vor dem Hilde Domin fliehen musste. Doch – auch das trifft zu – Trujillo hat, nachdem er in seinem Land in einem Massaker mehr als 18.000 Haitianer hatte niedermetzeln lassen, ihr Leben und das hunderter anderer Juden gerettet, sodass Hilde, da schon verheiratete Palm, auf seiner Insel (korrekter gesagt, auf dem dominikanischen Teil der Insel Hispaniola) „landen“ durfte, um fürderhin gar den Namen dieses Inselstaates anzunehmen:
Landen dürfen
Ich nannte mich
ich selber rief mich
mit dem Namen einer Insel.
Es ist der Name eines Sonntags
einer geträumten Insel.
Kolumbus erfand die Insel
an einem Weihnachtssonntag.
Sie war eine Küste
etwas zum Landen
man kann sie betreten
die Nachtigallen singen an Weihnachten dort.
Nennen Sie sich, sagte einer,
als ich in Europa an Land ging,
mit dem Namen Ihrer Insel.
Hilde Löwenstein
Am 27. Juli 1909, des Kaisersohns Oskar 21. Geburtstag, wurde Eugen Siegfried und Paula Löwenstein in Köln die Tochter Hilde Dina geboren. Die Trauurkunde der Eltern besagt, dass sie sich zur „israelitischen Religion“ bekannten. Für Hilde aber sollte, über ihr gesamtes Leben hinweg, „das „Jude-Sein“ (…) – keine Glaubensgemeinschaft und keine Volkszugehörigkeit, vielmehr eine Schicksalsgemeinschaft“ bedeuten (Reich-Ranicki 2006): „Ich habe sie nicht gewählt wie andere Gemeinschaften. Ich bin hineingestoßen worden, ungefragt wie in das Leben selbst.“ (Domin, zitiert ebd.) Auch jüdische Dichterin wollte sie nicht sein (Dillmann 2009), und sie wurde es auch nicht. Und doch sollte sie sich in ebendieser jüdischen „Schicksalsgemeinschaft“ wiederfinden.
Großbürgerlich-vermögend war der elterliche Haushalt: der Vater Jurist und Redakteur, die Mutter … gebildet, selbstbewusst, fast wäre sie Sängerin geworden. Hilde selbst sah sich als „ein in der Schule gefürchtetes Kind“, weil sie „immer schon alles gelesen hatte“ (Domin, zitiert in Tauschwitz 2010, 34). Wie der Vater so wählte auch Hilde die Jurisprudenz als Studienfach, der sie sich in Heidelberg an der Ruprecht-Karls-Universität verschrieb. Dort lehrten vor allem liberal-demokratische Professoren, wie zum Beispiel der Sozialdemokrat Gustav Radbuch. Später wechselte sie an die Philosophische Fakultät, wo sie Volkswirtschaft studierte. Hier waren u.a. Karl Mannheim und Karl Jaspers ihre Lehrer. Sie liebte Tanzabende, auf denen der spätere Professor der Literaturwissenschaft Hans Mayer einer ihrer Partner war, genauso wie die Kaffeehaus-Diskussionen innerhalb einer sozialdemokratischen Studentengruppe. 1930 wurde sie Mitglied der SPD, ein Mitglied, das später mit den Grünen sympathisiert haben soll. Einer Freundschaft (oder doch Liebe?) wegen wechselte sie von der Heidelberger Universität an die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität (heute Humboldt), um schließlich wieder nach Heidelberg zurückzukehren, wo sie zur Volkswirtin diplomierte. Noch in Berlin las sie und hörte – mit Furcht statt Begeisterung, wusste sie doch, dass er tun würde, was er sagte und schrieb – Hitler, als dieser auf einer Wahlkampfveranstaltung vor studentischem Publikum sprach.
Hilde Palm
In derselben Zeit trat Erwin Walter Palm in ihr Leben, ein charismatisch-exzentrischer Intellektueller voller „mystischer Schönheit“ (Tauschwitz 2010, 55 f.), Jude wie sie, aber weitaus konservativer, aus einer jüdisch-orthodoxen Familie stammend. Er war ihr großes Glück … ihr großes Unglück auch. Angesichts des wachsenden Einflusses der Nationalsozialisten in Deutschland, als Hitler bereits als NSDAP-Kandidat für den Reichstag nominiert war, floh das Paar, wiewohl getrennt, nach Florenz in Italien. Von 1932 bis 1939 blieb es und heiratete dort. Während Hilde in Florenz Nationalökonomie studierte und sich mit den Rechtsauffassungen eines Vorläufers von Machiavelli beschäftigte, wollte Erwin, der Archäologe, ein Werk über das antike Rom verfassen. Hilde schloss ihr Studium mit bestem Resultat ab, Erwin hingegen … In Hilde sah er gewiss auch seine Geliebte und Frau, doch ebenso, vielleicht gar vor allem, seine Sekretärin. Dass in Italien in dieser Zeit mit Mussolini ein ähnlicher Faschist regierte wie in Deutschland, wiewohl mit einem etwas weniger brutalen Image, schienen beide ausgeblendet zu haben. Trujillo sollte also nicht der erste Diktator sein, auf den Hilde im Exil traf. Ob sie selbst je diese Parallele gesehen hat? Erst als, 1938, auch dieser Mussolini rasse-gesetzlich alle Juden zu Staatsfeinden erklärt und ausgewiesen hatte, flüchtete das Paar am 12. März 1939, jetzt auch aus Italien. Ihr nunmehriger Fluchtweg ging über Paris, dann England und von dort aus in die Dominikanische Republik. Schriftstellerin war Hilde Palm, die in Italien den Familiennamen ihres Mannes angenommen hatte, zu diesem Zeitpunkt noch nicht, und auch Domin hieß sie da noch nicht. Ersteres „passierte“ ihr erst nach sechs weiteren Jahren … in jenem Inselstaat, der sich Dominikanische Republik nannte, letzteres, noch viel später, dann schon wieder in Deutschland.
Rafael Leónidas Trujillo Molina
Knapp zwanzig Jahre vor Hildes Geburt, in der Dominikanischen Republik, erblickte Rafael Leónidas Trujillo Molina am 24. Oktober 1881 das Licht der Welt. Im Unterschied zu Hilde stammte er aus einfacher Familie, einer Familie mit haitianischen, spanischen, französischen und dominikanischen Vorfahren. Die haitianischen pflegte er mit weißem Pulver im Gesicht zu übertünchen, die spanischen verdrehte er bis zum Nachfahren eines spanischen Offiziers und die französischen gar zu denen eines Marquis‘. Von Bildung hielt er wenig, umso mehr von den Abenteuern der Kleinkriminalität. Sein erstes rechtmäßiges Salär verdiente er als Telegrafist und Wachmann, um schließlich, 1918, als die USA das Land besetzt hielten, in die von deren Marines trainierte Nationalgarde einzutreten. Auch bei ihm, Trujillo, funktionierte die Armee, wie so oft in dieser Zeit in Lateinamerika bei Angehörigen unterer Mittelschichten, als Karriere-Sprungbrett: Rafael stieg blitzartig in ihr auf, bis zum Brigadegeneral.
Als schließlich Präsident Horácio Vásquez seine Wiederwahl anstrebte, surfte Trujillo, seines Zeichens bereits Polizeichef, auf einer anschwellenden Protestwelle von unten, die ihn schließlich (statt Vásquez) als neuen Präsidenten nach oben spülen sollte. Davor aber lag noch eine Interimszeit, in der Rebellenführer Juan Rafael Estrella Ureña als Präsident amtierte. Erst in den danach anberaumten Neuwahlen sollte dann – gemäß dem vorherigen Deal mit Estrella – für Trujillo tatsächlich die Zeit uneingeschränkter Machtausübung kommen. 99 % der Wählerschaft hatten für ihn als neuen Präsidenten gestimmt. Im August 1930 als Präsident inauguriert, behielt er, der „Vater des neuen Vaterlandes“ – Generalíssimo der Streitkräfte war er natürlich auch – über 31 Jahre hinweg die Macht. Damit gilt er als dienstältester lateinamerikanischer Diktator, auch wenn er sich formell zwischendurch, jeweils kürzere Zeit, von seinen Marionetten Jacinto Bienvenido Peynado (1938-1940), Manuel de Jesus Troncoso de la Concha (1940-1942) und Bruder Héctor Bienvenido Trujillo Molina (1952-1960) vertreten ließ. Im Hintergrund aber blieb stets er der eigentliche Machthaber.
Trujillo regierte im besten Einvernehmen mit den USA, zuerst mit ihrer good neighbor policy unter F. D. Roosevelt und dann mit der für D. D. Eisenhower charakteristischen antikommunistischen Doktrin. Seine politische Macht nutzte er, dieser Meister der Selbstbereicherung, nur allzu gern zu seinem ökonomischen Vorteil: Staatsgelder ließ er auf eigene Konten überweisen und entwickelte sich so, in oligarchischer Manier, zum zweit- oder drittreichsten Mann der Welt. Seine Gewinne schöpfte er aus Viehzucht, Zucker-, Rum- und Tabakindustrie sowie Salzhandel. Niemand von den einschlägigen Analysten bezweifelt, dass Trujillos Regime eine Diktatur war, nur bei der Spezifizierung tun sich zwischen ihnen Nuancen auf, die von „Bonapartismus“ über „Totalitarismus“ bis zu „sultanistischem Autoritarismus“ reichen. Für jede der Begrifflichkeiten spricht etwas.
Für letzteren Begriff mag anekdotisch stehen, dass Rafael Trujillo mehr als 10.000 Krawatten, 2.000 Uniformen und 500 Paar Schuhe (Werz o. J., 457) besessen haben soll. Einer seiner Spitznamen lautete „chapita“ (Verkleinerungsform von Blech), weil er doch Blech in Form von Orden an der Uniform so sehr liebte. Nie verließ er das Haus ohne Geldkoffer. Sein anderer Spitzname war „chivo“ (Ziegenbock), denn er pflegte ein überaus reges Sexualleben mit einer Vielzahl von, insbesondere jüngeren, Frauen, auch mit denen politischer Würdenträger, nicht selten mittels Gewalt und Druck gegenüber deren Familien. 40 legitime und illegitime Kinder soll er dabei gezeugt haben. Sein Personenkult kannte keine Grenzen: Die Hauptstadt Santo Domingo benannte er in Ciudad Trujillo um, selbst Gullydeckel trugen seinen Namen, auf Leuchtreklamen wurde er in einem Atemzug mit Gott genannt, und sein Größenwahn ließ seine Bewunderer nicht nur rund 2.000 Denkmäler zu seinen Ehren errichten, sondern ihn gar für den Friedens-Nobelpreis vorschlagen. Die dominikanische Bevölkerung schätzte, zumindest weitgehend, die politische Stabilität unter seiner Herrschaft, nicht umsonst galt er als „brillanter, mitleidsloser und skrupelloser Planer“ (Baud 2013, 80) und einer der besten Manager. So wundert es auch wenig, wenn ihn, bis auf die Studentenschaft und wohlhabendere Mittelschicht, das Volk als seinen „Beschützer“, „Wohltäter“ und „guten Diktator“ betrachtete. Dass er dabei jegliche liberalen Freiheiten zertrat, dem Land ein Ein-Parteien-System aufzwang, war für die Bevölkerung anscheinend so zweitrangig wie die Tatsache, dass er Hitler verehrte, sich in SS-Uniform ablichten ließ und den Schnurrbart trug wie der von ihm Verehrte. Das „Trujillato“ gilt als eine der brutalsten und blutigsten Präsidentenzeiten Lateinamerikas: Trujillo ließ politische Gegner reihenweise ermorden: Gelungene, versuchte (z.B. an Venezuelas Präsident Rómulo Betancourt, einem seiner stärksten Kritiker) oder erträumte (am Papst) Mordanschläge waren gewissermaßen sein Markenzeichen, und er ließ die Polizei, vor allem aber den Geheimdienst (einer von dessen Chefs war als „dominikanischer Himmler“ berüchtigt) in ihrer brutalen Willkür schalten und walten.
Es war das Masacre del Perejil im Oktober 1937, das in seiner Brutalität selbst vor dem skizzierten Hintergrund noch herausstach: In diesem Blutbad hat Trujillo innerhalb von 12 Tagen etwa 18.000 haitianische Gastarbeiter (von 53.000 in der Dominikanischen Republik lebenden) mit Macheten niedermetzeln lassen, auf den Zuckerrohrplantagen in der Grenzregion zu Haiti, in der Region um Dajabón. Doch es wäre zu einfach, das Massaker allein aus Trujillos rassistischer Überheblichkeit gegenüber allen „Schwarzen“ oder einer historisch gewachsenen Haiti-Feindschaft zu erklären, zumal diese von der einfachen Bevölkerung, zumindest damals, gar nicht geteilt wurde. Vielmehr hatten sich partnerschaftliche Netzwerke zwischen den in der Grenzregion lebenden Dominikanern und Haitianern und sogar gemeinsame communities herausgebildet, die dem Diktator ein Dorn im Auge waren. Mit seinem Massaker wollte Trujillo in erster Linie seine Zentralherrschaft über seine lokalen Amtsträger wiederherstellen, die diese Netzwerke unterstützt oder toleriert hatten (Hintzen 2016). Besser gesagt: Um der Subordination der Dominikaner willen sah er sich „genötigt“, die Haitianer auszulöschen. Zwar erreichte diese „ethnische Säuberung“ nicht die Ausmaße des Holocausts an den Juden, doch Gemeinsamkeiten gibt es genug.
Erst J. F. Kennedy, seinerseits ab Januar 1961 im Präsidentenamt, entzog nach diversen diplomatischen Versuchen, die Trujillos zum Rücktritt zu bewegen, selbigen die Unterstützung der USA, befürchtete er doch, die kubanische Revolution könnte sich in den autoritären Regimen Lateinamerikas wiederholen, gerade in der Dominikanischen Republik. Immerhin gehörte ja einmal ein Fidel Castro, bevor er zu Kubas Máximo Lider avancierte, zu jener Karibischen Legion, die Rafael Trujillo stürzen wollte. In der Nacht zum 31. Mai 1961 kam dann, gewissermaßen „folgerichtig“, der „Vater des neuen Vaterlandes“ Rafael Leónidas Trujillo bei einem von den USA bzw. dem CIA, mit Waffen, unterstützten Überfall ums Leben. Sieben Attentäter brauchte es dazu. Im November 1961 zwang Kennedy die restliche Trujillo-Familie, das Land zu verlassen. Da war Hilde Domin schon wieder in Deutschland, in ihrem geliebten Heidelberg.
Dass dieser rassistische Diktator die als Jüdin verfolgte Hilde Domin genau vor dem Schicksal des Genozids – in Deutschland – rettete, das er den Haitianern im eigenen Land zugefügt hatte, nennt Christoph Gunkel (2010) zu Recht einen „Treppenwitz der Geschichte“. Und dass die Mustersiedlung Sosúa (Provinz La Plata im Norden der Republik), die unter Trujillo zum zentralen Zufluchtsort für 757 von Deutschen vertriebene Juden wurde, heute insonderheit Deutschen pauschaltouristisches Mekka ist, verdient dieselbe Wertung.
Warum Trujillo den Juden Exil anbot
Als sich im Juli 1938 im französischen Badeort Évian-les-Bains die Vertreter von 32 Staaten trafen, um zu beraten, welche Staaten die jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich aufnehmen könnten, wartete man vergeblich auf eine positive Antwort. Auch Lateinamerika, darunter die früher durchaus aufnahmefreudigen Staaten Brasilien und Argentinien, verweigerte sich … mit einer Ausnahme: der Dominikanischen Republik. Trujillo bot auf diesem Treffen zunächst 10.000 und dann sogar 100.000 Juden Asyl an, Zahlen, die er allerdings auch nicht annäherungsweise erreichte. Am Ende sollten es, aus Deutschland, Österreich, Ungarn und Finnland, lediglich 757 in Sosúa und darüber hinaus nur wenige mehr gewesen sein. Nein, keinen hehren Gedanken leiteten ihn dazu an, vielmehr wollte Trujillo damit dreierlei zu Wege bringen: zum ersten sein Land, durch eine „Kreuzung mit weißen Siedlern“ „aufweißen“, zum zweiten neue Arbeitskräfte für die Landwirtschaft gewinnen, umso mehr da es die ersten Immigranten inzwischen vorgezogen hatten, nach Mexiko weiterzuwandern, und zum dritten seine außenpolitische Isolation aufzubrechen, insbesondere gegenüber den USA, wo sich sein Image angesichts seines Massakers an den Haitianern stark verschlechtert hatte. Der zu dieser Zeit amtierende US-Präsident F. D. Roosevelt soll von dem Vorschlag begeistert gewesen sein, allein schon deshalb, weil er damit die Grenzen seines eigenen Landes für Juden weiterhin geschlossen halten und dazu noch einen verärgerten Trujillo zufriedenstellen konnte. Verärgert war Trujillo deshalb, da Roosevelt ihm nicht erlaubt hatte, jene 30.000 nicht-jüdischen Deutschen „einzuführen“, die er als Arbeitskräfte-Ersatz für die ermordeten Haitianer viel lieber gehabt hätte. Das Agreement zwischen Roosevelt und Trujillo wurde von politischen Gegnern unter „New Deal“ eingeordnet und als „Jew Deal“ apostrophiert. Vier Jahre später, am 11. Dezember 1941, schloss sich die Dominikanische Republik, ausgerechnet unter Hitler-Verehrer Trujillo (!), der Kriegserklärung der USA gegen Nazi-Deutschland an.
Dass es in der Dominikanischen Republik am Ende nur wenig mehr als 757, statt der avisierten 100.000, jüdische Flüchtlinge wurden, lag jedoch weniger an Trujillo, sondern an DORSA, der finanziell von den USA vollkommen abhängigen Dominican Republic Settlement Association, die mehr Flüchtlinge nicht finanzieren wollte. Was jedoch DORSA Trujillo zugesagt hatte, war, dass es gesunde, starke, arbeitssame, intelligente Juden der „weißen Rasse“ mit guten Manieren sein würden, die in sein Land kommen (Binazzi/Daniel 2021, 25). Die 105 qkm Land um Sosúa indessen, wo diese Juden in erster Linie siedeln sollten, stellte Trujillo zur Verfügung. Dort waren die jüdischen Immigranten verpflichtet, in Mustersiedlungen, sog. „karibischen Kibbuzim“, landwirtschaftlich tätig zu werden, ohne dass dies ihre Präferenz gewesen wäre, denn es waren ja keine Bauern, sondern Ärzte, Pianisten oder Schriftsteller. Anders als Hilde Palm mussten sie das hinnehmen. Hilde dagegen, die weder finanzielle Unterstützung von den USA noch Ackerland von Trujillo benötigte, war so frei, nicht nach Sosúa zu müssen, wollte es auch nicht, nicht einmal besuchsweise. Sie wählte für den Anfang die Hauptstadt als Bleibe.
Wie Hilde Palm in Trujillos Diktatur zur Dichterin wurde
Die Entscheidung, als Asylland die Dominikanische Republik auszusuchen, war keine wirkliche Wahl des Ehepaares Palm. Denn als es diese 1940 in London traf, gab es schon kein Visum mehr nach Argentinien, Brasilien oder auch Mexiko, von den USA ganz zu schweigen. Allein die Dominikanische Republik, die weder Papiere noch Vermögen voraussetzte, war noch ein „Ort, wo man hinfahren könnte, der Ort der nicht präjudiziert ist, (…) an dem keine Erfahrung, keine Enttäuschung haftet, erlebt oder antizipiert. Und somit der Ort, wo man hinfahren kann, wenn der Aufbruch heißt: ‚Weg von hier‘.“ (Domin, zitiert in Tauschwitz 2010, 137). Die Offiziere der britischen Ausreisebehörde wussten nichts von diesem Land und verwechselten es schon einmal mit der Insel Dominica.
So reiste dann die 31-jährige Hilde Palm, zusammen mit ihrem Ehemann, am 4. August 1940 aus England, über Kanada und Jamaica kommend, in die Dominikanische Republik ein. Sie waren die einzigen Passagiere an Bord eines Wasserflugzeuges. Es erwarteten sie: ein Tropenguss und Lautsprecheransagen mit Trujillos Befehlen. Einen Koffer und ein italienisch-spanisches Wörterbuch hatten sie dabei, „leichtes Gepäck“ also:
Mit leichtem Gepäck
Gewöhn dich nicht.
Du darfst dich nicht gewöhnen.
Eine Rose ist eine Rose.
Aber ein Heim
ist kein Heim.
Sag dem Schoßhund Gegenstand ab
der dich anwedelt
aus dem Schaufenstern.
Er irrt. Du
riechst nicht nach Bleiben.
 Nein, das Land roch nicht „nach Bleiben“, es geriet dem Ehepaar Palm vielmehr zum „Isolationskäfig“. Dennoch sollte es Hilde nicht nur zwölf Jahre lang Zuflucht bieten, sondern sie auch zur Dichterin machen. Zunächst aber trat sie an, ihrem Ehemann „seinen Platz zu sichern im stillen Zeltplatz inmitten des Zyklons“ (Domin, zitiert in Tauschwitz 2010, 156), erfüllte also ihre Pflichten als treusorgende Ehefrau, Sekretärin (mangels Kohlepapier mussten auch Kopien abgetippt werden), Übersetzerin, alles für ihn, ihren Mann, acht Stunden täglich, solange das Licht reichte, während jener an der Universität von Santo Domingo seiner Leidenschaft für Archäologie und Architektur frönte. Das Ehepaar lebte, zumindest anfangs, in ärmlichen Verhältnissen, zuerst in Santo Domingo, dann, dies nur wenig üppiger, in Jarabacoa. Auch dort wischte Hilde den Boden mit Sand, töpferte Teegeschirre und verlegte bei Bedarf sogar elektrische Leitungen, damit der Erwin kein „Chaos, das er so hasst“ erleben musste. In ruhigeren Zeiten übersetzte sie Rilkes Gedichte ins Spanische und die Rafael Albertis ins Deutsche, und Deutsch-Unterricht gab sie auch. Und natürlich sind auch die Fotos in Erwins zwei Bänden über Santo Domingos koloniale Architektur ihr Werk.
Nein, das Land roch nicht „nach Bleiben“, es geriet dem Ehepaar Palm vielmehr zum „Isolationskäfig“. Dennoch sollte es Hilde nicht nur zwölf Jahre lang Zuflucht bieten, sondern sie auch zur Dichterin machen. Zunächst aber trat sie an, ihrem Ehemann „seinen Platz zu sichern im stillen Zeltplatz inmitten des Zyklons“ (Domin, zitiert in Tauschwitz 2010, 156), erfüllte also ihre Pflichten als treusorgende Ehefrau, Sekretärin (mangels Kohlepapier mussten auch Kopien abgetippt werden), Übersetzerin, alles für ihn, ihren Mann, acht Stunden täglich, solange das Licht reichte, während jener an der Universität von Santo Domingo seiner Leidenschaft für Archäologie und Architektur frönte. Das Ehepaar lebte, zumindest anfangs, in ärmlichen Verhältnissen, zuerst in Santo Domingo, dann, dies nur wenig üppiger, in Jarabacoa. Auch dort wischte Hilde den Boden mit Sand, töpferte Teegeschirre und verlegte bei Bedarf sogar elektrische Leitungen, damit der Erwin kein „Chaos, das er so hasst“ erleben musste. In ruhigeren Zeiten übersetzte sie Rilkes Gedichte ins Spanische und die Rafael Albertis ins Deutsche, und Deutsch-Unterricht gab sie auch. Und natürlich sind auch die Fotos in Erwins zwei Bänden über Santo Domingos koloniale Architektur ihr Werk.
Ihr Kind, das ihr hier geboren werden wollte, denn Hilde war auf der Überfahrt schwanger geworden, hielt der Ehemann für unliebsame Konkurrenz, sodass sie es abtrieb. 1952 verlor sie dann auch noch ihr zweites Kind, „weil er so wütend war“ (Domin, zitiert in Tauschwitz 2010, 242). Die traumatische Erinnerung daran blieb ihr Zeit ihres Lebens, und wenn sie später schrieb „meine Kinder sind meine Gedichte“ (Domin, zitiert in Reichwein 2020), klingt das „leichtfüßiger“ als von ihr gefühlt. Schlimmer noch, auch die Gedichte, der Kinder-Ersatz also, lösten bei Erwin Widerwillen und Neid statt Wertschätzung aus, denselben Widerwillen wie es Kinder getan hätten. Er, der zu einer solchen lyrischen Qualität wie sie seiner Frau gegeben war, nicht fähig war, bezeichnete es ihr gegenüber als „leicht“ (Gedichte) „zu schreiben“. Wenn (s)eine Frau Gedichte verfasste, empfand er das als „unrein“, denn „die Dichtkunst sollte Männerdomäne bleiben“ (Tauschwitz 2010, 221).
Nun bleibt noch die Frage, wie Hilde Domin den Präsidenten ihres Exillandes gesehen hat. Genau berechnet, lebte sie in diesem Land zwar die längste Zeit unter Rafael Leónidas Trujillo Molinas persönlicher Präsidentschaft, aber nicht schon zu Beginn ihres Aufenthalts und auch nicht zu dessen Ende, weil da Trujillos Marionetten bzw. Bruder amtierten. Hilde war eine politisch gebildete Frau mit sozialdemokratischen Positionen und er, Trujillo, ein repressiver Diktator. Nicht weniger paradox war: Dank dem Zuspruch der USA für Trujillos „Judenrettung“ fand sie in der Dominikanischen Republik Zuflucht. Dank dessen Bewunderung für Hitler wiederum, war sie dort als Deutsche, selbst dann noch, als sich Trujillo der Kriegserklärung der USA gegenüber Deutschland angeschlossen hatte, wohlgelitten. Nur musste sie, wie schon zuvor in dem Land, aus dem sie geflüchtet war, auch hier, im Exil, mit Kritik vorsichtig sein, denn weder sie noch ihr Mann durften das Aufenthaltsrecht aufs Spiel setzen, zumal sie schon bei ihrer Einreise genötigt worden waren, sich jeglicher politischer Betätigung zu enthalten. Nachdem sie erlebt hatte, wie ihre Freunde zu Staatsfeinden erklärt und ihre Berufsgenossen getötet wurden, bemerkte sie, dass Trujillos Sicherheitsdienste auch sie beobachteten. Ihre Lehrtätigkeit an der Universität war da ohnehin schon ausgesetzt. Schlussendlich ist sie sogar vom Diktator persönlich zur Vorsprache geladen worden. Kein Wunder also, dass sie Trujillo als ihren „furchterregenden Retter“ betrachtete. Kein Wunder auch, dass sie Angst hatte in diesem Land, ja ihrem „Inselkäfig“ die „Pestilenz“ (Tauschwitz 2010, 201) wünschte. Vor allem aber fühlte sie sich auf dieser Insel … fremd:
Inselmittag
Wir sind Fremde
von Insel
zu Insel.
Aber am Mittag, wenn uns das Meer
bis ins Bett steigt
und die Vergangenheit wie Kielwasser
an unseren Versen abläuft
und das das tote Meerkraut am Strand
zu goldenen Bäumen wird,
dann hält uns kein Netz
der Erinnerung mehr,
wir gleiten hinaus,
und die abgesteckten
Meerstraßen der Fischer
und die Tiefenkarten
gelten nicht
für uns.
Marcel Reich-Ranicki ignorierte dieses Gefühl von Fremdheit und Angst, wenn er erklärte: „Die Jüdin Hilde Domin hatte das Glück, die Zeit des Dritten Reiches geradezu in einem Paradies zu verbringen.“ (Reich-Ranicki 2006) Von seiner Position aus – bekanntermaßen war er in Warschaus jüdischem Ghetto interniert – mag das so gewesen sein.
Als dann der 2. Weltkrieg 1945 vorbei war und Deutschlands Nazi-Regime desgleichen, regte sich bei Hilde Palm nach all diesen „Jahren der Lethargie“ der Wunsch, endlich, endlich ihrem „Inselkäfig“ zu entfliehen. 1947 gelang es ihr, bereits besuchsweise in New York und die Stadt in vollen Zügen genießend, für sich und Erwin die Einbürgerungspapiere in den USA zu erhalten. Allein, letzterer hatte wieder einmal Angst vor der Verantwortung … dieses Mal davor, sich in einem Land, wo er nicht etabliert war, ökonomisch durchsetzen zu müssen. Am Ende war es erneut Hilde, die sich sorgte und nun für ihren Mann die Bewerbungen für die USA schrieb. Er selbst zog es vor, innerhalb Lateinamerikas herumzureisen … und … fremdzugehen. Doch Hilde verzieh ihm auch das … immer wieder. Gerade als die finanzielle Lage für beide prekär zu werden drohte, weil Erwins Dozententätigkeit in Santo Domingo nicht entfristet wurde, erhielt Erwin den Bescheid, dass er, 1952, ein Guggenheim-Fellowship für New York erhalten würde. Ein Jahr vor Abreise aus der Dominikanischen Republik in die USA schrieb Hilde, mit bereits reichlich vierzig Jahren, ihre erste Lyrik.
Hilde Domin
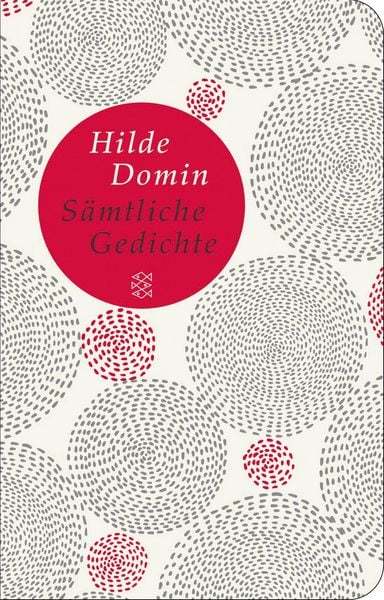 In den USA sollte das Ehepaar Palm zwei Jahre bleiben, um schließlich im Februar 1954 nach Deutschland zurück zu reisen. In demselben Jahr nahm Hilde den Namen Domin an. Es war ihr Herausgeber Wolfgang Weyrauch, der ihr zu dieser Namensänderung geraten hatte. Wieder in ihrem Geburtsland, schrieb Hilde: „Die Rückkehr, nicht die Verfolgung war das große Ereignis in meinem Leben“, woraufhin sie Hans-Georg Gadamer (1982) als „Poetin der Rückkehr“ bezeichnete. Und doch fühlte sie sich in Deutschland nicht als Deutsche, sondern auch hier fremd, als „die Ausländerin, die dessen Sprache spricht.“ Reich-Ranicki meinte, dass sie nur wegen der deutschen Sprache nach Deutschland zurückgekehrt sei. Das aber ist nur schwer zu glauben oder nur dann, wenn man, wie der Sprecher, die Dominikanische Republik unter Trujillo gleichzeitig als „Paradies“ einschätzt.
In den USA sollte das Ehepaar Palm zwei Jahre bleiben, um schließlich im Februar 1954 nach Deutschland zurück zu reisen. In demselben Jahr nahm Hilde den Namen Domin an. Es war ihr Herausgeber Wolfgang Weyrauch, der ihr zu dieser Namensänderung geraten hatte. Wieder in ihrem Geburtsland, schrieb Hilde: „Die Rückkehr, nicht die Verfolgung war das große Ereignis in meinem Leben“, woraufhin sie Hans-Georg Gadamer (1982) als „Poetin der Rückkehr“ bezeichnete. Und doch fühlte sie sich in Deutschland nicht als Deutsche, sondern auch hier fremd, als „die Ausländerin, die dessen Sprache spricht.“ Reich-Ranicki meinte, dass sie nur wegen der deutschen Sprache nach Deutschland zurückgekehrt sei. Das aber ist nur schwer zu glauben oder nur dann, wenn man, wie der Sprecher, die Dominikanische Republik unter Trujillo gleichzeitig als „Paradies“ einschätzt.
War sie, der Flüchtling, also mit gar zwei Vaterländern gesegnet oder aber gänzlich „vaterlandslos“? Oder beides: weil ersteres der Fall war, galt auch letzteres?
Vaterländer
Soviel Vaterländer wie der Mensch hat
vaterlandslos
heimatlos
jede neue Vertreibung
ein neues Land macht die Arme auf
mehr oder weniger
die Arme der Paßkontrolle
und dann die Menschen
immer sind welche da
die Arme öffnen
eine Gymnastik
in diesem Jahrhundert
der Füße der Arme
unordentlicher Gebrauch unserer Glieder
irgend etwas ist immer da
das sich zu lieben lohnt
irgend etwas ist nie da
Alle diese Länder haben Grenzen
gegen Nachbarländer.
Vielleicht aber ist es auch so: Ihr Leben beschrieb Hilde Domin ja als „Sprachodyssee“, als „Wandern von einer Sprache in die andere“. In all diesem „Wandern“ erwies sich für sie einzig ihr – in Lyrik gegossenes – Wort als beständig und damit als ihr eigentliches Vaterland. Wohl nicht zufällig sagen die Juden, sie hätten kein Vaterland denn das Wort. Bereits seit tausenden Jahren auf der Flucht, hatten die Juden immer nur das Wort, nur die Verschriftlichung, um Gott auf ihren mühsamen Wegen bei sich zu haben, anders als die Völker um sie herum, die, auch bei Migration, die jeweiligen lokalen Gottheiten verehrten. So also wurde Gott zum Wort und beides zum Vaterland. Nur er, „Gott im Wort“, „behauste“ die Juden. Auch der Hilde Domin, obwohl keine gläubige Jüdin, war allein das Wort verlässliche „Stütze“ und … Vaterland. In ihrem berühmtesten Gedicht fand sie dafür, im Bewusstsein von deren tiefer Bodenverwurzelung, ihr eigenes, spezifisches Wort in der … Rose:
Nur eine Rose als Stütze
Ich richte mir ein Zimmer ein in der Luft
unter den Akrobaten und Vögeln:
mein Bett auf dem Trapez des Gefühls
wie ein Nest im Wind
auf der äußersten Spitze des Zweigs.
Ich kaufe mir eine Decke aus der zartesten Wolle
der sanftgescheitelten Schafe die
im Mondlicht
wie schimmernde Wolken
über die feste Erde ziehen.
Ich schließe die Augen und hülle mich ein
in das Vlies der verläßlichen Tiere.
Ich will den Sand unter den kleinen Hufen spüren
und das Klicken des Riegels hören,
der die Stalltür am Abend schließt.
Aber ich liege in Vogelfedern, hoch ins Leere gewiegt.
Mir schwindelt. Ich schlafe nicht ein.
Meine Hand
greift nach einem Halt und findet
nur eine Rose als Stütze.
Hilde Domin weilte letztmalig zwanzig Jahre vor ihrem Tod in der Dominikanischen Republik. Kurz vor ihrem Ableben hatte dieser Staat noch die Dichterin mit seinem höchsten Orden „Del mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Comendador“ ausgezeichnet.
Hilde Domin starb …, nein, „vereiste“ ein letztes Mal … am 22. Februar 2006.
Mein Herze wir sind verreist
Mein Herze
wir sind verreist
nach verschiedenen Weltteilen
Eurydike
meine Hand
deine Schulter berührend.
Ich schreibe mit deinem Stift
Ich möchte eintreten
durch diese großen Trichter,
das Meer
in das Reich
in dem du gehst oder liegst
oder stehst
in dem du jetzt alles weißt
oder alles vergißt.
Ist dem schon zu Lebzeiten luxussüchtigen Rafael Trujillo in Madrid, auf dem Friedhof El Pardo, Parzelle 46 A, als (letzte) Grabstätte ein schwarz-marmornes Mausoleum zugedacht worden, bedeckt Hilde Domins Grab auf dem Heidelberger Bergfriedhof eine schlichte steinerne Platte, auf der es ihre eigenen Verse sind, die dort zu lesen stehen:
Wir setzten den Fuß in die Luft
und sie trug.
__________________________________________________________
Literatur:
Baud, Michiel (2013): Dominikanische Republik. In: Das Lateinamerika-Lexikon. Wuppertal, 77-83.
Binazzi, Alice/Daniel, C. Pricila (2002): La República Dominicana y los refugiados en Sosúa. Claroscuro de una historia existosa. In: Comparative Cultural Studies: European and Latin American Perspectives, No. 11, 19-27.
Domin, Hilde (2020): Sämtliche Gedichte. Frankfurt a. M. (im vorliegenden Text verwandte Gedichte wurden, in genau dieser Reihenfolge, von den Seiten 238, 101, 37, 192, 48 und 255 übernommen, und zwar im exakten Wortlaut und der von Hilde Domin verwendeten Orthographie).
Gadamer, Hans-Georg (1982): Hilde Domin, Dichterin der Rückkehr. In: Wangenheim, Bettina von: Heimkehr ins Wort. Materialien zu Hilde Domin. Frankfurt a.M., 28-34.
Gunkel, Christoph (2010): Exil in der Karibik. Letzte Rettung Paradies. In: Spiegel. Unter: https://www.spiegel.de/geschichte/exil-in-der-karibik-a-948627.html. Download 05.03.2023.
Hernández, Alberto (2022): El aliento verbal de Hilde Domin. Unter: https://letralia.com/ciudad-letralia/cronicas-del-olvido/2018/12/10/el-aliento-verbal-de-hilde-domin/ Download 05.03.2023.
Hintzen, Amelia (2016): A Veil of Legality’: The Contested History of Anti-Haitian Ideology under the Trujillo Dictatorship. In: NWIG: New West Indian Guide /Nieuwe West-Indische Gids, Vol. 90, No. 1/2, 28–54.
Reich-Ranicki, Marcel (2006): Hilde Domin: Außerhalb jeder Regel. In: F.A.Z., 24.02.2006, Nr. 47, S. 35. Unter: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/marcel-reich-ranicki-hilde-domin-ausserhalb-jeder-regel-1304881.html. Download 05.03.2023.
Reichwein, Marc (2020): Als Hilde Domin in der Karibik gestrandet war. Unter: https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article207071075/Actionszenen-der-Weltliteratur-Als-Hilde-Domin-in-der-Karibik-gestrandet-war. Download 05.03.2023.
Tauschwitz, Marion (2010): Hilde Domin. Dass ich sein kann, wie ich bin. Mainz.
Tauschwitz, Marion im Interview mit Dillmann, Hans-Ulrich (2009): Hilde Domin wollte Dichter, keine jüdische Dichterin sein. Unter: https://blogs.taz.de/latinorama/hilde_domin_wollte_dichter_keine_juedische_dichterin_sein/ Download 05.03.2023.
Vogel, Wolf Dieter (2009): Rettung in den Tropen. In: Taz. Unter: https://taz.de/Rettung-in-den-Tropen/!539883/ Download 05.03.2023.
Werz, Nikolaus (o.J.): Rafael Leónidas Trujillo. Unter: https://publications.iai.spk-berlin.de/servlets/MCRFileNodeServlet/Document_derivate_00000964/BIA_129_450_473.pdf 451 – 473. Download 05.03.2023.
Bildquellen: [1] pixabay_dgra; [2] Ursula Stock; [3] CoverScan







