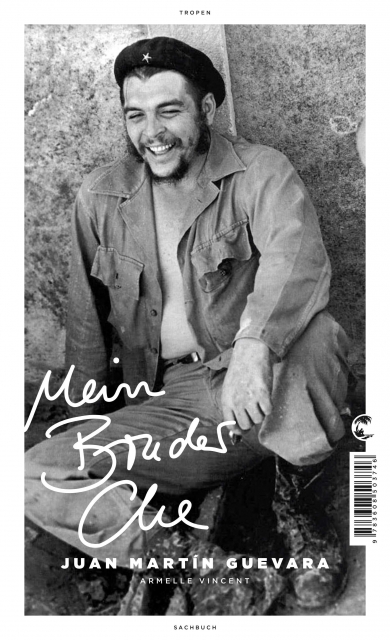Das Phänomen „linke Militärs“ besitzt eine doppelte Unschärfe, was seine genauere Untersuchung zu einem schwierigen Unterfangen werden lässt. Weder Adjektiv noch Substantiv sind in ihrer Anwendung genau umrissen. „Links“ zeigt zunächst nur eine politische Richtung an und setzt in seiner sinnvollen Verwendung die genaue Bestimmung des Ausgangspunkts voraus. Aber auch „Militär“ kann vom Soldaten bis zum General, vom Individuum oder von einer Gruppe von Uniformträgern bis zur Institution Armee reichen. Der hier unternommene Versuch, dem noch unscharfen Phänomen Konturen zu geben, kann bestenfalls eine grobe Skizze liefern, deren wenige Striche ergänzungs- und korrektur bedürftig bleiben.
Geht man beim Phänomen „linke Militärs“ vom historischen „Tatbestand“ aus, dann weist dieser in Lateinamerika in den letzten hundert Jahren vier Varianten auf. Das revolutionäre Aufbegehren radikalisierter Minderheiten von Soldaten und unterer Offiziersränge gegen die Institution Armee (Brasilien 1922-27, Chile 1931/32, Guatemala 1960, Dominikanische Republik 1965) stellt die erste Variante dar. Als zweite ist der Militärreformismus der 1960er und 1970er Jahre zu nennen. In Peru, Ekuador, Bolivien, Panama und Honduras setzten sich innerhalb der Institution Armee progressive Militärfraktionen durch, die mittels anti-oligarchischer und anti-imperialistischer Reformen mehr oder weniger konsequent versuchten, zu größerer nationaler Unabhängigkeit zu gelangen. Mit der kubanischen Revolution entstand ein dritter, revolutionärer Typus linker Militärs. Dieser hatte seine Wurzeln in der Guerilla, die die unter Führung von Fidel Castro 1959 die Batista-Diktatur stürzte. Auf ähnliche Weise entstand nach der Revolution in Nicaragua 1979 eine neue Armee. Die historisch jüngste Variante können wir in Venezuela beobachten. Dort entwickelte sich aus einem gescheiterten Putsch linker Militärs unter der Führung von Hugo Chávez eine breite anti-imperialistische Bewegung, die sich in der Tradition Simón Bolívars sieht und die die revolutionäre Umgestaltung des Landes auf ihre Fahnen geschrieben hat.
Trotz dieser enormen Spannbreite enthält das oben skizzierte „Angebot“ ausreichend Ansatzpunkte für eine erste Systematisierung.
So erhebt sich zunächst die Frage, warum es nur in bestimmten Ländern Lateinamerikas zu einem „Linksschwenk“ (von Teilen) der bislang rechts, d.h. auf die Sicherung und den Erhalt der traditionellen Ordnung ausgerichteten Armee gekommen ist. Die Mehrzahl blieb von linken Militärs verschont oder erlebte die „Linksputsche“ seiner „jungen Offiziere“ als kurzzeitiges Abenteuer ohne nachhaltige Resonanz.
Zweitens verlangen die deutlichen Unterschiede, die die verschiedenen Links-Varianten in Charakter, Konsequenz und Reichweite aufweisen, nach einer differenzierten Darstellung. Nur auf diesem Wege lässt sich zeigen, wie Chancen und Blockaden linker Aktion in der Armee und durch die Armee im konkreten Fall verteilt sind. Von besonderem Interesse ist dabei, wie die Armee als Institution auf linke Militärs inner- und außerhalb ihrer Reihen reagiert und bis zu welchem Punkt sie linke Politik zulässt.
Drittens werfen das Ende des Kalten Krieges und die Implosion der Sowjetunion das Problem auf, welchen Veränderungen „linke Armeen“ sowohl bei Erhalt (Kuba) als auch bei Verlust der revolutionären Macht (Nicaragua 1990) unterworfen sind. Inwiefern kann der revolutionäre Ursprung einer „linken Armee“ nach ihrer institutionellen Normalisierung (Standesinteressen, Professionalisierung) und nach einem Machtwechsel gewahrt werden?
Linke Militärs 1: Wie und Wann?
Ein Blick zurück zeigt, dass „linke Militärs“ – egal in welcher Variante – im kontinentalen Maßstab die Ausnahme waren und sind. Nur in zwei Fällen gelang die revolutionäre Neugründung der Armee aus linken, marxistisch orientierten Guerillaverbänden (Nicaragua, Kuba). In zwei anderen revolutionären Fällen (Mexiko 1910, Bolivien 1952) konnte die alte Armee zwar zerschlagen, eine in Geist und Funktion neue jedoch auf Dauer nicht durchgesetzt werden. Schnell „normalisierten“ sich die ursprünglich revolutionären Militärs, indem sie sich „territorialisierten“, d.h. in den Dienst zahlungsfähiger Latifundisten traten oder selbst welche wurden. Eine Ideologie, wie der auf soziale Gleichheit gerichtete Marxismus in Kuba und Nicaragua, die der persönlichen Bereicherung wenigstens Schranken setzte, existierte in Mexiko und Bolivien nicht. Noch gravierender gestaltet sich der Seitenwechsel der Armee von einer progressiven zu einer konterrevolutionären Institution im Falle der guatemaltekischen Revolution 1944-1954. Als führende Kraft beim Sturz der Diktatur genoss sie den Status eines „Wächters der Revolution“, verriet diese jedoch, als Söldner im Dienst der CIA 1954 in Guatemala einfielen. Besonders tragisch war das Schicksal des damals gestürzten Präsidenten Jacobo Arbenz. Selbst Militär, hatte er bei der Verteidigung der Revolution zu lange auf die Loyalität der Armee vertraut. 1960 begann in Guatemala ein Bürgerkrieg, in dem sich die Armee rasch als Hauptkraft einer blutigen Konterrevolution profilierte. Der 1996 beendete Konflikt kostete ca. 300.000 Menschen das Leben. Die genannten Fälle zeigen, dass linke Minderheiten von Soldaten und Offizieren, die im Kampf gegen die rechts verharrende Institution Armee standen, sich in der Regel geschlagen geben mussten, ohne ihre Vorstellungen durchsetzen zu können.
Dort, wo „linke Militärs“ innerhalb der Institution Armee und über sie im jeweiligen Land politisch wirksam werden konnten, blieben sie in der Minderheit, was ihnen als Linke zeitlich wie inhaltlich enge Grenzen setzte. So konnten sich reformorientierte Offiziere in Peru (unter Velasco Alvarado 1968-1975), Honduras (unter López Arellano 1972-1975), Panama (unter Torrijos 1968-1978), Ekuador (unter Rodríguez Lara 1972-1975) und Bolivien (unter Torres 1970/71) zwar innerhalb der Armee durchsetzen, wurden aber schon nach wenigen Jahren von ihren rechten Offizierskollegen gestürzt oder/ und rückten von selbst wieder nach rechts, indem sie vom eigenen Reformprogramm Abstand nahmen.
 Dennoch markieren die 1960er Jahre eine deutliche Zäsur in der politischen Ausrichtung der Institution Armee in den genannten Ländern, die von kontinentaler Bedeutung war und mit ähnlichen Entwicklungen im afroasiatischen Raum (seit den 1950er Jahren) korrespondierte. Erstmals übernahm 1968 in Peru die Armee als Institution die Regierung, um ein Reformprogramm durchzusetzen, das auch die kühnsten Erwartungen der zeitgenössischen Linken in den Schatten stellte. Die direkte Konfrontation mit nordamerikanischen Multis (Besetzung der Raffinerie der International Petroleum Company am 9. 10. 1968) bis hin zur Nationalisierung sowie die nach Mexiko und Kuba radikalste Agrarreform (Gesetz vom 24. 6. 1969) auf dem Subkontinent waren die Markenzeichen des peruanischen Militärreformismus.
Dennoch markieren die 1960er Jahre eine deutliche Zäsur in der politischen Ausrichtung der Institution Armee in den genannten Ländern, die von kontinentaler Bedeutung war und mit ähnlichen Entwicklungen im afroasiatischen Raum (seit den 1950er Jahren) korrespondierte. Erstmals übernahm 1968 in Peru die Armee als Institution die Regierung, um ein Reformprogramm durchzusetzen, das auch die kühnsten Erwartungen der zeitgenössischen Linken in den Schatten stellte. Die direkte Konfrontation mit nordamerikanischen Multis (Besetzung der Raffinerie der International Petroleum Company am 9. 10. 1968) bis hin zur Nationalisierung sowie die nach Mexiko und Kuba radikalste Agrarreform (Gesetz vom 24. 6. 1969) auf dem Subkontinent waren die Markenzeichen des peruanischen Militärreformismus.
In Honduras (Agrarreform 1975) und Panama (neuer Kanalvertrag mit den USA 1977) blieben die antioligarchischen Reformen und antiimperialistischen Nationalisierungen in der Summe deutlich hinter dem peruanischen Schrittmaß zurück, während in Bolivien faschistoide Militärs unter General Banzer die Reformmilitärs schon nach kurzer Zeit stürzten.
In der an jähen Wendungen und Überraschungen gewiss nicht armen Geschichte der latein-amerikanischen Armeen stellte der peruanische Militärreformismus ein Novum dar. Neu war zum ersten, dass nicht ein Caudillo an der Spitze der Bewegung stand, wie das noch beim Militärpopulismus der 1950er Jahre (Perón in Argentinien) der Fall war, sondern die Armee als Institution politisch intervenierte. Und zwar zweitens mit dem erklärten Ziel, die bestehende Ordnung so umzuwandeln, dass echte soziale Gerechtigkeit und eine rasche nationale Entwicklung möglich werden konnten.
Zuvor waren solch radikale Maßnahmen, die zum Programm fast aller linken Gruppen Lateinamerikas gehörten, nur durch den Bruch mit der Institution Armee und im Kampf gegen sie zu haben. Die Tenentes in Brasilien versuchten zwischen 1922 und 1927 über isolierte Militäraufstände den Sturz der Regierungen Pessoa und Bernardes zu erwingen, um auf diesem Wege Reformen durchzusetzen. Der Marsch der Kolonne Prestes 1924-1927 ging als Höhe- und Schlusspunkt der revolutionären Militärbewegung Brasiliens in die Geschichte ein.
In Chile folgte 1932 auf den gescheiterten Matrosenaufstand von 1931 die Ausrufung der „Sozialistischen Republik“ durch radikalisierte Militärs (Junta unter Grove und Davila), denen es jedoch an Organisation und Programm mangelte. Die spontan entstandenen Arbeiter- und Soldatenräte blieben führerlos und ein Putsch rechter Militärs ebnete schon wenig später den Weg zur Rückkehr der oligarchischen Republik.
Während sich die revolutionären Militärs der 1920er und 1930er Jahre im Unterschied zu den Militärreformisten der 1960er Jahre zwar mit Aufständen gegen die Institution Armee gewandt hatten, aber ihrer Herkunft und ihrem Selbstverständnis nach Armeeangehörige blieben, war in Kuba (1959) und Nicaragua (1979) die vollständige Zerschlagung der alten Armee Voraussetzung für die Durchsetzung der notwendigen Veränderungen, die hier zudem sehr schnell revolutionären – und nicht nur reformerischen – Charakter annahmen. An die Stelle der dem Diktator hörigen Prätorianergarde, die nicht einmal zu selbständigen, geschweige denn reformerischen Aktionen fähig war, trat eine revolutionäre Armee, die aus den siegreichen Partisanenverbänden hervorgegangen war. Der reaktionäre und servile Charakter der Armee in Batistas Kuba und Somozas Nicaragua schloss von vornherein jede linke Regung in ihren Reihen aus. Unzufriedene Elemente konnten schnell denunziert und „ausgemerzt“ werden.
Linke Militärs 2: Warum kommt es zum Militärreformismus?
Repräsentieren vollständige Reformabstinenz der Armee (Typ „Prätorianergarde“) oder linke Aufstandsversuche radikalisierter Minderheiten von Soldaten und Offizieren gegen ihre eigene Institution (Spaltung der Armee) in (vor)revolutionären Krisenzeiten noch lateinamerikanische Normalität, so bedarf das Phänomen des Militärreformismus einer gesonderten Erklärung. Erstmalig rückt die gesamte Institution – wenn auch nur zeitweilig und mit unterschiedlichem Engagement – vom traditionellen Selbstverständnis und der bisherigen Traditionslinie der lateinamerikanischen Militärs ab und vollzieht einen Linksschwenk. Zeitpunkt (Mitte 1960er bis Mitte 1970er Jahre) und Länderfälle (Peru, Honduras, Panama, Ekuador, Bolivien), deren vergleichende Untersuchung hinsichtlich des Militärreformismus bedauerlicherweise noch aussteht, können nur erste Anhaltspunkte für eine solche Erklärung liefern:
a) Auftauchen und Wirksamkeit des Militärreformismus fallen mit einer Umorientierung der US-amerikanischen Außenpolitik zusammen, der Kennedy nach dem Sieg der kubanischen Revolution mit der Verkündung seiner „Allianz für den Fortschritt“ den entsprechenden konzeptionellen und propagandistischen Rahmen zu geben versucht. Reformen werden nunmehr als Maßnahmen zur Revolutionsvermeidung akzeptiert, zeitweise sogar gefördert. Selbst die Nationalisierung nordamerikanischer Erdölmultis in Peru wird von der USA-Regierung, wenn auch mit Murren, hingenommen.
b) Im Innern sieht sich die traditionelle Ordnung durch breite Massenbewegungen herausgefordert, die sich weiter zu radikalisieren drohen. In den teilweise auch militärischen Auseinandersetzungen mit Bauern- (Peru, Honduras), Volks- (Bolivien, Ekuador, Panama) oder Guerillabewegung (Peru, Bolivien) kommt das Offizierskorps erstmals in engeren Kontakt mit der nationalen Realität und zu der Einsicht, dass die Probleme mit den herkömmlichen Mitteln nicht zu lösen sind, die zudem bei der Bekämpfung der genannten sozialen und politischen Bewegungen oftmals versagt hatten. Ein Programm von Strukturreformen, das unter der Regie führender Armeestrategen ausgearbeitet wurde (Peru: Plan „Inca“), soll dem Land einen Modernisierungsschub bringen und aus Unterentwicklung und Rückständigkeit befreien.
c) Strukturell handelt es sich bei den genannten Fällen um Länder, wo entweder die traditionelle Großgrundbesitzer-Oligarchie noch dominant ist und jeden Fortschritt blockiert (Peru, Ekuador) oder die Abhängigkeit von den USA aus geopolitischen (inter-ozeanischer Kanal in Panama) bzw. ökonomischen Gründen (Dominanz US-amerikanischer Bananenkonzerne) extrem groß ist. In allen genannten Fällen füllt der Militärreformismus ein Hegemonievakuum im anstehenden Modernisierungsprozess aus: Dort, wo eine traditionelle Oligarchie zwar noch dominant, aber im nationalen Interesse nicht mehr hegemoniefähig ist (Peru, Ekuador), gegen die Oligarchie; dort, wo aus historischen Gründen die Oligarchie fehlt (Honduras) oder extrem abhängig von den USA ist (Panama), als Hegemonie-Ersatz. In allen Fällen handelt es sich also um Länder, die entweder im Entwicklungsniveau (Peru, Ekuador, Bolivien, Honduras) unter dem lateinamerikanischen „Durchschnitt“ liegen oder extrem außenabhängig sind (Panama, Honduras), ohne dass dies von einer personalistischen Diktatur durch eine Prätorianerarmee wie in Kuba (vor 1959) oder Nikaragua (1934-1979) abgesichert werden konnte.
In allen drei Varianten – Abspaltung einer radikalisierten Minderheit von der Armee, Reformkurs der Institution Armee oder revolutionäre Neugründung – gelten jedoch folgende Gemeinsamkeiten: Nationalismus – wenn auch von unterschiedlicher Radikalität und mit differierender theoretischer Begründung – war letztlich das Hauptmotiv für die Linksentwicklung der „alten“ Militärs oder die linke Gründung einer neuen Armee nach der Zerschlagung der Prätorianergarde. In all diesen Fällen ging es entweder um das Aufholen eines überdurchschnittlich großen Entwicklungsrückstandes oder um die Beseitigung einer überdurchschnittlich hohen Abhängigkeit von den USA.
Linke Militärs 3: Wie weit?
Neben dem unterschiedlichen Verhältnis der „linken Militärs“ zur „alten“ Institution Armee (Abspaltung, Verbleib, Zerschlagung) liegen die Differenzen zwischen den drei Varianten hauptsächlich in Reichweite und Ergebnis ihrer linken Aktion.
Radikalisierte Minderheiten von Armeeangehörigen und ihr offenes Agieren zeitigten ambivalente Wirkungen. Einerseits stand ihr Radikalismus oft in umgekehrt proportionalem Verhältnis zu ihrem Einfluss in der Armee oder den mittel- und langfristigen Erfolgsaussichten ihrer Rebellion. Andererseits öffneten sie dort, wo sich bereits politischer Protest und Widerstand zu regen begann, Räume für deren Ausweitung und wirkten als Katalysator im gesellschaftlichen Gärungsprozess. Beispiele für letzteres sind der Militäraufstand vom 13. November 1960 in Guatemala und die Erhebung der Konstitutionalisten unter Führung von Oberst F. Caamaño am 24.4.1965 in der Dominikanischen Republik. In Guatemala leitete die Militäraktion, die in ihren unmittelbaren Zielstellungen (Sturz der Regierung Ydigoras) gescheitert war, den erst 1996 beendeten Bürgerkrieg ein. A. Yon Sosa und L. Turcios Lima, von den USA im Anti-Guerilla-Kampf ausgebildet und Anführer des November- Aufstandes von 1960, avancierten wenige Jahre später zu comandantes der guatemaltekischen Guerilla. Diese zählte in den 1960er Jahren zu den stärksten Partisanen-Bewegungen Lateinamerikas und brachte Anfang der 1980er Jahre das damals herrschende Militärregime an den Rand der Niederlage.
Die Rebellion fortschrittlicher Teile der Armee in der Dominikanischen Republik, die die 1963 gestürzte Regierung des demokratisch gewählten Präsidenten J. Bosch wiederherstellen wollten, führte direkt in den Volksaufstand vom April 1965. Die von den fortschrittlichen Militärs bewaffneten Volksmassen mussten durch die militärische Intervention der USA und ihrer Verbündeten gestoppt werden. Nur so konnte ein zweites Kuba verhindert werden. F. Caamaño, der Führer der April-Revolution von 1965, fiel 1973 als Guerillero im Kampf gegen die einstigen Waffengefährten in der Armee. Langfristig scheint – wie im guatemaltekischen Fall deutlich wird – die einmal erlebte Radikalisierung von Teilen der Armee und deren offene Rebellion zur Immunisierung der Streitkräfte gegenüber „linken Krankheiten“ zu führen. Es ist jedenfalls auffällig, dass überall dort, wo es zuvor eine Radikalisierung und Abspaltung gegeben hatte, selbst gemäßigte Reformer innerhalb der Institution Armee kaum wahrnehmbar waren. Zu einem ähnlichen Ergebnis führte der „verspätete Reformismus“ der „Jungen Offiziere“ vom Oktober 1979 in El Salvador.
Am „geronnenen“ Ergebnis gemessen, fällt die Bilanz des Militärreformismus positiver aus. Strukturelle Veränderungen der Besitzverhältnisse im Agrarsektor und Nationalisierung von US-Unternehmen weisen dies aus. Allerdings hatte die Bindung des Reformprogramms an die Institution Armee einen doppelten Preis. Zum einen war der Reichweite der angestrebten Reformen durch den vorausgesetzten Konsens aller relevanten Kräfte in der Armee ein enger Rahmen gesetzt, da sie im Interesse der Einheit der Armee seitens der Rechten, der Gemäßigten und der schweigenden Mehrheit zumindest Akzeptanz finden mussten. Im Zweifels- oder Streitfall stand auch für die Reformer die Wahrung der institutionellen Geschlossenheit höher als die hehren Reformabsichten. Korpsgeist siegte meist über den Reformeifer – auch wider besseres Wissen. Zweitens liegt „der Grundwiderspruch des militärischen Reformismus darin, Reformen anzustreben, die nur erfolgreich durchgeführt werden könnten, wenn sie von einer größeren sozialen Basis getragen würden, bei denen jedoch in der Tat jede spontane Teilnahme der Bevölkerung aus Angst, den Prozess nicht in der Hand zu behalten, beschnitten wird. Dieser ‚technokratische Paternalismus‘ degradiert die Arbeiter- und Bauernschichten zu bloßen Ausführern des Regierungsprogramms…“ (Sotelo 1975, S. 67). Am weitesten ging der Militärreformismus unter Alvarado 1968-1975 in Peru, wo die „Generäle als Revolutionäre“ (Eric Hobsbawm in: Bethell 2016, S. 317) agierten, was Eric Hobsbawm veranlasste, von einer „besonderen ‚Revolution‘“ (ebenda, S. 334) zu sprechen.
Revolutionär im wahrsten Sinne des Wortes gingen die Strukturveränderungen in Kuba und Nicaragua, wo die alte Institution Armee im Zuge einer Revolution „von unten“ zerschlagen wurde. Die Formierung der neuen Armee ist für das hier behandelte Thema vor allem unter folgenden Aspekten von Interesse: Inwiefern geht im Falle eines Verschleißkrieges gegen den revolutionären Staat und einer zeitweise drohenden Intervention der USA (Nicaragua 1981-1990) die Militarisierung der Revolution zu Lasten der sozialen Basis und gesellschaftlichen Umgestaltungen? Was bleibt vom revolutionären Ursprung der neuen Armee, wenn nach einem Machtwechsel (Nicaragua 1990) zu allererst das Überleben der Institution Armee unter einer rechten Regierung gesichert werden muss? Nicaragua liefert mit dem Machtwechsel von 1990 das bislang einzige Beispiel eines Transformationsprozesses einer „linken Armee“ unter einem „rechten Regime“. Abrücken von jeder Art politischen Engagements, Trennung der Verbindung Partei-Armee und Unterordnung unter die verfassungsmäßigen Instanzen waren die Bedingungen, die die Sandinistischen Streitkräfte seitens der Regierung Chamorro akzeptieren mussten. Die nicht geringe „materielle Abfederung“ durch eigene Unternehmen, Sonder- und Dienstleistungen versöhnte die Sandinisten in Uniform mit ihrer Umwandlung in ein Ejército Nacional (Nationales Heer). Die Kehrseite ist die Konfrontation mit Protestaktionen ehemaliger Kampfgenossen in- (Recompas) und außerhalb der eigenen Reihen (soziale Bewegungen) gegen die neoliberale Politik der Regierung und für die Einhaltung der Versprechungen zur Wiedereingliederung ehemaliger Soldaten und Contras. Zur dieser „Normalisierung“ der Sandinistischen Streitkräfte gab es nur eine Alternative, die jedoch von allen Beteiligten verneint wurde – Bürgerkrieg und Chaos. Für Daniel Ortega, der bereits 1994-1990 das Präsidentenamt innehatte, begann 2006 unter anderen, nicht-revolutionären Bedingungen eine weitere Amtszeit. Im Ergebnis der Wahlen von 2011, 2016 und 2021, die von (Teilen) der Opposition nicht anerkannt wurden, konnte er seine Macht konsolidieren. Wie die Sandinistische Armee der 1980er Jahre hat sich auch Daniel Ortega „derevolutioniert“. Der Fall Nicaragua wirf die Frage auf, ob unter dem doppelten Druck von neoliberaler Globalisierung und unipolarer Hegemonie der USA überhaupt noch linke Politik machbar und linke Militärs möglich war(en).
Linke Militärs 4: Wie weiter?
Dass linke Politik und linke Militärs in Lateinamerika auch nach 1990 erfolgreich sein konnten, belegen zwei bewaffnete Aktionen, die in ihrer Unterschiedlichkeit das breite Spektrum linker Vorstöße illustrieren. Zum einen fand am 4. Februar 1992 unter Führung von Hugo Chávez in Venezuela ein linker Militärputsch statt, der eine Entwicklung anstieß, die ab 2000 in eine Neugründung des Landes mündete. Andere Länder wie Brasilien (2003), Uruguay (2004), Bolivien (2006) und Ecuador (2007) vollzogen später im Ergebnis demokratischer Wahlen einen ähnlichen Linksschwenk. Zum anderen erhob sich im mexikanischen Bundesstaat Chiapas am 1. Januar 1994 die indigene Bevölkerung zu einem bewaffneten Aufstand. Unter Führung des EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) kam es im Ergebnis von Widerstandsaktionen, Verhandlungen, Massenmobilisierungen und neuen Erfahrungen der Selbstorganisation zu eine Autonomiebewegung, die sich trotz allen Drucks bis heute behaupten konnte.
Für unser Thema der linken Militärs bietet sich der venezolanische Fall aus mehreren Gründen an: Erstens hat die dortige Entwicklung ihren Ursprung in der Armee des Landes. Dies bezieht sich nicht nur auf den gescheiterten Militärputsch von 1992 als Initialzündung, sondern vor allem auf die Rolle seines Organisators und Anführers Hugo Chávez. Er ist ein markantes Beispiel für die Rolle charismatischer Persönlichkeiten im Geschichtsprozess. Es ist vor allem sein Verdienst, dass Venezuela als einziges Land der südamerikanischen „linken Welle“ einen Systemwechsel verfolgt hat.
Zweitens hat sich die Armee maßgeblich unter seinem Einfluss zu einer Institution entwickelt, die den militärischen Schutz des Landes gegen die massiven Angriffe der inneren und äußeren Konterrevolution garantiert. Die FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), so deren offizielle Bezeichnung, haben seit dem Putsch rechter Kräfte 2003 mehrfach weitere Versuche vereitelt, den Transformationsprozess zurückzurollen. Angesichts der geopolitischen Lage und ökonomischen Bedeutung Venezuelas für die USA ist diese Haltung nicht hoch genug zu bewerten. Gegenbeispiele in anderen lateinamerikanischen Ländern, in denen die Streitkräfte der Revolution in den Rücken fielen, unterstreichen dies.
Drittens lässt sich am Beispiel der FANB die innere Widersprüchlichkeit des Chavismo aufzeigen, die sich auch im Leben und Wirken von Hugo Chávez selbst zeigt. Auf der einen Seite repräsentiert er durch seine Karriere und Prägung das Militär, auf der anderen Seite ist er der Inspirator einer revolutionären Volksbewegung. Der Transformationsprozess in Venezuela, den man als eine Art „Reform-Revolution“ bezeichnen kann, wird von zwei unterschiedlichen Kräften getragen: vom Staat – insonderheit von der Armee – und von den marginalisierten Massen.
Das Kräfteverhältnis zwischen ihnen entscheidet maßgeblich über Stabilität, Dynamik und Richtung der Veränderungen in Venezuela, wobei die Armee aufgrund ihres sozialen und institutionellen Charakters letztere im Eigeninteresse zu kanalisieren sucht. Während Chávez aus dieser Konstellation noch eine offensive anti-imperialistische Politik generieren konnte, ist Venezuela nach seinen Tod 2013 in den Sog einer existentiellen Krise geraten. Die innere und äußere Konterrevolution zielt mit ihrer Strategie des Regimechange vor allem darauf, dass die Armee wie in Guatemala (1954), Bolivien (1964 und 2019) und Chile (1973) die Seiten wechselt. Dass dies bislang gescheitert ist, hat jedoch eine Kehrseite: Die „Bolivarische Revolution“ hat ihre ursprüngliche Dynamik verloren und die Volksbewegung sieht sich in die Rolle des Juniorpartners zurückgedrängt.
Dies ist auch ein wesentlicher Teil zur Erklärung der bitteren Bilanz, die Raul Zelik 2019 in seinem Beitrag über die linken Regierungen Südamerikas in der Wochenzeitung „der freitag“ (Nr. 47) zieht: „Das einzige Land, in dem die Linke wirklich einen Systemwechsel verfolgte, war Venezuela – leider ist die Bilanz desaströs. Fast alle der 180.000 Genossenschaften, die Mitte der 2000er Jahre auf Initiative von Präsident Chávez gegründet wurden, zerfielen nach wenigen Monaten wieder. Bei den 500 verstaatlichten Betrieben ist die Produktion weitgehend zusammen gebrochen, die öffentliche Infrastruktur ist trotz hoher Staatsausgaben so marode, dass die venezolanische Ölförderung heute nur noch ein Drittel des Ursprungsniveaus beträgt.“
Unter diesen Bedingungen stellt das Überleben des von Chávez begründeten Prozesses schon einen Erfolg dar. Externe Rückendeckung findet sein Nachfolger Nicolás Maduro vor allem in Russland und in China, die in Venezuela einen wichtigen Aktivposten im Ringen um eine multipolare Weltordnung sehen. Die jüngsten geopolitischen Umbrüche, die die USA in die Defensive gezwungen haben, eröffnen auch dem Chavismo neue Perspektiven. Ob und wie er diese zu nutzen weiß, wird die Zukunft zeigen.
* Bei diesem Beitrag handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines Artikels von 1996. Unter: quetzal-leipzig.de/printausgaben/ausgabe-15-16-linke-in-lateinamerika/linke-politik-in-uniform#
Literatur:
Amado, J.: Ritter der Hoffnung. Das Leben von Luis Carlos Prestes. Berlin 1956 (Brasilien)
Bethell, L. (Hrsg.): Viva la Revolución. Eric Hobsbawm on Latin America. London 2016 (allgemein)
Loveman, B./ Davies, T. (Hrsg.): The Politics of Antipolitics. The Military in Latin America. Lincoln & London 1978 (allgemein)
McClintock, C./ Lowenthal A. F. (Hrsg.): The Peruvian Experiment Reconsidered. Princeton 1983 (Peru)
Millett, R.: Guardians of the dynasty. A history of the US created Guardia Nacional de Nicaragua and the Somoza family. New York 1977 (Nicaragua)
Rouquie, A.: El Estado Militar en America Latina. Mexico D.F. 1984 (allgemein)
Saenz Padrón, R./ Rius Blein, H.: Caamano. La Habana 1964 (Dominikanische Republik)
Salomon, L.: Militarismo y Reformismo en Honduras. Tegucigalpa 1982 (Honduras)
Sotelo, I./ Eßer, K./ Moltmann, B.: Die bewaffneten Technokraten. Militär und Politik in Lateinamerika. Hannover 1975 (allgemein)
Verschiedene Autoren: Turcios Lima. La Habana 1969 (Guatemala)
Zelik, Raul: Sozialismus? Was sich aus linker Perspektive von Venezuela lernen lässt. Berlin 2019 (unter: www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Artikel/4-19_Online-Publ_Sozialismus.pdf)
Zu Venezuela und Hugo Chávez seien außerdem folgende Beiträge des QUETZAL empfohlen:
Hugo Chávez – Sozialist des 21. Jahrhunderts? (Teil 1) Herkunft und Aufstieg des Hugo Chávez – Vom utopischen Bolivarianer zum Gründungsvater der V. Republik
Hugo Chávez – Sozialist des 21. Jahrhunderts? (Teil 2) Transformation und Polarisierung – Hugo Chávez als bolivarischer Reform-Revolutionär
Hugo Chávez – Sozialist des 21. Jahrhunderts? (Teil 3) Kritik und Vermächtnis – Hugo Chávez als unvollendeter Sozialist
Hugo Chávez – Sozialist des 21. Jahrhunderts? (Teil 4) Kritik und Vermächtnis – Hugo Chávez als unvollendeter Sozialist
Venezuela unter Chávez. Revolution oder doch nur Populismus?