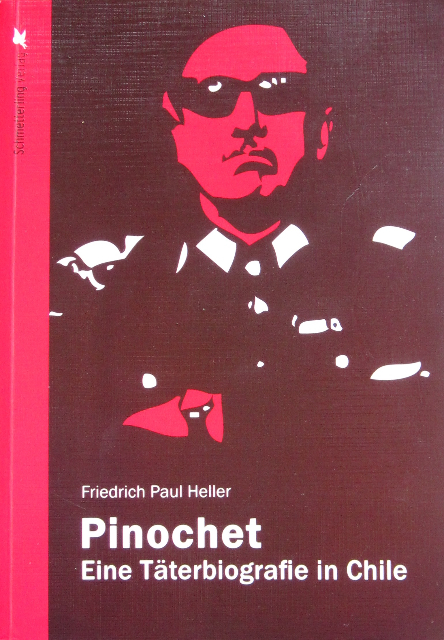Back to the roots oder warum QUETZAL ein Buch aus dem Jahr 1949 rezensiert
 Als es die Mapuche im Januar 2013 wieder einmal in die internationalen Medien geschafft hatten, lag das nicht an ihrem Gipfeltreffen und den Forderungen nach Selbstbestimmung, sondern daran, dass bei ihrem Kampf um Land ein aus Holland stammendes Ehepaar in den Flammen einer Hacienda in der Gemeinde Vilcún (640 Kilometer südlich von Santiago) ums Leben gekommen war. Die Mapuche – die Wilden, die Unzivilisierten, die Terroristen, die Unverbesserlichen; das war der Tenor der Presse. Ja, es wurde teilweise sogar gutgeheißen, dass sich aus dem sozialen Kampf der Mapuche ergebende Anklagen (z.B. wegen Landbesetzungen) unter das aus der Pinochet-Diktatur stammende Anti-Terror-Gesetz von 1984 fallen. Demnach werden Prozesse gegen angeklagte Mapuche (mithin Zivilisten!) vor Militärgerichten abgehalten – mit den damit verbundenen besonderen Regelungen wie längerer Untersuchungshaft, anonymen Belastungszeugen oder beschränkter Einsichtnahme von Ermittlungsakten durch die Anwälte der Verteidigung. Kurz: Die Mapuche gelten als Staatsfeinde und nicht als Bürger der Republik Chile.
Als es die Mapuche im Januar 2013 wieder einmal in die internationalen Medien geschafft hatten, lag das nicht an ihrem Gipfeltreffen und den Forderungen nach Selbstbestimmung, sondern daran, dass bei ihrem Kampf um Land ein aus Holland stammendes Ehepaar in den Flammen einer Hacienda in der Gemeinde Vilcún (640 Kilometer südlich von Santiago) ums Leben gekommen war. Die Mapuche – die Wilden, die Unzivilisierten, die Terroristen, die Unverbesserlichen; das war der Tenor der Presse. Ja, es wurde teilweise sogar gutgeheißen, dass sich aus dem sozialen Kampf der Mapuche ergebende Anklagen (z.B. wegen Landbesetzungen) unter das aus der Pinochet-Diktatur stammende Anti-Terror-Gesetz von 1984 fallen. Demnach werden Prozesse gegen angeklagte Mapuche (mithin Zivilisten!) vor Militärgerichten abgehalten – mit den damit verbundenen besonderen Regelungen wie längerer Untersuchungshaft, anonymen Belastungszeugen oder beschränkter Einsichtnahme von Ermittlungsakten durch die Anwälte der Verteidigung. Kurz: Die Mapuche gelten als Staatsfeinde und nicht als Bürger der Republik Chile.
Als die Indigenen im (südlichen) Winter 2010 eine große Kampagne gegen das Anti-Terror-Gesetz gestartet hatten und 35 Mapuche in Hungerstreik getreten waren, blieb das internationale Medienecho – im Gegensatz zum oben geschilderten Fall – gering. Sie verschwanden gänzlich von der medialen Bildfläche, als im August des gleichen Jahres 33 Bergleute in der Mine San José verschüttet wurden. Die Mapuche brachen den Hungerstreik ab – und überließen den heroischen Bergleuten und einem strahlenden Präsidenten Sebastian Piñera das Bild auf den Titelblättern und allen weiteren Seiten der Printmedien.
Die weitgehende Absenz der Mapuche in den Medien zeigt sich auch in der Literatur. Noch immer steht eine umfassende Aufarbeitung der Gräuel während der „Befriedung Araukaniens“, der Heimatregion der Mapuche, ab 1861 aus. Kaum ein Schriftsteller hat sich diesem Sujet gewidmet. Man muss schon zurückgehen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, um mit Luis Durand einen Autor zu finden, der das ländliche Leben im Grenzgebiet zu den Mapuche zu einem der zentralen Themen in seinen Büchern erhob. Er gilt daher als einer der wichtigsten Vertreter des chilenischen criollismo. Diese literarische Strömung ähnelt sehr der argentinischen Gaucholiteratur Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, bei der (oft mündlich überlieferte) Geschichten über Viehzüchter und Siedler in den Weiten der Pampa erzählt werden.
Durand schöpfte bei seinem Oeuvre sicherlich aus den Erfahrungen seiner Kindheit und Jugend. Er wurde 1895 in Traiguén geboren. Der Ort bildete bis zur endgültigen Unterwerfung der Mapuche 1883 die „Grenze der Zivilisation“ und liegt nicht weit von Vincún entfernt, an dem sich das Drama vom Januar 2013 ereignete. Er arbeitete unter anderem als Verwalter auf verschiedenen Haciendas in diesem Gebiet und konnte auf diese Weise viele Erzählungen zusammentragen. Widerhall fanden seine Werke – bezeichnenderweise – kaum. Bis heute gibt es keine einzige deutsche Ausgabe seiner Bücher. Und selbst in Chile muss man sich durch zahlreiche verstaubte Antiquariate wühlen, um fündig zu werden. So bleibt auch sein 1949 erschienener Roman „Frontera. Novela del Sur“ eine Rarität. Zugegeben: die Handlung ist wenig komplex und der Erzählstrang ausgesprochen geradlinig, wobei Nebenhandlungen mitunter einfach versanden. Doch Durand liefert in dem Buch ein authentisches Bild der damaligen Zeit. Und somit stellt es eine der wenigen Möglichkeiten dar, die Realität der Mapuche am Ende des 19. Jahrhunderts kennenzulernen.
Back in History oder Das Leben in Araukanien vor 130 Jahren
Vor dem Hintergrund der Biographie des Autors überrascht es nicht, dass „Frontera. Novela del Sur“ im Gebiet um Traiguén spielt, das erst 1878 als Fort gegründet wurde. Im Mittelpunkt steht Anselmo Mendoza y Romero, kurz Don Anselmo genannt. Möglicherweise diente dem Autor im wahren Leben Don Andrés Manríquez Oliva, der Bruder des ersten Bürgermeisters, Juan Manuel Manríquez, als Vorbild für diese Figur. Gerüchten zufolge könnte dies sogar der Vater des Schriftstellers gewesen sein, da nur die Identität seiner Mutter, Cruz Durán, feststeht.
Der Leser lernt Don Anselmo Mendoza y Romero als einen energischen jungen Mann kennen. Als Krämergehilfe arm begonnen und im Handel schnell reich geworden, verkauft er bald neben Alltagswaren auch Vieh (das er vorher billig von den meist betrunkenen Mapuche erstanden hatte), vermisst zu seinen Gunsten deren Ländereien neu oder tauscht deren Felder gar gegen Alkohol ein – und ist inzwischen ein mächtiger Großgrundbesitzer. Gleich am Anfang der Handlung steht für den Aufsteiger ein weiteres lukratives Geschäft in Aussicht. Er will Bartolo Catrileo das Land abkaufen – „beste Erde“, „eine Goldmine“ (S. 18). An Stelle der „faulen indios“ glaubt er, bald das Dreifache aus dem Boden herausholen zu können. Und der Notar des Dorfes, der tief bei Don Anselmo verschuldet ist (S. 20), wird ihn rechtzeitig informieren, falls andere Interessenten auf den Plan treten.
Dass der Landverkauf – wie gewöhnlich – dem Mapuche nicht zum Vorteil gereicht, ist offensichtlich. Auch Jacinto Cayul musste das früher schon erfahren. Er verlor an Don Anselmo sein bestes Stück Land, weil Papier geduldig ist und nur die Urkunde vor Gericht Bestand hat. Und da es für den Analphabeten nicht möglich war, im Dokument die Einhaltung seiner mündlichen Absprachen („den Hügel, nicht die Felder“) zu überprüfen, ging sein Besitz an den Großgrundbesitzer (S. 29).
 Das Leben in der noch weitgehend unerschlossenen Region ist hart. Es fehlt an Arbeitskräften, weshalb die Regierung mit großzügigen Versprechungen Ausländer (Engländer, Franzosen, Deutsche) anlockt. Und es sind – trotz der „Befriedung“ der Mapuche im „Parlament von Putue“ im Jahr 1882 – keine friedlichen Zeiten. Noch immer streifen Banden durchs Land, hunderte von Banditen (S. 235), rauben Vieh und Frauen. Don Anselmo führt daher stets Waffen mit sich – und eine Leibwache, deren Loyalität er dadurch erwarb, dass er sie vorher gegen klingende Münze aus dem Gefängnis befreit hatte.
Das Leben in der noch weitgehend unerschlossenen Region ist hart. Es fehlt an Arbeitskräften, weshalb die Regierung mit großzügigen Versprechungen Ausländer (Engländer, Franzosen, Deutsche) anlockt. Und es sind – trotz der „Befriedung“ der Mapuche im „Parlament von Putue“ im Jahr 1882 – keine friedlichen Zeiten. Noch immer streifen Banden durchs Land, hunderte von Banditen (S. 235), rauben Vieh und Frauen. Don Anselmo führt daher stets Waffen mit sich – und eine Leibwache, deren Loyalität er dadurch erwarb, dass er sie vorher gegen klingende Münze aus dem Gefängnis befreit hatte.
Neben dem Erwerb von Land für den Weizenanbau – die Frontera entwickelt sich schnell zur neuen Kornkammer Chiles – interessieren den Großgrundbesitzer vor allem schöne Frauen. Und so kommt es, wie es kommen musste; der „Mann, der gewohnt ist, alle zu beherrschen, mit denen er sich trifft“ (S. 122), verliebt sich in die schöne Isabel. Der „König des Grenzgebiets“ (S. 138) – Warum werden nur immer Leute, die auf dubiose Art zu Geld gekommen sind, so hofiert? –, der „starke Macho“ (S. 139) wird plötzlich sentimental. Er, der normalerweise nach jeder Eroberung jegliches Interesse an einer Frau, verheiratet oder nicht (S. 284), verliert, hat nun nur noch Augen für sie. Die Handlung plätschert nun in rosaroten Tönen vor sich hin, wobei der Leser wenig über die „Frontera“ und noch weniger über das Leben der Mapuche in dieser Zeit erfährt. Jedoch gibt es ein interessantes Detail am Rande, dass es nämlich ein Mapuche ist, der den lungenkranken Don Anselmo mit Kräutern und Elixieren heilt (S. 161 ff.). Und als nach einer Woche sein französischstämmiger Leibarzt eintrifft, bleibt ihm nur festzustellen: „Warum studieren wir so sehr in der Universität, wenn ein Mapuche alles genauso gut kann?“ (S. 179).
Back to the land tenure oder Alles dreht sich um den Boden
Trotzdem: Das chilenische Selbstverständnis jener Zeit dreht sich nicht um die Mapuche, sondern um deren ehemaligen Besitz, den Boden. Don Anselmo schwärmt, dass auf diesen Ländereien spottbillig zu Geld zu kommen sei. Man müsse sich nicht mal bücken, um es aufzusammeln. Allerdings bedürfe es (für den Moment) Entschlusskraft und festen Willens; die Eisenbahn erreiche jedoch bald Temuco, die Armee (!) baue nach der Befriedung der indios schon gute Straßen, selbst das Unkraut sprieße nicht mehr. Der Puls des Landes würde hier schlagen, und man müsse das Gebiet in die chilenischen Aktivitäten einbeziehen (S. 179-180). So kann nur ein Sieger reden. Und die Unterlegenen retten ihm das Leben. Offensichtlich prallen zwei Weltanschauungen aufeinander, die zu verstehen, dem Leser schwerfallen dürfte, wenn er nicht fundierte Kenntnisse über den Gegensatz zwischen der indigenen Kosmovision und der kapitalistischen Produktionsweise besitzt. Ja, nicht einmal der Autor scheint diese Verkettung beabsichtigt zu haben. Diese Gedanken entstehen lediglich durch das Lesen zwischen den Zeilen – unter den eingangs der Rezension geschilderten Prämissen.
Wenngleich: So kapitalistisch ist Don Anselmo gar nicht, eher halb-feudal. Denn seine Landarbeiter (es wird nicht weiter differenziert, ob Chilenen oder Mapuche) bekommen am Zahltag fast nie Bares in die Hand. Alles ist schon vorgestreckt für Kleidung, Waren oder Lebensmittel (S. 235). Der Grundbesitzer verdient dadurch nicht nur doppelt, sondern bindet die Arbeiter praktisch an seine Ländereien. Ein rentables Geschäft. Außerdem sind ihm die Landarbeiter auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, ja, er kann sie sogar mit dem Tode bedrohen, wenn sie seine Befehle nicht befolgen (S. 339).
Nach der Hochzeit, bei der Don Anselmo weniger Augen für seine Braut als für die nächste Eroberung hatte (S. 285), und nach dem ersten – wie wir heute sagen würden – Seitensprung, geschuldet der „Manneskraft“ des „Don Juans“ (S. 295), geschieht jedoch etwas Denkwürdiges: Sein Freund nimmt sich aus verschmähter Liebe das Leben. Tragisch. Aber der Grundbesitzer sieht sich bald wieder seinen wahren Problemen gegenüber: mehr und immer mehr Land erstehen, Mitbewerber ausstechen und die lokale Macht ausspielen, indem er die Subalternen mit Rum und Pesos besticht (S.324-325) oder indem er Kontrahenten gewaltsam aus dem Dorf schmeißt (S. 361ff.). Zu befürchten hat er nichts, da sein Beziehungsgeflecht inzwischen bis zum Präsidenten der Republik reicht (S. 348ff., v.a. S. 380).
Fünf Jahre später, der Präsident der Republik wandelt sich gerade zum Diktatur, Don Anselmo ist dreifacher Vater, und in der Grenzregion wüten neben der Cholera auch die Variola, fällt seine Ehefrau den Pocken zum Opfer. Die Impfstoffe erreichen die unerschlossene Gegend zu spät. Der Grundbesitzer will sich daraufhin in den Abgrund stürzen, ihr folgen, aber erneut rettet ihm ein Mapuche das Leben. Der Tod seiner Frau ändert das Leben von Don Anselmo. Er engagiert sich nun in der Politik, der Politik des Landes, nicht der Region wohlgemerkt, denn der Präsident der Republik, gegen den sich der Kongress und die Marine erhoben hatten, sei sein Freund (S. 415), den es zu verteidigen gelte. Oder geht es letztlich um die guten Geschäfte mit der Regierung und den riesigen Gewinnen (S. 429)?
 Sei es, wie es sei, im chilenischen Bürgerkrieg von 1891 von drei Kugeln und einem Bajonettstich verwundet, überlebt der Großgrundbesitzer die Schlacht von Placilla (Valparaíso), als einer der wenigen Parteigänger des gestürzten Präsidenten. Inkognito überführen ihn Freunde nach Santiago, wo zu seiner Rekonvaleszenz offenbar entscheidend der Sex mit seiner stillen Geliebten aus Zeiten der Hochzeit mit seiner verstorbenen Frau beiträgt (S. 424). Hier – wie im Folgenden – bleibt die Hauptfigur des Buches seinem Lebensstil treu: schöne Frauen, neue Ländereien, Erinnerung an die verstorbene Ehefrau, neue Ländereien, schöne Frauen. Unterbrochen wird dieses zügellose Leben nur durch ein Attentat auf ihn. Doch Don Anselmo kann in Notwehr beide Widersacher erschießen. Trotzdem findet er sich plötzlich vor Gericht wieder. Der Richter ist kein Geringerer als der vormals verjagte Großgrundbesitzer, inzwischen von der neuen Regierung in dieses Amt berufen. Obwohl er gern seinen Todfeind lebenslang hinter Gitter gewusst hätte, bleibt ihm nichts anderes übrig, als ihn freizusprechen. Die Beweislage (und die anwaltliche Unterstützung) lassen kein anderes Urteil zu, und der Richter verschwindet für immer aus dem „Grenzgebiet“.
Sei es, wie es sei, im chilenischen Bürgerkrieg von 1891 von drei Kugeln und einem Bajonettstich verwundet, überlebt der Großgrundbesitzer die Schlacht von Placilla (Valparaíso), als einer der wenigen Parteigänger des gestürzten Präsidenten. Inkognito überführen ihn Freunde nach Santiago, wo zu seiner Rekonvaleszenz offenbar entscheidend der Sex mit seiner stillen Geliebten aus Zeiten der Hochzeit mit seiner verstorbenen Frau beiträgt (S. 424). Hier – wie im Folgenden – bleibt die Hauptfigur des Buches seinem Lebensstil treu: schöne Frauen, neue Ländereien, Erinnerung an die verstorbene Ehefrau, neue Ländereien, schöne Frauen. Unterbrochen wird dieses zügellose Leben nur durch ein Attentat auf ihn. Doch Don Anselmo kann in Notwehr beide Widersacher erschießen. Trotzdem findet er sich plötzlich vor Gericht wieder. Der Richter ist kein Geringerer als der vormals verjagte Großgrundbesitzer, inzwischen von der neuen Regierung in dieses Amt berufen. Obwohl er gern seinen Todfeind lebenslang hinter Gitter gewusst hätte, bleibt ihm nichts anderes übrig, als ihn freizusprechen. Die Beweislage (und die anwaltliche Unterstützung) lassen kein anderes Urteil zu, und der Richter verschwindet für immer aus dem „Grenzgebiet“.
Don Anselmo siedelt daraufhin zu seiner zuletzt erstandenen Hacienda über, erfreut sich seines (man weiß nicht wievielten) Kindes und lebt glücklich bis … eine Gruppe bandidos seinem Leben ein Ende setzt.
Back to the Mapuche oder Vom Niedergang eines Volkes
Welches Bild zeichnet Durand in dem umfangreichen Roman nun von den Mapuche? Sie nehmen durchweg Nebenrollen ein, ja, man möchte fast sagen, sie erscheinen nur im Nebensatz. Ihre Perspektive – selbst wenn der Leser gezielt danach sucht – wird kaum dargelegt. Sie kommen (als ehemalige Herrscher in dem Gebiet!) nur nebenbei vor. Und das Bild von ihnen ist despektierlich. Fast durchweg werden sie als faul, streitsüchtig und Analphabeten geschildert. Am schlimmsten aber: stets betrunken (Männer wie Frauen), „für immer vom Alkohol besiegt“ (S. 67). „Der indio, kräftig und stolz, verwandelte sich in einen armen, betrunkenen Wilden, der nicht zögerte, alles, was er besaß, herzugeben, um weiter trinken zu können“ (S. 223). Ihre einzige Rettung läge darin, „in der gleichen Art und Weise wie die Chilenen zu arbeiten“, aber das wäre „wie einen Toten auferstehen zu lassen“. „Starrköpfig, launenhaft und verschwenderisch“ (ebd.) lebten sie. Und „wenn sie nicht zur Entwicklung des Landes beitragen können, ist es besser, sie verschwänden oder zögen sich zurück“ (ebd.), lässt der Autor verschiedene Charaktere im Buch sprechen. Dagegen schildert kein einziger Mapuche seine Sicht der Dinge.
 Immerhin, es wird klar, dass die Mapuche als Goldesel der Nation angesehen werden. Alle rauben von ihnen (S. 429). Und die Kolonisten, mit einem kleinen Wein- oder Schnapsgeschäft im Gepäck, erobern durch kleine und größere Betrügereien ihre Anbauflächen, verdrängen die Mapuche immer mehr aus den Dörfern und Flecken (S. 428).
Immerhin, es wird klar, dass die Mapuche als Goldesel der Nation angesehen werden. Alle rauben von ihnen (S. 429). Und die Kolonisten, mit einem kleinen Wein- oder Schnapsgeschäft im Gepäck, erobern durch kleine und größere Betrügereien ihre Anbauflächen, verdrängen die Mapuche immer mehr aus den Dörfern und Flecken (S. 428).
Durand beschreibt demnach die Mapuche aus chilenischer Sicht und schert das ganze Volk über einen Kamm. Er zeichnet sein Bild von den Folgen der „Befriedung“ und dem Niedergang des einst so stolzen Volkes. Denn erst zum Zeitpunkt der Handlung hätte „ein neuer Lebensstil begonnen, der grundsätzlich mit jener barbarischen und rudimentären Existenz brach, welche die indios als Eigentümer des Landes fristeten“ (S.268). Durand versäumt aber darzustellen, wie die Mapuche lebten, wie und warum sie ihren Widerstand organisierten.
Und so geht die Suche nach Literatur jenseits der Weltengrenze weiter, in der Hoffnung, ein Buch zu finden, das aus Sicht der Mapuche erklärt, was Mitte des 19. Jahrhunderts begann: der Leidensweg eines ehemals freien Volkes.
Luis Durand,
Frontera. Novela del Sur
Editorial Nascimento
Santiago, 1949
Bildquellen: [1] Quetzal-Redaktion, ssc; [2] David Rumsey Historical Map Collection; [3] Public Domain; [4] Public Domain