 Wenn Armut die Kindheit stiehlt
Wenn Armut die Kindheit stiehlt
José Mauro de Vasconcelos (1920 – 1984) war das elfte Kind einer sehr armen Familie, die in Bangu, einem Stadtteil von Rio de Janeiro, mehr schlecht als recht ihr Dasein fristete. Mit neun Jahren zog er als Pflegekind nach Natal zu Verwandten, die ihm ein besseres Leben ermöglichten. Nach dem Abitur versuchte er sich an diversen Studien, jedoch ohne einen Abschluss zu erlangen. Ähnlich unstet verlief sein Berufsleben, das ihn bis in die entlegensten Winkel seines Heimatlandes brachte. Die einzige Konstante in seinem unruhigen Leben bildete die Schriftstellerei, die er mit zweiundzwanzig Jahren bereits mit beachtlichem Erfolg begonnen hatte und bis kurz vor seinem Tode fortsetzte. Viele seiner Bestseller spielen in den tropischen Urwäldern Brasiliens und erzählen von der indigenen Bevölkerung.
Eine Sonderstellung in Vasconcelos Werk nehmen seine autobiografischen Romane ein: Doidão (Der Verrückte, 1963), O meu pé de laranja lima (Wenn ich einmal groß bin; Mein kleiner Orangenbaum, 1968) und Vamos aquecer o sol (Lass die Sonne scheinen, 1974). Der Protagonist dieser Trilogie ist Zezé Vasconcelos aus Bangu, dessen Kindheit, Jugend und Eintritt in das Erwachsenenleben aus der Perspektive des Ich-Erzählers geschildert werden.
Der Longseller Mein kleiner Orangenbaum, den Vasconcelos im Alter von 48 Jahren verfasste, findet weltweit großen Anklang und millionenfachen Absatz, wird in Brasilien zur Pflichtlektüre an Grundschulen, zweimal erfolgreich verfilmt sowie für Theater und Fernsehen adaptiert.
Der fünfjährige Zezé ist ein lebensfroher pfiffiger Junge mit einer blühenden Fantasie, die es ihm ermöglicht aus seiner bitteren Lebensrealität der 1920er Jahre in eine vielgestaltige Scheinwelt zu entfliehen. Ein kleiner Orangenbaum im Garten erwacht für ihn zum Leben und wird sein bester Freund, dem er Freud und Leid anvertrauen kann. Ein Ast dient ihm als Wildpferd, auf dem er mit Cowboys und Indianern, die er aus amerikanischen Stummfilmen kennt, auf der Jagd nach Büffeln und Bisons durch die Prärie galoppiert. Die Hühner der Familie werden in seiner Vorstellungswelt zu wilden Panthern und Löwen. Der schmutzige Graben im Garten verwandelt sich in den reißenden Amazonas, den Indios mit ihren Einbäumen befahren. Allen Lebewesen und Gegenständen, die Zezé am Herzen liegen, verleiht er originelle Namen. Nicht weniger erfinderisch sind seine zahlreichen Streiche, die der Lausbub mit diebischer Freude seinen Mitmenschen spielt und die ihm in seinem direkten sozialen Umfeld den Ruf des ausgemachten Teufelsbratens eingebracht haben. Statt in ihm den aufgeweckten und talentierten Jungen zu erkennen, stempeln sie ihn als hoffnungslosen Tunichtgut ab, der nichts als bösen Schabernack im Kopf hat und machen ihn zu ihrem Sündenbock und Prügelknaben. „Sie hauen mich aber auch wegen Sachen, die gar nicht ich getan habe. Ich bin immer an allem schuld. Sie haben sich einfach dran gewöhnt, mich zu schlagen …“ Ohne nun seinerseits wütend auf seine Peiniger zu sein, ergeht sich Zezé in Selbststigmatisierung: „Ich tauge überhaupt nichts. Ich bin ganz schlecht. Deshalb kommt zu Weihnachten für mich der Teufel auf die Welt, und ich bekomme nichts geschenkt. Ich bin ein Ekel. Ein Biest. Ein ganz abscheuliches Mistvieh. Eine meiner Schwestern hat mir mal gesagt, so was widerwärtiges wie ich hätte gar nicht geboren werden dürfen …“ Sein Selbsthass, seine Schuldgefühle und Verzweiflung gehen am Ende gar so weit, dass er sich aus dem tiefen Gefühl seiner eigenen Wertlosigkeit und kompletter Hoffnungslosigkeit heraus das Leben nehmen möchte. „ […] ich bin zu nichts gut, und ich bin es so leid, verprügelt und an den Ohren gezogen zu werden. Ich will auch nicht ein Mund mehr sein, der gefüttert werden muss …“
Das Erzählgeschehen erstreckt sich über knapp ein Jahr. In diese Zeit fallen der Umzug in ein kleineres Haus, Zezés vorzeitige Einschulung sowie seine waghalsige Mutprobe, die ihn zu seinem „Ersatzvater“ führt. Nach einer kurzen Phase absoluter Glückseligkeit lässt ein brutaler Schicksalsschlag den sensiblen Jungen schwer erkranken. Seine Kindheit endet abrupt und viel zu früh. Gespiegelt wird das in dem abgeschlossenen Wachstum des kleinen Orangenbaumes, der bereits Blüten treibt und bald Früchte tragen wird und damit für Zezé entzaubert ist. „Er war aus der Welt meiner Träume hinübergewachsen in die der schmerzlichen Wirklichkeit.“
In weniger als zwölf Monaten wird aus einem vor Einfallsreichtum nur so sprühenden lustigen Burschen ein schwermütiger und schweigsamer Mensch, dem die Unbill des Schicksals seine Lebensfreude und kindliche Unbefangenheit entrissen hat. „Jetzt erst wusste ich wirklich, was Schmerz war. Schmerz war nicht, wenn man Prügel bekam, bis man umfiel. War nicht, wenn man den Fuß mit einer Glasscherbe zerschnitt und ihn dann in der Apotheke genäht kriegte. Schmerz war, wenn das ganze Herz so weh tat, dass man nur noch sterben wollte, ohne irgendjemand davon erzählen zu können. Schmerz war, wenn den Armen der Schwung, dem Denken die Kraft verloren ging und der Wille nicht mehr ausreichte, den Kopf aus dem Kissen zu drehen.“
Die Armut hat seine Kindheit vom ersten Tag an überschattet und sie ihm nach und nach geraubt. Statt wohl behütet und unbeschwert einfach nur Kind sein zu dürfen, wendet Zezé notgedrungen Überlebensstrategien und Methoden der Erwachsenen an, um Probleme zu lösen, die Eltern normalerweise von ihrem Nachwuchs fernzuhalten versuchen. Bereits im Vorschulalter verdingt er sich als Schuhputzer, Assistent eines Straßenhändlers und macht – ganz Entrepreneur – gewinnbringende Tauschgeschäfte mit Gleichaltrigen. Der altkluge und frühreife Knabe, – wie seine Angehörigen ihn beurteilen -, erweist sich auch in anderen Situationen als erstaunlich erwachsen so beispielsweise im Verhältnis zu dem arbeitslosen Familienoberhaupt, das zu Recht für das gleichgültige und verantwortungslose Verhalten gegenüber seiner Frau und den Kindern zu verurteilen gewesen wäre. Papa „hatte sich in den Schaukelstuhl gesetzt und starrte wie abwesend auf die Wand. Sein Gesicht war unrasiert wie immer. Das Hemd nicht besonders sauber. Wahrscheinlich war er nur deshalb nicht weggegangen, mit den Freunden Argolo zu spielen, weil er kein Geld hatte.“ Als der zutiefst enttäuschte Zezé im Gespräch mit einem seiner Brüder Kritik an dem Vater übt, befindet sich dieser unseligerweise in Hörweite und verlässt daraufhin wortlos das Haus. Zezé, der zuvor schon von sich aus dafür gesorgt hatte, dass wenigstens sein jüngstes Geschwisterchen etwas zu Weihnachten geschenkt bekommt, macht dann das, was der Erwachsene für seine Söhne und Töchter hätte tun müssen. Er geht Schuhe putzen, um das nötige Geld für eine Packung Zigaretten zu verdienen:
–Ich hab den ganzen Tag gearbeitet, um sie als Weihnachtsgeschenk für Papa kaufen zu können.“, sagt er dem Wirt beim Kauf.
–Ist das wahr, Sesé? Und was hat er dir geschenkt?
–Nichts. Wissen Sie, er ist immer noch arbeitslos.
Er war betroffen, und niemand in der Wirtschaft sagte ein Wort.
Früh hegt der sprachbegabte Junge seinen Berufswunsch: Wenn er groß ist, möchte er ein Dichter werden. Er liebt die Poesie, Lieder, Geschichten und ist fasziniert von schwierigen und längeren Wörtern, wie zum Beispiel Anthropophage, deren Bedeutung er erfragt und sodann in seinen Wortschatz übernimmt. Auch das Lesen hat er sich selber beigebracht, was ihm bei den meisten statt Lob Unverständnis einbringt. Seine Schwester Jandira glaubt, dass der Teufel es Zezé im Schlaf gelehrt habe und verhöhnt ihn: „Das hast du davon! Hast es zu früh gelernt, du Dummkopf. Dafür wirst du nun schon im Februar in die Schule kommen.“
Die Parallelen zu Jean-Paul Sartres Kindheit, – wie der französische Philosoph sie in dem autobiografischen Roman Les mots (Die Wörter, 1964) beschreibt –, sind augenfällig. Der früh vaterlos gewordene Jean-Paul, „Poulou“, lebt zusammen mit seiner Mutter bei den Großeltern. Der alte Herr vergöttert seinen Enkel und behandelt ihn wie ein Wunderkind. All das, was Zezé negativ angelastet wird, wie seine Frühreife, die Begeisterung und Begabung für Sprache, der Wunsch Literat zu werden usw., wird bei dem kleinen Poulou bewundert und gefördert.
Bei Vasconcelos wie bei Sartre findet sich nicht der – wie in den meisten autobiografischen Romanen – oft verklärte und erbauliche Blick auf längst vergangene Kindertage mit der diesen innewohnenden Magie, sondern das verstörende und ernüchternde Psychogramm einer dysfunktionalen Familie, die die Bedürfnisse ihrer Schutzbefohlenen komplett außer Acht lässt und so bei den Kindern nachhaltige psychische Schädigungen auslöst. Bei derartigem familiärem Versagen ist es letztlich vollkommen unerheblich, ob man aus gutem Hause oder ärmlichen Verhältnissen stammt.
José Mauro de Vasconcelos
Mein kleiner Orangenbaum*
Unionsverlag, Zürich 2024
*Deutsche Erstveröffentlichung unter dem Titel: Wenn ich einmal groß bin, Marion von Schröder Verlag, Hamburg 1970.
Bildquelle: [1] CoverScan


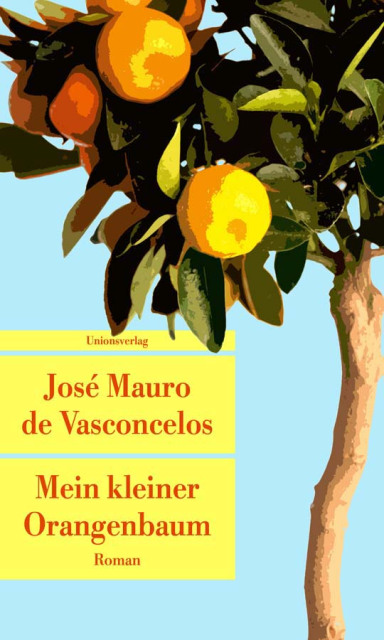 Wenn Armut die Kindheit stiehlt
Wenn Armut die Kindheit stiehlt




