Die Tragödie Trotzkis und das Scheitern der großen Utopie
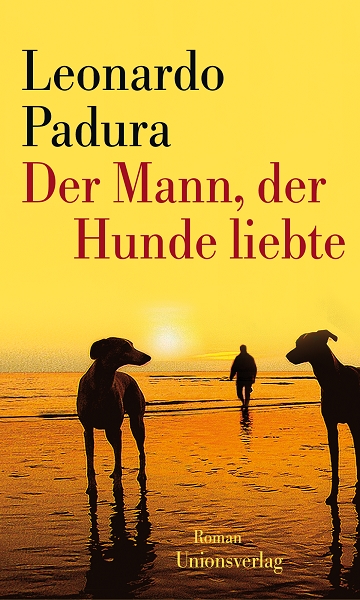 Wer kennt sie nicht, die Klassiker der Manns: „Wallenstein“ oder „Heinrich IV“? Schwer liegen sie in der Hand, majestätisch, erhaben. Durch ihre schiere innere Größe ragen sie im Buchregal hervor, denn abgrundtief tauchen sie ein in die Geschichte der Menschen und der Menschheit. Ehrfurchtsvoll blickt man als Leser hinauf in den Olymp der Literatur.
Wer kennt sie nicht, die Klassiker der Manns: „Wallenstein“ oder „Heinrich IV“? Schwer liegen sie in der Hand, majestätisch, erhaben. Durch ihre schiere innere Größe ragen sie im Buchregal hervor, denn abgrundtief tauchen sie ein in die Geschichte der Menschen und der Menschheit. Ehrfurchtsvoll blickt man als Leser hinauf in den Olymp der Literatur.
Mit „Der Mann, der Hunde liebte“ steigt der kubanische Autor Leonardo Padura – dieses Urteil sei erlaubt – nun in die gleichen Höhen hinauf. Ist er bisher hauptsächlich bekannt für seine Kriminalromane mit dem Ermittler Mario Conde (z. B. „Das Havanna-Quartett“ oder „Der Nebel von gestern“), die gleichwohl stilistisch ausgefeilt daherkommen, denen es aber an Tiefe fehlt, drängt sich dem Leser nun die Erklärung dafür auf: Padura nahm einen ganz langen Anlauf, um den weiten Sprung in die Riege der Meister zu vollziehen. Bereits 2008 erklärte er im Interview mit QUETZAL, seit vier Jahren an diesem Buch über Leo Trotzki, dessen Mörder Ramón Mercader und über das Scheitern der Utopie der Gleichheit im 20. Jahrhundert zu arbeiten. 2009 vollendete er die spanische Version. Jetzt, zwei Jahre später, erschien der Roman im Unionsverlag endlich auf Deutsch.
Die Handlung beginnt 1929. Es war die Zeit, als sich die Reste der Opposition in der Sowjetunion immer stärkeren Verfolgungen ausgesetzt sahen und auch das Verschwinden von Leo Trotzki „notwendige Voraussetzung für das Abgleiten der Großen Proletarischen Revolution in eine Tyrannei war“ (S. 26). Damals wurde der Revolutionär in die kasachische Verbannung geschickt und sein Name aus Geschichtsbüchern, Gedenkschriften, Zeitungsartikeln entfernt, sein Gesicht von Fotos wegretuschiert, „um ihn in ein absolutes Nichts zu verwandeln, in einen blinden Fleck im öffentlichen Gedächtnis“ (ebd.). Am 20. Januar 1929 blieben ihm 24 Stunden, um die Sowjetunion auf immer zu verlassen.
Der Leser begleitet Trotzki auf seiner Odyssee in der Emigration. Puzzleartig setzen sich Details aus seinem Leben, die Padura geschickt in Nebensätze packt, zusammen und zeichnen peu à peu ein sich immer weiter schärfendes Porträt des Revolutionärs. An dieser Stelle vergisst der Autor lediglich, auf die Hintergründe des – dann personalisierten – Konflikts zwischen Trotzki und Stalin einzugehen. Das holt er später zwar in exzellenter Form nach, aber wer sich nicht sehr gut mit der Revolution in Russland auskennt, stolpert hier wohl das erste Mal über die Fallstricke der Historie. Es sei von daher empfohlen, bei der Lektüre stets ein einschlägiges Lexikon zur Hand zu haben. Man wird es auch an anderen Stellen des Buches häufiger benötigen können.
Im Weiteren spinnt Padura in drei Erzählsträngen die Lebensläufe von Leo Trotzki, dessen späteren Mörder Ramón Mercader und Iván Cárdenas Maturell, dem Schriftsteller, der 37 Jahre nach dem Mord zufällig die Geschichte Ramón Mercaders von einem zwielichtigen Fremden erfährt, zu einem immer dichter werdenden Netz zusammen. Das verbindende Element ist nichts Geringeres als die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts – und die Liebe zu Hunden. In einem ungemein spannenden Wechsel der Szenarien beleuchtet der kubanische Autor vor dem Hintergrund des Exils und des Bürgerkrieges in Spanien das Leiden des „furchtbar einsamen Mannes“ (S. 65) Trotzki und die Entwicklung des lebensfrohen, politisch verblendeten Mercader.
 Die spiralförmige Verquickung beider Lebenswege bildet jedoch nur den Rahmen für tiefsinnige Reflexionen Paduras über die Geschichte des 20. Jahrhunderts, über die Suche nach einer Gesellschaft der Gleichen und über das sang- und klanglose Scheitern dieser Vision. Trotzki wird für ihn Kläger und Angeklagter zugleich. So lässt er den Exilierten fragen, wie es kommen konnte, dass „die Revolution, für die er gekämpft hatte, in der Diktatur eines als Bolschewiken verkleideten Zaren“ (S. 65) endete. Warum wurde er von Stalin kalt gestellt, obwohl die Welt einer wirklichen Revolution harrte? Andererseits ruft Padura in der Darstellung seines Protagonisten auch in Erinnerung, dass sich das spätere Opfer stalinistischer Gewalt „selbst von der Gewalt hatte hinreißen lassen“ (S. 77). Es war schließlich Trotzki, der zu Zeiten der Revolution durch die Abschaffung demokratischer Strukturen in den Arbeiterorganisationen und durch die erbarmungslose Verfolgung von Widersachern die Voraussetzungen für die autoritäre Herrschaft schuf (ebd., S. 193). Dieses Nachsinnen Trotzkis über die Oktoberrevolution, Gewalt und Macht (S. 76-79), die gleichwohl die Ideen von Padura sind, zeigen, wie tiefgründig sich der kubanische Schriftsteller in die Materie eingearbeitet hat.
Die spiralförmige Verquickung beider Lebenswege bildet jedoch nur den Rahmen für tiefsinnige Reflexionen Paduras über die Geschichte des 20. Jahrhunderts, über die Suche nach einer Gesellschaft der Gleichen und über das sang- und klanglose Scheitern dieser Vision. Trotzki wird für ihn Kläger und Angeklagter zugleich. So lässt er den Exilierten fragen, wie es kommen konnte, dass „die Revolution, für die er gekämpft hatte, in der Diktatur eines als Bolschewiken verkleideten Zaren“ (S. 65) endete. Warum wurde er von Stalin kalt gestellt, obwohl die Welt einer wirklichen Revolution harrte? Andererseits ruft Padura in der Darstellung seines Protagonisten auch in Erinnerung, dass sich das spätere Opfer stalinistischer Gewalt „selbst von der Gewalt hatte hinreißen lassen“ (S. 77). Es war schließlich Trotzki, der zu Zeiten der Revolution durch die Abschaffung demokratischer Strukturen in den Arbeiterorganisationen und durch die erbarmungslose Verfolgung von Widersachern die Voraussetzungen für die autoritäre Herrschaft schuf (ebd., S. 193). Dieses Nachsinnen Trotzkis über die Oktoberrevolution, Gewalt und Macht (S. 76-79), die gleichwohl die Ideen von Padura sind, zeigen, wie tiefgründig sich der kubanische Schriftsteller in die Materie eingearbeitet hat.
Was beim Lesen des Buches neben den historischen Abrissen, der Haupthandlung und dem sehr lebendigen Stil wahre Begeisterungswellen hervorruft, ist die Leichtigkeit, mit der sich Padura durch Raum und Zeit bewegt. Kasachische Wüste, Spanischer Bürgerkrieg, türkische Inseln, norwegisches Exil, Kuba zu Zeiten der großen Zuckerrohrernte, Prag 1968, Stalins Schauprozesse: Das ganze 20. Jahrhundert verschmilzt zu einem kompakten Rundumschlag, der dem Leser ein universelles Wissen über Literatur, Politik, Wirtschaft, Geographie und natürlich Geschichte abverlangt.
Obwohl Paduras Roman schwer in den Händen liegt wie Manns Meisterwerke, liest es sich ebenso flüssig. Die verschiedenen Handlungsstränge erscheinen wie ineinander verwobene, separate griechische Tragödien innerhalb eines historischen Rahmens (eben jenes 20. Jahrhundert). Der Schriftsteller bezeichnet an einer Stelle sogar selbst Trotzkis Exil als eine Tragödie – „klassisch, griechisch, ohne Hoffnung auf Vergebung“ (S. 131). Erbarmungslos schildert Padura im Folgenden all die Schicksalsschläge, seien sie politischer oder familiärer Art, die auf den Revolutionär hernieder gingen. Wahrlich meisterhaft führt der Kubaner das große Drama seinem Ende entgegen.
Dafür bedarf es natürlich auch eines Gegenspielers. Padura wählt für diese Rolle jedoch nicht Stalin. Das hätten alle erwartet. Ihm obliegt es (in der literarischen Version) lediglich, im Hintergrund Regie zu führen. Im Scheinwerferlicht steht vielmehr Ramón Mercader. Der Stern des glühenden Kommunisten (so bezeichnet er sich zumindest selbst) geht im Spanischen Bürgerkrieg auf. Padura überträgt dafür geschickt den trotzkistisch-stalinistischen Grundkonflikt auf den historischen Kontext Spaniens in den 1930ern. Denn Mercader sieht sich erstmals mit den „Abweichlern“ der sowjetischen Doktrin konfrontiert, „den katalanischen Nationalisten, den Syndikalisten mit anarchistisch oder sozialistischen Tendenzen“ (S. 137) und den Trotzkisten der Vereinigten Marxistischen Arbeiterpartei. Während nämlich Moskau zunächst die Einheit im Bürgerkrieg fordert und die Revolution hintanstellt, wollen die anderen die sofortige Revolution gegen das bürgerliche System. Diese Verweigerung der „Abweichler“ gegen die Beschlüsse des Führers Stalin treibt Mercader dazu, alle Trotzkisten – und am Ende das von ihm verachtete Übel Lew Dawidowitsch selbst – zu bekämpfen. Zwar spürt auch er die stalinistische Pistole auf der Brust, die andeutet, was im Falle des Scheiterns mit ihm geschehen würde. Aber er fühlt sich fortan zu etwas Wichtigem berufen, zu etwas Großem, dem er alles unterordnet, sogar die Menschenwürde. In Stalins Ausbildungslagern verliert er seine Identität. Von nun an ist er Soldat 13, eine Nummer, die sich für verschiedene Aufträge unterschiedliche Namen leiht. Und er bleibt zeitlebens eine Zahl in einem großen Räderwerk.
 Nach dieser wilden Jagd durch Raum und Zeit finden Trotzkis Fluchtwege und Mercaders Entpersönlichung endlich in Mexiko zusammen. Die drei Jahre bis zur Ermordung des Revolutionärs nehmen den gesamten zweiten Teil des Buches ein.
Nach dieser wilden Jagd durch Raum und Zeit finden Trotzkis Fluchtwege und Mercaders Entpersönlichung endlich in Mexiko zusammen. Die drei Jahre bis zur Ermordung des Revolutionärs nehmen den gesamten zweiten Teil des Buches ein.
Vor dem Hintergrund des – für die europäischen Linken unbegreiflichen, für Trotzki hingegen konsequent logischen – Abschlusses des Hitler-Stalin-Paktes wird Ramón Mercader alias Jacques Monard alias Frank Jacson auf die Reise nach Mexiko geschickt. Er soll den letzten Akt im Trotzkischen Drama einläuten. Stalin braucht den Exilierten nicht mehr als Sündenbock in seinem Schmierentheater. Jetzt kann er eliminiert werden.
Trotz des großen Spannungsbogens gerät der Mittelteil etwas lang, zu deskriptiv, ohne stilistische oder sonstige Höhepunkte. Zu oft „erwartete Lew Dawidowitsch eine weitere schlechte Nachricht“ (S. 442). Auch machen die Zeitsprünge in den Handlungssträngen zwischen den einzelnen Kapiteln (wenngleich es jeweils nur wenige Monate vor und zurück sind) es nicht gerade einfacher, der komplexen und verwickelten Geschichte zu folgen.
Dennoch gelingt es Padura immer wieder, das nahende (letzte) Attentat auf Trotzki mit politischen Grundfragen und dem „Ende der Utopie“ (S. 480) zu verknüpfen. Geradezu brillant reflektiert er über Revolution, Sozialismus und Diktatur (spez. S. 482-489). Schonungslos legt er die Gedanken Lew Dawidowitschs – die eigentlich seine eigenen sind – dar, sich fragend, wie zwei Jahrzehnte nach der Oktoberrevolution „alles der Kontrolle eines von der Partei beherrschten Staates, eines von der von ihrem Generalsekretär beherrschten Partei beherrschten Staates“ (S. 480) unterstehen konnte. Dieses Scheitern der großen Utopie, das Abgleiten der Revolution in eine Diktatur lässt Padura – neben der eigentlichen Handlung um Mercader und Trotzki – ständig im Hintergrund des Romans schwelen. Es dreht sich letztendlich um die Frage, ob „die Diktatur eine unabwendbare historische Notwendigkeit, die einzige Alternative des Systems“ (S. 483) bildete. Die Affirmation bedeutete somit, „dass es mehr die Fehler der Revolutionäre als die Bestrebungen des Imperialismus waren, die die großen Veränderungen der menschlichen Gesellschaft verhindert haben“ (S. 487).
Das tödliche Attentat auf Trotzki rückt immer näher. Der Exilant ist sich bewusst geworden, dass „Stalin allen Saft, den er brauchte, um seine Repression innerhalb und außerhalb der Sowjetunion aufrechtzuerhalten, aus ihm herausgepresst und beschlossen hatte, ihn wie eine ausgediente Maschine zu verschrotten, um jedes Risiko einer Wiederinbetriebnahme auszuschließen“ (S. 558). Hier erweist sich Padura nun als Meister des Kriminalromans: Der letzte Akt wird gedehnt, der Mord will einfach noch nicht geschehen. Der Autor nimmt sich sogar die Zeit, seine Lieblingsfigur Mario Conde (S. 616) zu erwähnen. Dann saust der Eispickel in der Hand Mercaders auf Trotzkis Kopf nieder.
Bleibt am Ende die Frage: Wer war der Mann, der die Hunde liebte? Der Leser wird es erfahren.
Fazit: Padura ist mit „Der Mann, der Hunde liebte“ ein genialer Roman (ja, es handelt sich trotz allem immer noch um einen Roman!) gelungen. Bravo! Da Capo! Und im Buchregal, unweit der meisterlichen Manns, erhebt sich ein neuer Olymp.
Leonardo Padura
Der Mann, der Hunde liebte
Unionsverlag, 2011
Bildquellen: [2] Detlef Endruhn. [3] Public Domain


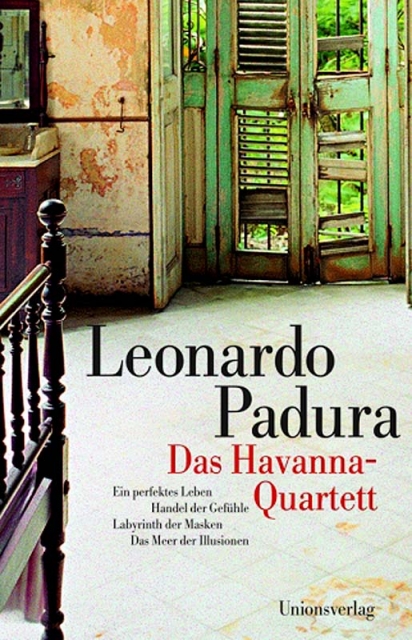



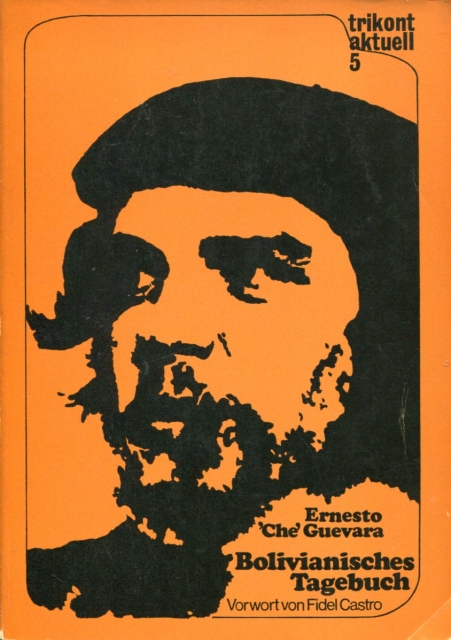

Es dürfte sich allmählich herumgesprochen haben, dasss es sich bei der spanischen Vereinigten Marxistischen Arbeiterpartei(POUM)eben nicht um eine trotzkistische Organisation handelte. Vgl. dazu den Beitrag „Gegen die Apologeten des Verrats der POUM, damals und heute. Trotzkismus kontra Volksfrontpolitik im Spanischen Bürgerkrieg“, in „Spartacist“ (deutsche Ausgabe) Nr. 27 vom Frühjahr 2009 (http://www.icl-fi.org/deutsch/dsp/27/sp ain.html)
Hier noch einmal der Link:
http://www.icl-fi.org/deutsch/d sp/27/spain.html