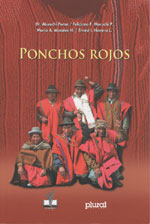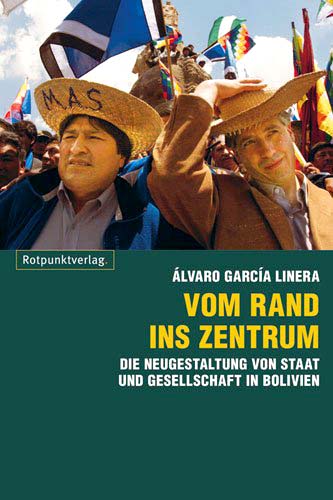Das Bolivien unter Evo Morales ist mittlerweile zu einem viel beachteten Forschungsgegenstand geworden. Seit 2006 fanden mehrere wissenschaftliche Tagungen statt, die ihre Ergebnisse jeweils in Sammelbänden zusammenfassten bzw. zum Teil noch zusammenfassen werden. Für den Bolivien-Interessierten hierzulande kann dies ein Vorteil sein – erfährt er doch aus den Forschungen einiges, was er sich sonst mühsam durch nicht immer leicht erreichbare Primärquellen aneignen müsste – es kann sich aber auch zur Last entwickeln, will man alle Ergebnisse studieren und stößt dabei immer wieder auf die gleichen Argumente und ständig wiederholte, sattsam bekannte Aussagen. Das Buch, in dem Tanja Ernst und Stefan Schmalz die Ergebnisse einer Kassler Tagung aus dem Sommer 2008 zusammenfassen, enthält beides. Zum einen interessante Einblicke und Analysen des Boliviens in Neugründung, zum anderen aber auch ärgerliche Aufsätze, deren Lektüre denjenigen kaum weiter bringt, der sich ein wenig mit der Situation auskennt und die Neueinsteigern ein verzerrtes Bild liefern. Dieses wird dann allerdings, das ist eine der Stärken des vorliegenden Bandes, durch eine Pluralität der verschiedenen Autoren ausgeglichen. Der Christdemokrat Stefan Jost kann hier ebenso veröffentlichen wie die radikale Indigenistin Fabiola Escárzaga.
Das Bolivien unter Evo Morales ist mittlerweile zu einem viel beachteten Forschungsgegenstand geworden. Seit 2006 fanden mehrere wissenschaftliche Tagungen statt, die ihre Ergebnisse jeweils in Sammelbänden zusammenfassten bzw. zum Teil noch zusammenfassen werden. Für den Bolivien-Interessierten hierzulande kann dies ein Vorteil sein – erfährt er doch aus den Forschungen einiges, was er sich sonst mühsam durch nicht immer leicht erreichbare Primärquellen aneignen müsste – es kann sich aber auch zur Last entwickeln, will man alle Ergebnisse studieren und stößt dabei immer wieder auf die gleichen Argumente und ständig wiederholte, sattsam bekannte Aussagen. Das Buch, in dem Tanja Ernst und Stefan Schmalz die Ergebnisse einer Kassler Tagung aus dem Sommer 2008 zusammenfassen, enthält beides. Zum einen interessante Einblicke und Analysen des Boliviens in Neugründung, zum anderen aber auch ärgerliche Aufsätze, deren Lektüre denjenigen kaum weiter bringt, der sich ein wenig mit der Situation auskennt und die Neueinsteigern ein verzerrtes Bild liefern. Dieses wird dann allerdings, das ist eine der Stärken des vorliegenden Bandes, durch eine Pluralität der verschiedenen Autoren ausgeglichen. Der Christdemokrat Stefan Jost kann hier ebenso veröffentlichen wie die radikale Indigenistin Fabiola Escárzaga.
Die Pluralität zeigt sich insbesondere bei den vier Beiträgen zur neuen Verfassung. Oscar Vega schreibt aus Sicht des indigenen Bolivianers über ihre Notwenigkeit, Stefan Jost kritisiert das vorliegende Ergebnis unter dem Blickwinkel der westlichen Demokratievorstellung, die auch dem Kommentar von Jonas Wolff zugrunde liegt, während Almut Schilling-Vacaflor versucht, verschiedene Ebenen der Diskriminierung in der Verfassungsgebenden Versammlung zu durchleuchten. Der bolivianische Intellektuelle Vega, der auch Mitglied der Verfassungsgebenden Versammlung war, lädt dazu ein „mit einer anderen Art des Denkens zu beginnen, […] jene Wege zu betreten, auf denen sich die indigenen Völker und Nationen in einem Moment bewegen, in dem die internationale Ordnung instabil und ihre Funktionsweise gestört ist, wodurch die Zukunft des Planeten und seiner Bewohner aufs Spiel gesetzt wird“ (S. 18).
Vegas Beitrag ist, auch wenn er an der Oberfläche stecken bleibt, immerhin als Gegenbild zumindest zu Josts kritischen Anmerkungen zu lesen, die der deutsche Politikwissenschaftler und Jurist auf Grundlage eines westlichen Rechtspositivismus verfasst hat. Dieser wird eins-zu-eins von Europa auf die Verhältnisse in Bolivien übertragen, so dass er dem „Hegemonieprojekt der MAS“, das Jost für den Prozess der Verfassungsgebung ausgemacht hat, entgegen steht. Unter diesen Voraussetzungen erkennt er eine „konzeptlose Indigenisierung der Verfassung“. Die politische Entwicklung ist für ihn unvorhersehbar – logisch, es geht ja auch um etwas Neues – und der notwendige Kern eines erfolgreichen Neuaufbaus, die Doppelstrategie in den Institutionen und gleichzeitig außerparlamentarisch zu agieren, kann von ihm nur als Strategie zum Machterhalt verstanden werden und nicht als Weg zu einer neuen Form von Regierung jenseits der Repräsentation.
Die Kritikpunkte, die Jost wie auch Wolff zurecht anführen – zu nennen sind die sich teilweise widersprechenden Regelungen in der Verfassung oder auch die Schwierigkeit eines echten Minderheitenschutzes –, sind nicht von der Hand zu weisen, auch wenn der Grund ihrer Problematisierung oft genug im Dunkeln bleibt. So fragt man sich beispielsweise, um welche schützenswerte Minderheit es Wolff seitenlang konkret geht. Um die, welche die überwältigende Mehrheit der Produktionsmittel besitzt? Oder um die zahlenmäßig kleinen Völker des Tieflands? Gerade bei der Beantwortung dieser Frage formuliert Wolff so unverständlich, dass man annehmen mag, dass es ihm selber entweder unklar oder aber peinlich ist, wessen Interessen er vertritt. Es ist logisch, dass eine am liberalen Repräsentationsmodell geschulte Demokratietheorie der andinen Form der partizipativen, protagonistischen Demokratie skeptisch gegenüber stehen muss. Vielleicht wäre es aber auch sinnvoll, dass sie ihre Maximen einmal selbstkritisch in Frage stellt. Das fehlt sowohl bei Wolff wie auch bei Jost.
Ganz anders sieht Almut Schilling-Vacaflor den Prozess der Verfassungsgebung. Denn während die beiden zuvor genannten Autoren implizit die Gefahr beschreiben, dass die alte Elite abgedrängt wird, versucht sie die weiter bestehenden Formen von Diskriminierung der Indigenen und der Frauen im Prozess zu erfassen. Dafür aber hätte sie keinen Pierre Bourdieu gebraucht, der zur Aufklärung hier nichts beiträgt und dessen von der Autorin benutzen Theoreme so banal wirken wie ihre eigene folgende Aussage: „Die RepräsentantInnen der MAS-Fraktion verstanden sich insgesamt stärker als direktes Sprachrohr für jene Bevölkerungsgruppen, die sie vertraten“ (S. 61). Ja für welche denn sonst? Es bedarf sicher einer tieferen Analyse, aber sowohl der Versuch, mit Bourdieu die Diskriminierung zu erklären als auch mit (unter anderem) Poulantzas die staatliche Reorganisation der Erdgaspolitik, wie dies Isabella Margerita Radhuber versucht, zeigen zumindest hier den geringen Wert dieser Theorien für eine Strukturanalyse. Beide wirken aufgesetzt und banal. Die Beiträge gewinnen dort an Qualität – vor allem der von Radhuber – wo es um die empirische Untersuchung des Gegenstandes geht.
Schon den Aufsätzen zur Verfassungsfrage kann man bei aller Kritik eines nicht absprechen: Sie machen deutlich, dass das Projekt von Evo Morales und der hinter ihm stehenden Bewegung etwas grundsätzlich anderes darstellt als das, was wir mit westlichen Begriffen zu beschreiben gewohnt sind. Aber was ist es? Handelt es sich um eine Regierung der sozialen Bewegungen? Zwei Autoren aus Lateinamerika haben darauf unterschiedliche Antworten. Pablo Mamani Ramírez stellt heraus, dass es sich bei der Präsidentschaft von Evo Morales um eine indigene Machtergreifung gehandelt habe und die Regierung trotz ihres reformistischen Charakters „konkrete Ansätze kollektiver sowie individueller gesellschaftlicher (Inter)Aktion“ biete und einen neuen Raum für traditionelle indigene Formen von Kommunalpolitik schaffe (S. 68). Das Selbstbild der kolonialen Macht sei in Frage gestellt und gleichzeitig ist für die Indigenen sichtbar geworden, dass auch einer der ihren Präsident werden kann, „insofern haben alle neun Million Bolivianer an der Präsidentschaft teil“ (S. 72).
Zwar relativiert er die letzte Aussage nur indirekt, aber wie auch bei Fabiola Escárzaga scheinen bei Mamani Ramírez indigene und westliche Denkweise keine Symbiose eingehen zu können. Denn was an der Aussage von Vizepräsident Àlvaro García Linera, dass es nicht um die Repräsentanz der Indigenen in der Regierung, sondern um ein gesamtgesellschaftliches Befreiungsprojekt geht, ist eigentlich paternalistisch (S. 73)? Das sollte sich zumindest Mamani Ramírez fragen. Nun mag die konkrete Umsetzung paternalistischen Charakter haben. Die interessante Vorstellung, dass es eine kulturelle Verbindung geben kann, ist nicht von der Hand zu weisen, wird aber in diesem Buch von niemandem ausgearbeitet. Die Chance, die in der Zusammensetzung der MAS aus Strömungen des Nationalismus, Marxismus und Indianismus besteht, sieht Mamani Ramírez offenbar nicht.
Das gleiche gilt für Escárzaga, die die Regierung dafür kritisiert, dass sie die sozialen Bewegungen integriert. Für sie ist die Erfahrung in Bolivien letztlich eine reformistische: „Die antikapitalistische gesellschaftliche Mobilisierung, die sich zeitweise bis zum Aufstand entwickelte, wurde eingedämmt und in eine parlamentarische Richtung kanalisiert“ (S. 91). Das stimmt zwar, aber es stellt sich doch die Frage, ob das nicht auch positive Aspekte hat? Escárzaga scheint hier gefangen von einer antiparlamentarischen Ideologie, zumal wenn sie schreibt, dass Morales politische Machtbeziehungen mit ihm als Caudillo etabliere. Die besondere Bedeutung des Präsidenten im Prozess kann so nicht einfach abgetan werden. Auf die Spitze treibt sie ihre Kritik an der derzeitigen Politik, wenn sie davon spricht, dass diese das Land nach 2005 noch weiter von den Hoffnungen auf eine Dekolonialisierung entfernt hat als vorher. Das ist Unsinn. Die Kritik der radikalen Indigenen hat in Teilen ihre Berechtigung. Escárzagas Stoßrichtung hin zu einem indigenen Staat, der letztlich, denkt man ihre Worte einen kleinen Schritt weiter, den Rassismus nur umdreht, führt in die Irre. Dies wäre sicher noch weiter zu belegen. Zunächst mag der Hinweis genügen, dass es genau das indigene Staatsgebilde der Inkas war, das den spanischen Eroberern hoffnungslos unterlegen war und zwar nicht nur, weil Schwarzpulver fehlte. Hier muss dringend weiter diskutiert werden, auch und gerade in Bolivien selber.
Weniger provokant ist der Beitrag von Tanja Ernst zur sozialen Ungleichheit. Sie setzt auf Zahlen. Zwar hätte man sich die Aussage, dass, was die Bildung betrifft, nach wie vor „deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, zwischen ländlicher und urbaner, zwischen indigener und nicht-indigener sowie zwischen einkommensschwacher und -starker Bevölkerung“ (S. 132) bestünden, auch irgendwie denken können, aber abseits solcher Banalitäten liefert Ernst einen guten Einblick in das, was passiert ist und gleichsam auch in das, was noch fehlt. Sozialpolitik einigermaßen top, Wirtschaftspolitik vielleicht nicht gleich hopp, aber doch zumindest ausbaufähig. Da gibt es viel zu tun, will die Neugründung nachhaltig sein. Gleiches gilt für den Bereich der Landverteilung, die Juliana Ströbele-Gregor untersucht. Sie sieht in der Landfrage vor allem die kulturelle Dimension (ohne die ökonomische auszusparen), denn es gehe um die Reziprozität als ein wichtiges Element der indigenen Weltanschauung, in der es das Konzept Landbesitz nicht gebe. Dass es der Bewegung von Morales deswegen vor allem darum geht, die indigenen Gemeinschaften mit Landrechten auszustatten, stellt Ströbele-Gregor klar heraus. Zurecht weist sie darauf hin, dass es beispielsweise in einigen Schutzgebieten Konflikte mit dort ansässigen indigenen Völkern gibt. Denn aufgrund von Landmangel im Hochland wurden und werden zum Teil auch weiterhin Indigene in eigentlich geschützte Gebiete geschickt. Abschließend widmet sich die Autorin umfassend den Konflikten mit den Tieflanddepartements. Auch sie konstatiert, dass die Gräben zwischen den Lagern bestehen bleiben. Das liest man fast bei jedem Aufsatz.
Auch bei Andreas Hetzer, der einen kundigen Überblick über die Mediensituation des Landes gibt, in dem das Radio das Leitmedium ist, da es billig ist und die meisten Menschen erreichen kann. Schon früher gab es dabei kommunale Stationen, die heute stärker gefördert werden, um den Medien der Oligarchen entgegen zu treten. Interessant ist dabei, dass die Medien mit Ausnahme der großen Fernsehsender in Bolivien allgemein Probleme haben, sich selber zu finanzieren. Dass sie vor allem den Interessen ihrer Inhaber dienen sollen, verwundert (nicht nur) deshalb kaum. Wenn es den Privatsendern und den privaten Medien zudem zumindest teilweise darum geht, „den politischen und sozialen Gegner Evo Morales als Person abzuwerten und ein Klima der politischen und sozialen Instabilität zu inszenieren“ (S. 179), was nicht einmal in den liberalsten Medientheorien als Aufgabe von Journalismus beschrieben wird, dann muss man den Freiheitsbegriff von Hetzer hinterfragen, für den er sich am Ende seiner Ausführungen einsetzt (S. 184). Denn solcherart Freiheit dürfen Medien zumindest in Deutschland nicht haben, Hochverrat und Schmähkritik wird verfolgt. Das sollte auch in Bolivien zur Normalität werden. Den Zensur-Schrei der Oligarchen muss man aushalten und argumentativ abwehren.
Die letzten beiden Beiträge des Buches befassen sich mit der Außenpolitik, die für ein kleines und armes Land wie Bolivien von besonderer Bedeutung ist. Dass sich die Beziehungen zu den USA vor allem über die Drogenpolitik definieren, diese aber von den Vereinigten Staaten nur als Druckmittel verwendet wird – Peru und Kolumbien haben als engste Verbündete weniger Erfolge aufzuweisen als das in Washington mittlerweile verbrämte Bolivien – macht Bettina Schorr klar. Ihr Aufsatz ist ebenso wie der von Mitherausgeber Stefan Schmalz über die außenpolitische Umorientierung des Landes ein solider Überblick geworden. Beide stellen heraus, dass die Entwicklung Boliviens nicht nur von inneren, sondern auch äußeren Faktoren abhängt – insbesondere von den Regierungen in Washington und Brasilia und der Wirtschaftsentwicklung Venezuelas. Gleichzeitig ist, so schreibt Schmalz sicher zurecht, die Verhandlungsmacht unter Morales gestärkt worden, was gerade bei einem so abhängigen Land wie Bolivien einiges heißt.
Eines wird nach dem intensiven Studium der Aufsätze dieses Bandes überdeutlich: Besser als die ständige Wiederholung der Ausgangslage, die zu Beginn der meisten Aufsätze steht, wäre dort eine klare Stellungnahme zum jeweiligen Standpunkt des Autors aufgehoben. Denn dass es diesen gibt, ist klar und sollten sich auch die Autoren selber vor Augen führen. Die neutrale Wissenschaft ist eine Erfindung derer, die ansonsten auch gerne von der Alternativlosigkeit des Sachzwangs eines neoliberalen Kapitalismus sprechen. Wenn man sich dessen bewusst ist und versucht, jeweils die Stoßrichtung der Aufsätze zu erkennen, dann kann man diesen materialreichen und in Teilen sicher auch streitbaren Band mit Gewinn lesen.
Tanja Ernst, Dr. Stefan Schmalz (Hrsg.): Die Neugründung Boliviens? Die Regierung Morales. Baden-Baden: Nomos (=Studien zu Lateinamerika, 1), 2009. 236 S., 34 Euro.
Bildquelle: Fernando Lugo APC