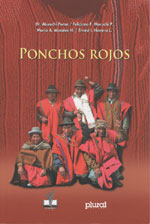Wenn in Cochabamba, Bolivien, eine ernst zu nehmende Debatte über den weltweiten Klimawandel stattfinden soll, müssen auch unsere eigenen Länder, die Länder Lateinamerikas, auf der Tagesordnung stehen. Globale und lokale Umweltethik müssen ineinandergreifen und es muss eine Betrachtung aller Sachverhalte von der Bewirtschaftung der Böden über die Entwaldung bis hin zur Rolle der Agrarexporte erfolgen.
Aus diesem Grund ist der Diskurs über die Rechte der Natur, wie er auch auf dem Treffen im bolivianischen Cochabamba angestrebt wird, ein Beitrag zur Umsetzung essentieller und radikaler Veränderungen hin zur Wertschätzung unserer Umwelt. Die derzeitige Umweltkrise lässt sich nicht nur auf ein Versagen der Technokratie oder auf Governance-Probleme zurückführen. Ihre Ursachen liegen tiefer und sind fest in einer Kultur verankert, deren Werte ausschließlich an Rentabilität und Nutzen gemessen werden. Der Aufruf zur Diskussion über die Rechte von „Mutter Erde“ regt eine andere ethische Haltung an, die Werte anerkennt, die in der Umwelt selbst liegen, unabhängig davon, ob sie für den Menschen nutz- oder gewinnbringend sind. Das mag einfach klingen, bedeutet aber einen radikalen Wandel bei der Herausbildung von Werten, der weitreichende Auswirkungen auf Wirtschaft und Politik haben wird.
Die Diskussion um die Rechte der Natur muss auf mehren Ebenen geführt werden. Es handelt sich sowohl um eine globale Angelegenheit, wie sie auf dem Gipfel in Cochabamba in Bezug auf den Klimawandel debatiert werden soll, als auch um ein Thema mit dringlichen Auswirkungen auf kontinentaler, nationaler und lokaler Ebene.
In letzter Zeit musste allerdings die Konzentration auf die klimatischen Veränderungen auf unserem Planeten als Vorwand für die Vernachlässigung letztgenannter Ebenen herhalten. Den offen zu Tage tretenden Umweltproblemen auf kontinentaler Ebene kommt nicht die nötige Aufmerksamkeit zu. In Südamerika betrifft das unter anderem die fortschreitende Entwaldung am Amazonas und in der Andenregion. Diese führt zu regionalen Veränderungen der Klimadynamik und ist wahrscheinlich einer der Faktoren, mit denen die veränderten Niederschlagsbedingungen auf der Atlantikseite des Cono Sur erklärt werden können.
Ebenso wenig dürfen die Umweltprobleme auf nationaler und lokaler Ebene aus dem Blickfeld geraten. Faktoren, die ernsthafte Folgen für die Umwelt haben, wie die Abholzung der Wälder, der extrem gestiegene Einsatz von Agrargiften oder die stark eingeschränkten Möglichkeiten bei der Müllentsorgung können nicht einfach übersehen werden.
Die einzelnen Ebenen sind eng miteinander verknüpft und in alle Bereiche spielt die Problematik der Umweltethik hinein. So haben die Abholzung der Wälder oder der vermehrte Anbau von Monokulturen – Maßnahmen, die einem utilitaristischen Ansatz entspringen – eindeutig lokale Auswirkungen, sind aber in Südamerika auch die Hauptursache für den Treibhauseffekt. Wenn also in Cochabamba eine ernst zu nehmende Debatte über den weltweiten Klimawandel stattfinden soll, müssen auch unsere eigenen Länder, die Länder Lateinamerikas, auf der Tagesordnung stehen. Globale und lokale Umweltethik müssen ineinandergreifen und es muss eine Betrachtung aller Sachverhalte von der Bewirtschaftung der Böden über die Entwaldung bis hin zur Rolle der Agrarexporte erfolgen. Wenn wir auf lokaler Ebene gegenüber der Umwelt blind sind, kann auf globaler Ebene keine neue Sichtweise auf die Rechte der Umwelt entstehen. Wird die Relevanz der lokalen Ebene erst einmal anerkannt, zeigt sich auch, dass der Beitrag der Bürgerinitiativen unverzichtbar ist, denn sie sind es, die die Situation der Umwelt am aufmerksamsten beobachten, Widersprüche in der Umweltpolitik aufdecken und den notwendigen Brückenschlag zwischen lokaler, nationaler und globaler Ebene ermöglichen. Damit wird absolut nachvollziehbar, dass in Cochabamba Organisationen wie der Indígenarat CONAMAQ und andere Bürgerinitiativen ihre Besorgnis um die Umwelt zur Sprache bringen wollen.
Die Auseinandersetzung mit den „Rechten der Natur“ – Bestandteil des Mottos, unter dem zur Konferenz aufgerufen wurde – lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die sozialen und ökologischen Folgen des Bergbaus, auf die Erdförderung oder auf die Pläne zur Errichtung von hydroelektrischen Staudämmen im Amazonasgebiet.
Vielen politischen Strömungen fällt es schwer, sich von den alten Vorstellung der Landaneignung und -nutzung zu verabschieden, wie sie sich typischerweise in den derzeitigen Plänen zur Förderung von Bodenschätzen wiederfinden. Über die Rechte der Natur zu reden, ist einfach; wenn es aber daran geht, die Appelle in die Praxis umzusetzen, regt sich regelmäßig starker Widerstand. Das erklärt auch, warum es einfacher ist, einen entsprechenden Diskurs auf globaler Ebene anzuregen oder die Fehler anderer Ländern aufzuzeigen. Allerdings gelingt es nicht, die alltäglichen Probleme auf nationaler und regionaler Ebene mit dem gleichen Elan anzupacken.
Doch nicht nur die CONAMAQ und einige Umweltaktivisten setzen auf den beharrlichen Druck der Zivilgesellschaft: Genau die gleichen Spannungen können auch in anderen Ländern beobachtet werden. In Ecuador macht derzeit zum Beispiel der Indígena-Dachverband CONAIE immer wieder auf die Pläne der koreanischen Regierung aufmerksam, die die Förderung von Bodenschätzen ausbauen will, während sich in Brasilien eine breite Koalition aus Bürgerinitiativen, Kleinbauern und Indígenas den Mega-Staudammprojekten im Amazonasgebiet entgegenstellt. Ähnliche Bewegungen existieren in den anderen Ländern Lateinamerikas – jeweils mit den ihnen eigenen, nationalen Besonderheiten.
Ecuador ist bisher das einzige Land, das konkretere Schritte hin zu einer Anerkennung der Rechte der Natur unternommen hat, so wie es in der neuen Verfassung des Landes festgeschrieben ist. Aus eben diesem Grund überrascht es nicht, dass die Diskussion in Ecuador mannigfaltiger, die Debatten intensiver und die Spannungen offensichtlicher sind.
In den Regierungen aller Länder gibt es immer wieder Widerstände gegen eine neue Umweltethik. Ein augenfälliges Beispiel dafür ist die Reaktion Evo Morales auf die Forderungen nach einer offenen Diskussion in Cochabamba. So warnte er davor, dass sich die Indígenas vom weltweiten Kapitalismus vor den Karren spannen lassen und entschied letzen Endes, dass nationale Themen in Cochabamba außen vor bleiben.
Die Behauptung, dass indigene Organisationen und andere Bürgerinitiativen einen Raubtierkapitalismus befürworten oder Teil eines internationalen Komplotts sind, ist unhaltbar. Schon an ihrer Geschichte und ihren Kämpfen ist klar und deutlich ersichtlich, dass diese Organisationen andere Ziele haben.
Mehr noch, in einer Zeit, die geprägt ist von politischem Umbruch und fortschrittlichen Regierungen, zeigt sich, dass umweltpolitische Forderungen mit Argumenten und effektiven Maßnahmen unterlegt werden müssen, und nicht nur Worthülsen sein dürfen. Ein derartiger Diskurs ist kontraproduktiv. Da es keine überzeugenden Argumente mehr gibt, die Bergbaustrategien der Vergangenheit weiterzuverfolgen, und auch andere, weiterreichende Vorschläge nicht fruchten, scheint es beinahe, dass man auch den konservativen Kreisen nicht mehr Recht gibt, die immer wieder anführen, dass die linke Regierung eigentlich kein anderes Entwicklungsprogramm vorzuweisen hat als die Schaffung verschiedenster Hilfsprogramme und Sozialleistungen.
Außerdem scheint es einfacher, die ökologischen Folgen der Bergbau- und Erdölindustrie von Alan García in Peru oder der Regierung Alvaro Uribe in Kolumbien zu hinterfragen als die selben Themen in Bezug auf Evo Morales, Lula da Silva in Brasilien oder Rafael Correa in Ecuador zu diskutieren.
Auch fehlen die Stimmen nicht, die behaupten, dass man es den Umweltschützern ohnehin nie Recht machen kann, dass sie alles kritisieren und unfähig sind, die fundamentalen Veränderungen anzuerkennen, die bisher von den progressiven Strömungen unternommenen wurden. Viele dieser politischen Veränderungen sind real, und nicht wenige wurden mit der effektiven Unterstützung der Umweltaktivisten erzielt, die als Teil der gesellschaftlichen Bewegung zu eben diesem Wandel beigetragen haben.
Aber die Bedrohungen für die Umwelt, und insbesondere die Widerstände gegen eine Anerkennung der Rechte der Natur, zeigen sich nicht nur in den Regierungsprogrammen. Sie wurzeln viel tiefer, denn sie gehen auf einen Entwicklungsstil zurück, der anthropozentristische und utilitaristische Werte verteidigt.
Die Naturethik richtet sich gegen die Vorstellung vom materiellen Fortschritt – und diese „grüne Kritik“ ruft starken Widerstand hervor. An dieser Stelle können die Worte eines berühmten Manifestes aufgegriffen und neu gestaltet werden: Man könnte sagen, dass das Gespenst der ökologischen Krise in der Welt umgeht, die Rechte der Natur mit einer so umfassenden Radikalität vertreten werden, dass die Anhänger des alten Entwicklungsstils sich zu einer Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet haben, seien es die Präsidenten der alten Garde oder die neuen Regierungschefs.
Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie die Umweltbewegung von allen möglichen Seiten attackiert wird. Die einen bezeichnen sie als zu radikal, die anderen als konservativ, wieder andere halten sie für utopisch und weitere verurteilen sie als Bremse für den Fortschritt.
Das zeigt, dass die Diskussion um die Rechte der Natur mit viel tiefer gehenden Auseinandersetzungen verbunden ist als gemeinhin angenommen. Genau aus diesem Grund ist eine offene und pluralistische Debatte wichtig, in die Themen hineinspielen wie die Neudefinition von sozialer Gerechtigkeit und deren Ausweitung auf das Gebiet des Umweltschutzes oder die Suche nach Entwicklungsalternativen für eine Zeit nach dem Bergbau unter einer neugestalteten Politik.
In einer solchen Debatte müssen auch die Bürgerorganisationen gehört werden. So darf insbesondere beim Treffen in Cochabamba eine echte Auseinandersetzung mit den Rechten der Natur nicht nur vom globalen Fokus aus erfolgen. Stattdessen muss sie auch die lokalen Probleme einbeziehen, denn auch auf diesem Weg kann sich bei den Bürgern ein neues ökologisches Bewusstsein herausbilden.
Diese und weitere Diskussionen werden unbequeme Themen zur Sprache bringen. Allerdings sollte man davor keine Angst haben, denn eine neue Ethik kann nur entstehen, indem man mit alten Ideologien bricht, die fest in uns allen verankert sind.
Die Auseinandersetzung mit den Rechten der Natur impliziert einen radikalen Wandel der Entwicklungsstile – sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene. Wird eine dieser Ebenen ignoriert, verhindert das nicht nur eine Entwicklung auf der anderen, sondern macht auch eine echte Veränderung unserer Beziehung zur Natur unmöglich.
* Eduardo Gudynas forscht am lateinamerikanischen Zentrum für Soziale Ökologie (CLAES) – www.ambiental.net
————————–
Übersetzung aus dem Spanischen: Franziska Pfab
Mit freundlicher Genehmigung von Bolpress. Der Artikel erschien am 18.04.2010.