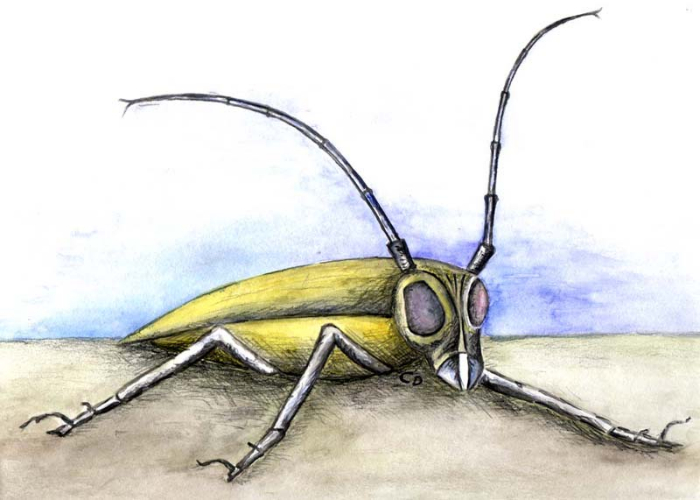Staub unter der Lupe
Die Aufklärung macht den ubiquitären Staub zum Gegenstand der Naturwissenschaften. Der Physiker und Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg sah 1778 bei Versuchen mit einem Elektrophor genannten Apparat, mit dem sich eindrucksvoll elektrische Funken erzeugen ließen, wie sich der auf der Isolatorplatte des Geräts liegende Staub zu baumartigen, fraktalen Strukturen, den so genannten Lichtenberg-Figuren, formte. Aber was die Wissenschaftler zu strenger Überprüfung von Hypothesen brachte, war auch ein grundlegender Skeptizismus, der im Menschen ein stets fehlbares Wesen sah. In seinem „Sudelbuch C“ (1772 – 1773 entstanden) notierte Lichtenberg, die Vanitas-Ikonografie aufnehmend: „Die Sand-Uhren erinnern nicht bloß an die schnelle Flucht der Zeit, sondern auch zugleich an den Staub, in welchen wir dereinst zerfallen werden.“
1849 konnte Christian Gottfried Ehrenberg, einer der Begründer der Mikrobiologie, das Wetterphänomen des Blutregens, der im Volksglauben als Zeichen drohenden Unheils galt, mit Passatstaub in Zusammenhang bringen. Aus einer Staubprobe, die ihm 1832 der britische Naturforscher Charles Darwin für seine Sammlung schickte, nachdem er sie vor den Kapverdischen Inseln an Bord der HMS Beagle von einem Segel gekratzt hatte, konnte der Berliner Forscher zahlreiche Schlussfolgerungen, u. a. aus den darin enthaltenen Mikroorganismen, ziehen.
Die Fortschritte in der Forensik führten ab Mitte des 19. Jahrhunderts dazu, das zu entmystifizierende Böse buchstäblich unter die Lupe zu nehmen. Ebenso wie kein Verbrechen übernatürliche Ursachen hat, gibt es auch keines ohne Spuren; es bedarf nur der Methoden und Perspektiven, diese zu erkennen. Arthur Conan Doyles Held, der ebenso geniale wie akribische Sherlock Holmes, wird zu einem popkulturellen Phänomen im Dienste des Positivismus. „Zweimal zog Holmes auf der Treppe seine Lupe heraus, um die Kokosmatte genau zu betrachten, welche die Stufen bedeckte. Ich sah nur den Staub, der darauf lagerte; er aber mochte wohl noch andere Spuren gewahren, denn er ging langsam von Stufe zu Stufe, hielt die Lampe niedrig und schoß scharfe Blicke nach links und rechts.“ Wie auf einem Palimpsest versteht es der Meisterdetektiv in „Das Zeichen der Vier“ (The Sign of the Four, 1890) das Skript des Tathergangs, die übereinanderliegenden Schichten separierend, dort zu dechiffrieren, wo andere nur unverständliches Krickelkrakel sehen. Er geht streng methodisch vor, wofür er mit seiner zu Drogensucht und Depression neigenden Persönlichkeit einen Preis zu zahlen hat.
Den unleugbaren Erkenntniszuwachs nicht in Abrede stellend kommt Robert Louis Stevenson – selbst aus einer schottischen Ingenieur- und Leuchtturmdynastie stammend – in seinem Essay „Pulvis et umbra“ (Pulvis et umbra, 1888) zu dem ernüchternden Ergebnis, dass der Mensch trotz allen Fortschritts moralisch wohl immer ein prekäres Wesen bleiben wird: „Was für ein ungeheurer Spuk ist der Mensch, nichts als eine Seuche zusammengeklebten Staubes … […] Was den Menschen im Eigentlichen ausmacht, ist, dass alle seine guten Absichten stets das Scheitern in sich tragen.“
Es scheint, als ob die faszinierende Erforschung des Staubs seine Funktion als Metapher der Endlichkeit keineswegs verdrängt, ja, diese geradezu zu bestätigen scheint, selbst wenn die Mikrobiologie inzwischen in der Lage ist zu erklären, warum und wie alles Lebendige am Ende zu Staub wird.
Der vergebliche Kampf gegen den Staub
Das Bürgertum der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte ziemlich genaue Vorstellungen, wie ein anständiges Leben zu führen sei, einem Regelwerk folgend, das schnell zum zermalmenden Räderwerk werden konnte. Mochte der Salon noch so penibel gesäubert sein, so waren Keller, Speicher oder Abstellraum die Orte der Un-Ordnung, denen man die schäbigen Teile des Inventars überließ. Entsprechend hatte das Bewusstsein seine staubigen, spinnwebverhangenen Räume, wo die geheimen Leidenschaften und die hinterhältigen Kalküle, die niederträchtigen Intrigen und die uneingestandenen Ängste ihr Unwesen trieben. Ein bedeutender Teil der Belletristik der Belle Époque handelt von Menschen, die vom Weg abgekommen zu Gefangenen der Konventionen und ihrer selbst werden.
In Charles Dickens Roman „Große Erwartungen“ (Great Expectations, 1860/61) friert Miss Havisham den Augenblick ihrer größten Demütigung ein, indem sie ihr Hochzeitszimmer in dem Zustand des Tages belässt, an dem sie von ihrem Bräutigam verlassen wurde: „Das Zimmer war geräumig und früher wohl hübsch gewesen; aber jeder wahrnehmbare Gegenstand war von Staub und Moder bedeckt und zerbröckelte langsam. Der auffallendste Gegenstand war ein langer Tisch, bedeckt mit einem Tischtuch, als wäre gerade ein Festessen vorbereitet worden, als die Uhren und alles im Haus stehenblieben.“
In William Faulkners Erzählung „Eine Rose für Emily“ (A Rose for Emily, 1930) vergiftet die stolze Südstaatentochter Miss Emily Grierson den Yankee Homer Barron mit Arsen, weil er sie nicht zur Frau hat nehmen wollen. Diese „Southern Gothic Tale“ steht in der Tradition der angelsächsischen Schauerliteratur, verzichtet aber auf Spekulationen über Übernatürliches und lenkt den Blick mit kühlem Realismus auf das Gruselige, das entsteht, wenn Menschen die Tatsachen des Lebens inklusive Tod nicht akzeptieren wollen. Emily weigert sich ihrem Auserwählten die Freiheit zu geben und zwingt mit ihrer makabren Tat dem herbeigesehnten Liebesverhältnis die gewünschte Dauerhaftigkeit auf. Sie gehört zur Dixieland-Oberschicht und pocht auf ihre Privilegien, auch wenn diese das Ergebnis eindeutiger Rechtsbeugung sind. So besteht sie darauf, keine Steuern bezahlen zu müssen, ein Vorrecht, das eine neue, um moderne, aufgeklärte Strukturen bemühte Generation eigentlich mit aller Konsequenz ahnden müsste. Doch diese mit dem kollektiven „wir“ bezeichnete Mehrheit begnügt sich damit eine Delegation in Emilys „Haus voll Staub und Schatten“ zu schicken. Hier wird der Übergang zweier Bedeutungen des Wortes „vergehen“ (gegen Regeln verstoßen vs. absterben, dahinscheiden) im A mbiente sinnlich manifestiert. „Es roch nach Staub und unbenützten Räumen – ein dumpfiger, modriger Geruch. Der Neger führte sie in einen Salon mit schweren Ledermöbeln. Als er die Stores an einem Fenster hochzog, konnten sie sehen, wie brüchig das Leder war, und als sie sich niederließen, stieg um ihre Schenkel ein feiner, träger Staub auf und kreiselte mit langsamen Sonnenstäubchen durch den einzigen Sonnenstrahl.“ Die Hauseigentümerin erscheint. „Ihre Haut sah aufgedunsen aus wie bei einer Leiche, die lange in stagnierendem Wasser gelegen hat, und zeigte die gleiche Blässe.“ Doch der Vorstoß der besorgten Bürger, die im Erzählgeschehen fast wie ein antiker Chor wirken, bleibt halbherzig und die Obrigkeit schreckt auch, als sich Miss Griersons Nachbarn über einen penetranten Geruch beschweren, vor Maßnahmen zurück. Der Bannkreis, den Emily um ihr Leben gezogen hat, fällt erst mit ihrem Tod, als man ein verschlossenes Zimmer aufbricht und damit die Ruhe des liegenden Staubes stört: „Die Gewalt, unter der die Tür niederbrach, schien das Zimmer mit alles durchdringendem Staub zu erfüllen. Ein dünner, ätzender Grabeshauch schien gleich einem Leichentuch über dem ganzen Zimmer zu liegen, das wie ein Brautgemach geschmückt und ausgestattet war: über den Bettvorhängen in verblichenem Rosenrot, über den rosig abgeschirmten Lämpchen, auf dem Frisiertisch, auf dem elegant angeordneten Kristall und den männlichen Toilettengegenständen mit ihren dunkel angelaufenen Silberrücken – so dunkel angelaufen, daß das Monogramm unkenntlich war. Dazwischen lagen ein Kragen und eine Krawatte, als ob sie gerade erst abgelegt worden wären, und als man sie aufhob, hinterließen sie im Staub einen bleichen Sichelmond. Auf einem Stuhl hing, sorgsam gefaltet, der Anzug; darunter standen die beiden stummen Schuhe und die abgestreiften Socken.“
mbiente sinnlich manifestiert. „Es roch nach Staub und unbenützten Räumen – ein dumpfiger, modriger Geruch. Der Neger führte sie in einen Salon mit schweren Ledermöbeln. Als er die Stores an einem Fenster hochzog, konnten sie sehen, wie brüchig das Leder war, und als sie sich niederließen, stieg um ihre Schenkel ein feiner, träger Staub auf und kreiselte mit langsamen Sonnenstäubchen durch den einzigen Sonnenstrahl.“ Die Hauseigentümerin erscheint. „Ihre Haut sah aufgedunsen aus wie bei einer Leiche, die lange in stagnierendem Wasser gelegen hat, und zeigte die gleiche Blässe.“ Doch der Vorstoß der besorgten Bürger, die im Erzählgeschehen fast wie ein antiker Chor wirken, bleibt halbherzig und die Obrigkeit schreckt auch, als sich Miss Griersons Nachbarn über einen penetranten Geruch beschweren, vor Maßnahmen zurück. Der Bannkreis, den Emily um ihr Leben gezogen hat, fällt erst mit ihrem Tod, als man ein verschlossenes Zimmer aufbricht und damit die Ruhe des liegenden Staubes stört: „Die Gewalt, unter der die Tür niederbrach, schien das Zimmer mit alles durchdringendem Staub zu erfüllen. Ein dünner, ätzender Grabeshauch schien gleich einem Leichentuch über dem ganzen Zimmer zu liegen, das wie ein Brautgemach geschmückt und ausgestattet war: über den Bettvorhängen in verblichenem Rosenrot, über den rosig abgeschirmten Lämpchen, auf dem Frisiertisch, auf dem elegant angeordneten Kristall und den männlichen Toilettengegenständen mit ihren dunkel angelaufenen Silberrücken – so dunkel angelaufen, daß das Monogramm unkenntlich war. Dazwischen lagen ein Kragen und eine Krawatte, als ob sie gerade erst abgelegt worden wären, und als man sie aufhob, hinterließen sie im Staub einen bleichen Sichelmond. Auf einem Stuhl hing, sorgsam gefaltet, der Anzug; darunter standen die beiden stummen Schuhe und die abgestreiften Socken.“
Der Staub hält die Krawatte, die als beweisträchtiges Symbol – fein säuberlich arrangiert, wie es sich gehört – wahnhaft die Rechtmäßigkeit der Ehe bedeuten soll, wie auf einer Fotografie als Silhouette fest. Doch dem Stilleben (nature morte) fehlt noch der Bräutigam: „Der Mann aber lag im Bett. […] Der Körper hatte offensichtlich einst in liebender Umarmung gelegen […]. Was von ihm noch übrig war, was verwest war unter den Resten des Nachthemds, war vom Bett, auf dem er lag, nicht zu trennen; und auf ihm und auf dem Kissen neben ihm lag der gleichmäßige Überzug geduldigen und beharrlichen Staubes.“
Der Staub deutet auf den Riss in der Biografie, das Trauma sowie die eingefrorene Zeit, er steht für Verfall und Auflösung. Da es dem Menschen letztlich unmöglich ist, die Zeit wirklich anzuhalten, kann, wenn dies versucht wird, das Resultat kein bewahrendes, sondern nur ein zerstörerisches sein.
Anders in dem Grimmschen Märchen von der schönen Königstochter „Dornröschen“ (1812), die, als ein Königssohn sie aus ihrem hundertjährigen tiefen Schlaf erweckt, so jung und schön ist wie zu dem Zeitpunkt, als sie sich ein Jahrhundert zuvor an der Spindel gestochen hatte. In seinem Eintrag zum Thema „Staub“ in dem von ihm zusammen mit u. a. Carl Einstein, Michel Leiris und Marcel
Griaule verfassten Kritischen Lexikon (1929) merkt Georges Bataille hierzu treffend an: „Die Märchenerzähler haben sich nicht vorgestellt, daß Dornröschen von einer dichten Schicht Staub bedeckt erwachen würde; auch haben sie nicht an die düsteren Spinnweben gedacht, die mit der ersten Bewegung ihrer roten Haare zerrissen worden wären.“
Die Jungfer Züs Bünzlin in Gottfried Kellers Groteske „Die drei gerechten Kammacher“ aus der Sammlung „Die Leute von Seldwyla“ (1856) ist ein Beispiel für jene, für die der Liebe eine ökonomische Bedeutung zukommt und die eingehüllt in ihre Selbstgerechtigkeit sich gänzlich auf der Seite des öffentlich gebotenen Konventionellen zu befinden wähnen. Stets „war sie sorgsam und reinlich angezogen, und ebenso sauber und aufgeräumt sah es in der Stube aus.“ Ihre wenigen Bücher, die sie wie einen Schatz hütet, kennt sie auswendig und weiß deren Inhalt zu salbungsvollen Halbweisheiten zusammenstellen, so dass sich ein armer und naiver Buchbindergehilfe in Bewunderung verfallend in sie verliebt. Sie dagegen hält ihn auf Distanz und meidet so jeden Anflug von Leidenschaft. Als Zeichen seiner Zuneigung baut der Geselle für die Jungfer das Modell eines chinesischen Tempels, der mit allerhand Geheimfächern, Schubladen und Vorrichtungen für eine Damenuhr und eine Goldkette versehen ist, Schmuckstücke, die seiner Angebeteten zu schenken seine finanziellen Möglichkeiten bei Weitem überschreiten. Damit ist der Buchbinder disqualifiziert und die Züs gibt ihm den Laufpass. Während de facto die Ökonomie über seine zweifelsohne ehrliche Liebe siegt, wird das Papptempelchen als Gegenstand der Verehrung verklärt: „Sein Werk dagegen thronte seitdem auf Züsis altväterischer Kommode, von einem meergrünen Gazeschleier bedeckt, dem Staub und allen unwürdigen Blicken entzogen. Sie hielt es so heilig, daß sie es ungebraucht und neu erhielt und gar nichts in die Behältnisse steckte“. Auf diese Weise findet sie auch nicht den Liebesbrief, den der junge Mann in einem der Geheimfächer für sie versteckt hat.
Einer der bedeutendsten Antihelden der Weltliteratur, Iwan Gontscharows Gutsbesitzer Ilja Iljitsch Oblomow, erhebt Lethargie und Initiativlosigkeit zum Lebensprinzip. Sein Verhalten wird im Eingangskapitel des Romans „Oblomow“ (Oblomow, 1859) charakterisiert über das Ambiente, in dem er sich bewegt, vielmehr: in dem er unbeweglich auf dem Diwan liegt. Die Möbel in seinem Zimmer werden „dank der dort herrschenden Verwahrlosung und Unordnung“ wie in einer Kippfigur zum Gerümpel. „An den Wänden und Bildern klebten staubbedeckte Spinngewebe […]. Statt die Dinge widerzuspiegeln, hätten die Spiegel eher als Tafeln dienen können, auf deren staubige Fläche man beliebige Notizen machen konnte.“ Der Staub verwandelt das Zimmer in einen gespenstischen Abstellraum, in dem der Protagonist sich selber deponiert hat: „Wäre der Teller nicht dagewesen und die ans Bett gelehnte, eben erst ausgerauchte Pfeife oder der Hausherr selber […] so hätte man glauben können, daß hier niemand wohnte – so sehr war alles verstaubt, verblichen und überhaupt frei von allen frischen Spuren, die auf die Anwesenheit eines Menschen hätten schließen lassen können.“ Die Schreibstube Oblomows, der sich dem zeitgenössischen bürgerlichen Elan verweigert, zeigt in so gar keiner Weise den Fortschritt an, der sich auf die Anforderungen des Hier und Jetzt bezieht: „die aufgeschlagenen Buchseiten waren mit Staub bedeckt und vergilbt; […] die Nummer der Zeitung datierte vom vorigen Jahr“. Der liegende Staub, der sich hier überall ungestört hat ansammeln dürfen, versinnbildlicht die Untätigkeit: Der Tagträumer Oblomow, das Gegenteil eines Entrepreneurs, lässt die Zeit verstreichen statt sie gemäß der Maxime Zeit ist Geld zu nutzen.
Der Journalist Hip OʼHopp aus dem Roman „Mitternachtspost“ (Midnight Examiner, 1989) des Amerikaners William Kotzwinkle ist auf seine Weise der sprichwörtlichen Oblomowerei verfallen. Allerdings stellt seine Verwahrlosung den Tiefpunkt einer sozialen Abwärtsspirale dar, für die sein hoher Alkoholkonsum Symptom und Ursache zugleich ist. „Hips Biographie spiegelte Niedergang und Bankrott einer Vielzahl von New Yorker Zeitungen wider, von der großen Herald Tribune über Journal American und Telegraph and Sun bis hinunter zum Daily Mirror.“ Zu Beginn des Romangeschehens ist er Redakteur bei Chameleon Publications, wo seine Aufgabe – wie auch die seiner Kollegen – darin besteht, sich Sensationsmeldungen für die verschiedenen Produkte des Hauses auszudenken. Sein Umgang mit der Wahrheit folgt seinem gesellschaftlichen Abstieg: „Ein paar feuchtfröhliche Jahre lang hatte er einen Redakteursposten bei der New York Times bekleidet, und zeit seines Lebens hatte er sich die Hacken abgelaufen, Straßen abgeklappert, Polizeireviere und die Flure der Stadtverwaltung belagert, um die Fakten zu recherchieren. Jetzt, in der Dämmerung seiner Karriere, erfand er die Fakten.“ Hip hat aufgehört die Wirklichkeit zu respektieren, die er früher aus erster Hand gewissermaßen ungefiltert zu erfassen und wiederzugeben angetreten war. Die in seinen vier Wänden „kreuz und quer durcheinander liegenden Enzyklopädien, Wörterbücher und anderen Nachschlagewerke, alle voller Eselsohren, übersät mit Tintenklecksen und Kaffeeflecken“ sind Relikte aus besseren Tagen, in denen er noch einem ethischen Journalismus verpflichtet war. Hips Wohnung befindet sich in einem Skelettierungsprozess, einem ans Eklige, Schlangenartige grenzenden Übergang zum Verfall. „Ihr auffälligstes Merkmal war die Decke – die Farbe hing in abgepellten Zungen herab, manche fast einen halben Meter lang. Es sah aus, als würde sie sich aus der Haut schälen. Hip fing meinen Blick auf. ‚Nachts, wenn ich schnarche, fallen mir die Farbfitzel in den Mund.‘“
Aber es gibt eine Ordnung im Chaos, die sich dem Außenstehenden nicht erschließt: „ ,Wieso läßt der Vermieter das nicht richten?‘ ,Er hat es mir angeboten, aber da müßte ich mich erst mal der enorm komplizierten Frage widmen, wie ich den ganzen Krempel raus in den Flur schaffe.‘ Er deutete auf einen rissigen Ledersessel, umgeben von den vergilbten Ausgaben längst eingegangener Zeitungen, die sich in windschiefen Stößen bis zur Decke stapelten. ,Ich würde nie wieder alles in die alte Reihenfolge kriegen.‘“
Der Staub in Hips Apartment ist anders als der, der Oblomows Zimmer wie ein bleischweres Leichentuch bedeckt. Er ist agil und aufgewirbelt und deutet darauf hin, dass für Hip noch nicht alle Hoffnung verloren ist, was sich spätestens gegen Ende des Romans herausstellen wird. „Das größte Staubknäuel, das ich je sah, hob sich sachte vom Boden, als wir an ihm vorbeigingen. ,Ein Haustierchen‘, sagte Hip, und wahrhaftig schien ihm das Ding treu durch den Raum zu folgen.“
In Walter Scotts Roman „Der Alterthümler“ (The Antiquary, 1816) erntet ein Dienstmädchen, das auf Anordnung von Herrn Oldbucks Nichte sein „sanctum sanctorum“ saubermacht, nichts als Undank, als der Alterthümler die beiden jungen Frauen dabei ertappt. Nachdem sie sich schnell entfernt haben, erklärt der erboste und zur Misogynie neigende Mr. Oldbuck seiner Begleitung: „Ich versichere Ihnen, Herr Lovel, daß der letzte Einbruch dieser Freundinnen der Reinlichkeit hier meiner Sammlung im höchsten Maße verderblich gewesen ist.“ […] „Sie werden schier vergiftet werden von den Staubmassen, die sie aufgewirbelt haben,“ fuhr der Alterthümler fort, „aber ich versichere Ihnen, der Staub war vor einer Stunde noch steinalter, friedvoller, stiller Staub und wäre es hundert Jahre lang geblieben, wenn nicht Hexen ihn aufgestört hätten, so wie sie alles auf der Welt aus der Ruhe bringen“.
Auxilio Lacouture, Ich-Erzählerin in Roberto Bolaños Roman „Amuleto“ (1999), ist eine uruguayische Dichterin. Seit 1965 hält sie sich illegal in Mexiko DF auf, wo sie schnell zum Mittelpunkt der jungen Literaturszene avanciert. Ihr Dasein fristet sie mit kleinen Jobs. So dient sie sich bei den exilierten spanischen Poeten und Antifaschisten León Felipe und Pedro Garfias als Zugehfrau an und stürzt sich in die Arbeit „mit der Leidenschaft einer Dichterin und der schrankenlosen Hingabe einer englischen Krankenschwester“. Als sie Fenster und Fußböden putzend und fegend zu Leibe rückt, protestieren die beiden Dichter: „Auxilio, sagten sie, hör auf, die Wohnung auf den Kopf zu stellen. Auxilio, laß diese Papiere in Ruhe, Frau! Literatur und Staub gehören nun mal zusammen.“
Am Beginn ihrer Aufzeichnungen hatte Auxilios Gedächtnis ihr den Dienst verweigert, als es um die Zeit ihrer Wanderschaft über den halben lateinamerikanischen Kontinent und die damit einhergehenden Fakten („warum, wie, wann“) ging. Der Mahnruf der Spanier bringt Auxilio Lacouture, die nicht nur Helferin ist, sondern auch Worte schneidert, ihre Erinnerung zurück: „Dann sah ich sie mir lange an und dachte, wie recht sie doch hatten, es lebe der Staub, es lebe die Literatur“.
In einer Art Vision rekonstruiert sie auf einer poetischen Basis den Zusammenhang: So „stellte ich mir wunderbare und traurige Dinge vor, ich stellte mir vor, wie sie da standen, still in den Regalen, die Bücher, und ich stellte mir den Staub der ganzen Welt vor, wie er in die Bibliotheken kroch, langsam, aber unaufhaltsam, und ich verstand, daß das leichte Beute für ihn war, die Bücher, ich sah Staubwirbel, Staubwolken, die sich in einer Pampa irgendwo am Grunde meiner Erinnerung materialisierten, und die Staubwolken bewegten sich in Richtung Mexiko DF, die Wolken meiner höchst persönlichen Pampa, unser aller Pampa, obwohl viele sie nicht zu kennen behaupten, und so überzog sich alles mit Staub, die gelesenen Bücher und die, die ich noch lesen wollte“.
Die Bücher sind das Medium, individuelles Erleben zu kollektivem zu transformieren. Der Staub der Pampa, der Landschaft ihrer Heimat, und die Quelle ihrer Erinnerung treibt sie nach Mexiko zu den Dichtern, in deren Bibliothek er sich auf ewig manifestiert. Und einmal mehr ist er stärker als alle die Putzkolonnen: „…und es gab nichts mehr zu tun dort, ich konnte noch so sehr fuchteln mit Besen und Staubwedel, er ging nicht mehr weg, der Staub, denn er war ein Teil der Bücher geworden, und dort lebten sie ihr Leben oder sowas ähnliches.“
Aber der Dichter erkennt, zumal als Melancholiker, dass der Staub Grauenhaftes zugleich zudecken wie präsentieren kann. Auch Auxilios Geschichte ist – so warnt sie den Leser bereits in der ersten Zeile – „eine echte Horrorgeschichte“ .
Ähnlich einem jener Reisebücher, wie sie im 19. Jahrhundert populär wurden, werden die Erlebnisse des tüchtigen Engländers Jonathan Harker mit dem transsylvanischen Grafen Dracula, dem Untoten und Inkarnation des Bösen in Bram Stokers Vampirroman „Dracula“ (Dracula, 1897) eingeleitet. Vor dem Antritt der Reise auf den Balkan studiert Harker im British Museum Bücher über die Einheimischen und einschlägiges Kartenwerk. Selbstverständlich führt er ein Reisetagebuch. Nach seiner Ankunft wird ihm allmählich klar, dass er ein Gefangener im Schloss des merkwürdigen Grafen ist, zu dem ihn eine trockene juristische Angelegenheit geführt hat. „Die Fenster waren ohne Vorhänge; das gelbe Mondlicht flutete breit durch die geschliffenen Scheiben und man konnte sogar Farben erkennen. Dabei machte es den Staub, der über allem lag, weniger bemerkbar und verwischte einigermaßen die Spuren der Zeit und der Motten. […] Ich war nicht allein; das Zimmer war dasselbe, völlig unverändert, genau so wie ich es betreten hatte; ich konnte am Boden entlang meine Fußspuren sehen, die ich in die langjährige Staubschicht getreten hatte. Im Mondlicht standen mir gegenüber drei Frauen“, deren „wohlberechnete Wollüstigkeit“ den Viktorianer zum letzten Mittel greifen lassen: „Dann überwältigte mich das Grauen und ich verlor das Bewußtsein.“
In der Erzählung „Eveline“ aus dem Band „Dubliner“ (Dubliners, 1914) von James Joyce versucht eine junge Frau den Ausstieg aus ihrem bisherigen Leben, einen Schritt, vor dem sie allerdings in letzter Konsequenz wie paralysiert zurückschreckt. „Sie saß am Fenster und sah zu, wie der Abend in die Straße eindrang. Ihr Kopf war an die Fenstervorhänge gelehnt, und in ihrer Nase war der Geruch von staubigem Kretonne. Sie war müde.“ Das strapazierfähigere Baumwollgewebe Cretonne kann als das kleinbürgerliche Pendant zum Plüsch der Bourgeoisie gelten. So wie der Blick aus dem Fenster die Hoffnung auf die Änderung von Evelines tristem Leben bedeutet, steht der offenbar nicht entfernbare Staubgeruch für die Beharrlichkeit sozialer Verhältnisse. „Elternhaus! Sie blickte sich im Zimmer um, musterte alle seine vertrauten Gegenstände, die sie so viele Jahre lang einmal die Woche abgestaubt hatte, und fragte sich, wo in aller Welt der ganze Staub bloß herkomme.“ Die junge Frau ahnt die Sinnlosigkeit ihres Vorhabens, der Herrschaft ihres gewalttätigen Vaters entkommen zu wollen, indem sie sich der eines Ehemanns beugt. Ihre Situation wird sich ebenso wenig verbessern wie sich der Staub aus der Wohnung entfernen lässt. „Ihre Zeit wurde allmählich knapp, aber sie blieb weiter am Fenster sitzen, lehnte den Kopf an den Fenstervorhang und atmete den Geruch von staubigem Kretonne ein.“
Außenseiter und deren andere, bisweilen bizarre Sicht auf die Welt sind ein häufiges Motiv der Erzählungen von William Kotzwinkle. In den ersten Zeilen seiner Kurzgeschichte „Der Pförtner“ (The Doorman) aus der Sammlung „Elefant rammt Eisenbahn“ (Elefant bangs train, 1971) wird der lokale wie mentale Blickwinkel der Hauptfigur deutlich: „Charles saß am Fenster und schaute hinaus. Die Häuser draußen zogen Gesichter. Sieh nur, Charles, wir sind alt und brüchig. Unten auf der Straße bewegten sich langsam die Stein-Menschen, und Charles beobachtete sie sechstausend Jahre lang.“ Dem Fünfunddreißigjährigen ließen sich Ich-Störungen und Psychosen diagnostizieren. Dinge erscheinen ihm lebendig, Menschen erstarrt oder tot. Die zwanghafte Wiederholung bestimmter Bewegungsabläufe und das Zeitgefühl eines Vorschulkindes geben dem Krankheitsbild eine rituelle und mythische, surreale Dimension, er selbst wirkt wie ein retardierter verirrter Alien.
Die weitere Szenerie der Erzählung zeigt seine Mutter, die als kleinbürgerliche Hausfrau in permanentem Kriegszustand gegen den Staub steht und seinen Vater, der auf der Couch sitzt und nichts als seine Ruhe haben will. Mutters Strategie im Umgang mit der Verrücktheit ihres Sohnes besteht in einer dumpfen Kontradiktion: „Nimm die Füße hoch“, sagte Mutter, die auf ihrem Fusselstab herumritt. „Ich rede gerade mit den Häusern“, sagte Charles. „Nein, das tust du nicht, Liebling, nimm die Füße hoch, damit Mutter saubermachen kann.“ Mit der gleichen Vergeblichkeit, wie sie den Absurditäten ihres Sohnes widerspricht, bekämpft sie den Staub, auch wenn dieser sich niemals beseitigen lässt. „Charles, du machst dich doch ganz staubig, obwohl ich, weiß Gott, heute morgen da drunter saubergemacht habe.“ Der in seinem Wahn gefangene Charles hat keinerlei Berührungsängste vor dem Schmutz. Der lustig durch die Luft wirbelnde Staub, dem er, wenn die Mutter putzt, gerne zuschaut, gefällt ihm und beflügelt ihn zu infantilerotischen Phantasien. „Mutter schwenkte den Fusselstab gegen die Staubies, die auf dem Fußboden wohnten und die nun im Sonnenlicht aufgewirbelt wurden. Eines hieß Susan und eines Betty Ann, und eine Carol war auch dabei, schmutzige Mädchen machen Pipi und Aa.“
Anders als der liegende steht der aufgewirbelte Staub für die Revolte gegen die festgefahrenen Verhältnisse. Die Rolle des Provokateurs, die insbesondere dem Künstler zukommt, gilt nicht selten als soziale Voraussetzung für neue Erkenntnisse. In einem Eintrag aus dem Jahr 1926 in sein „Tagebuch“ (Journal, 1889 – 1939) stellt André Gide einen Zusammenhang zwischen Aufruhr und Erkenntnis her: „Ohne den Staub, worin er aufleuchtet, wäre der Sonnenstrahl nicht sichtbar.“ Das Licht hat demnach den Staub als Medium zur Voraussetzung, nur so kann es für den Menschen erkennbar und damit wirkmächtig werden. Allerdings bedarf es derer, die ihn gehörig aufwirbeln, nämlich solcher, die auf die Autorität pfeifen, Dinge radikal hinterfragen und Mut zu konsequenter Neugestaltung haben.
In der Erzählung „Die Sonne im Winter“ (The Sun in Winter) des Australiers David Malouf aus der Sammlung „Südlicher Himmel“ (Antipodes, 1985) flüchtet sich ein junger Tourist aus Down Under vor der klirrenden Winterkälte in die berühmte Brügger Liebfrauenkirche, wo ihm die Kombination aus aufgewirbeltem Staub und Sonne zu einer neuen Sicht verhilft.
Selbst zur Mittagszeit herrschte Dunkelheit in der Kirche. Zwischen den Pfeilern schichtete sich kaltes Sonnenlicht in schrägen Linien auf, welches leuchtenden Staub durchsickern ließ und zwar in solch einer Dichte, dass die Staubschicht fast schon wirklicher als der Stein zu sein schien. Ihm war als sähe er zwei Kirchen zugleich: eine tausendjährige, auf gotischen Spitzbögen sich gen Himmel reckende und winklig zur ersten eine aus Licht und Staub komponierte, die genau in dem Moment, wo sein Blick auf sie traf, von ihm neu erschaffen worden war.“
Auf der kognitiven Ebene wird, wenn auch nur für einen Augenblick, neben dem altehrwürdigen Gotteshaus, das längst im Katalog europäischer Kultur enthalten ist, eine zweite sichtbar. Ähnlich den Effekten des Kubismus, als das Dogma der Zentralperspektive fiel, wird das anders Wahrgenommene als etwas Neues erfasst. Die Kombination aus Licht und aufgewirbeltem Staub erreicht eine solche Intensität, dass ihr Substanz zugeschrieben wird. Dem kunsthistorisch gebildeten Australier, der den Kanon des Abendlandes kennt, kommt die Rolle des „Antipoden“ zu, also desjenigen, der dieses gänzlich Gegenteilige zu sehen in der Lage ist.
In der symbolischen Erzählung „Die Geschichte von dem Fräulein Staubkorn, der Sonnentänzerin“ (Historia de la señorita grano de polvo, bailarina del sol, 1915), mit der Teresa de la Parra auf die Stellung der Künstlerinnen in der lateinamerikanischen Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufmerksam machen wollte, ist die Korrelation von Staub und Licht die tragende Idee. Die Ballerina, ein gewöhnliches Staubkorn, bedarf des Sonnenlichts, um ihren anmutigen Drehungen vollen Ausdruck zu verleihen. An einem strahlend hellen Tag tanzt das grazile Fräulein buchstäblich aus der Reihe und wird von der Filzpuppe Jimmy, der sich unsterblich in sie verliebt hat, in dem Moment aufgefangen, als sie auf den Boden zu fallen droht. Die zierliche Ballerine erscheint ihm unendlich schön, doch „in das Halbdunkel zurückgekehrt“ verwandelt sie sich in „ein bedauernswertes und ungestaltes Dingelchen in einem trüben Grauton“, völlig reglos und plattgedrückt. Er sperrt sie, die er nun als „Mumie des Fräulein Staubkorns“ – ein weiteres Wesen aus dem Reich der Untoten – bezeichnet, in seine Brieftasche ein und macht sie zu seinem Besitz. Dem Vorschlag des Dichters, auf dessen Schreibtisch Jimmys Platz ist und dem er sich in dieser delikaten Angelegenheit anvertraut hat, Folge leistend, gibt er der Künstlerin die Freiheit und damit ihre Schönheit zurück, doch wird sie fast sogleich von einem hässlichen Insekt verschluckt.
In bürgerlichen Kreisen war und ist bis heute die Beseitigung des Hausstaubs für gewöhnlich ein dem Personal überlassenes Problem. In Georges Batailles Staub-Eintrag heißt es dazu: „Wenn die dicken Zimmermädchen, die für alles gut geeignet sind, sich allmorgendlich mit einem großen Staubwedel oder gar mit einem elektrischen Staubsauger bewaffnen, sind sie sich vielleicht nicht ganz darüber im Unklaren, daß sie genauso wie die positivistischsten Gelehrten dazu beitragen, schädliche Gespenster zu entfernen, die von Sauberkeit und Logik angewidert sind. Es ist wahr, daß früher oder später der Staub, der ja überdauert, wahrscheinlich anfangen wird, gegen die Bediensteten zu gewinnen, und dann in die ungeheuren Trümmer verlassener Gebäude und menschenleerer Lagerhäuser eindringt: Und in dieser fernen Zeit wird nichts weiter Bestand haben, das uns vor dem nächtlichen Grauen rettet, in dessen Abwesenheit wir zu so großartigen Buchhaltern geworden sind …“. Der nicht zu beseitigende Staub steht für die Vergeblichkeit des Strebens nach einer taxonomischen Ordnung, mit der alle Wissenschaft und Technik einhergeht. Gerade die Orte, die der  Systematisierung der Dinge gelten, Archive, Bibliotheken, also die Waffenkammern der Erkenntnis, haben besonders darunter zu leiden. Eine begrifflich abgegrenzte Systematik und das Ungeformte des Staubs verhalten sich konträr zueinander.
Systematisierung der Dinge gelten, Archive, Bibliotheken, also die Waffenkammern der Erkenntnis, haben besonders darunter zu leiden. Eine begrifflich abgegrenzte Systematik und das Ungeformte des Staubs verhalten sich konträr zueinander.
In seinem Erinnerungsbuch „Berliner Kindheit um Neunzehnhundert“ (in den 1930er Jahren entstanden, 1950 postum veröffentlicht) beschreibt Walter Benjamin, wie sich das typische bürgerliche Domizil, die Stadtwohnung, dem Eigentümer bereits bei nur vorübergehender Abwesenheit entfremdet: „Mit ihren Teppichen, die eingerollt, den Lüstern, die in Sackleinwand vernäht, den Sesseln, die überzogen waren, mit dem Halblicht, das durch die Jalousien sickerte, gab sie, […] der Erwartung von fremden Sohlen, leisen Tritten Raum, die, vielleicht bald, über die Dielen schleifend, Diebsspuren in den Staub einzeichnen sollten, der seit einer Stunde gemächlich seine Niederlassungen bezog. Daher geschah es, daß ich jedesmal als Heimatloser aus den Ferien kam.“ Der Staub, der „gemächlich“, wenn unbeobachtet, die Macht ergreift, wird zum Zeugen des Angriffs auf den Besitz, der in hohem Maße der Repräsentation galt. Er steht für die Angst vor dem Bedeutungsverlust, die immer in den Hinterköpfen der Bürger lauerte. Beliebte Textilien scheinen dem Feind paradoxerweise einen strategischen Vorteil zu verschaffen: „Plüsch als Staubfänger. Geheimnis des in der Sonne spielenden Staubes. Der Staub und die ,gute Stube‘“ notiert Benjamin in „Das Passagenwerk“ (1927 – 1940 entstanden, 1982 veröffentlicht).
Lange Zeit war die Zimmerwirtin eine feste Größe im restaurativen, bundesrepublikanischen Nachkriegsdeutschland. Als Teil des kleinbürgerlichen Milieus spielt sie seit den 1970-er Jahren nur noch eine untergeordnete Rolle. Aber bis dahin hatte sie die Aufgabe, an Eltern statt für die Einhaltung von Sitte und Anstand zu sorgen. Was rein formal nichts als eine privatrechtliche Zimmervermietung war, erhielt so eine gesellschaftliche Implikation als Form der Sozialkontrolle.
In Gerhard Menschings Roman „Löwe in Aspik“ (1982) ist Silva, die Freundin des Erzählers, einem solchen Exemplar aus der Fauna aussterbender sozialer Phänomene ausgesetzt und nennt sie „Frau Wobbe, die staubfressende Gardinenschlange.“ Der wortspielerische Ausdruck hat deutliche biblische Bezüge: „Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens.“ (Gen. 3,14). Mit einem gewissen Schaudern und großer Befremdung beobachtet die junge Studentin die merkwürdigen Reinigungszeremonielle ihrer Vermieterin: „Jeden Morgen beugt sie sich weit aus dem geöffneten Schlafzimmerfenster und schüttelt ihre und ihres Mannes Nachtkleidung aus. Jedes Teil wird dann noch einmal gewendet und wieder ausgeschüttelt. Seltsamerweise sind das immer nur die Nachtsachen, niemals Pullover, Jacken oder Hosen. Offenbar sondert das Ehepaar nur während des Schlafens größere Mengen von Staub ab, der in der Wäsche haftet und morgens trotz des weiten Hinausbeugens beim Ausschütteln sich zu einem Teil in den Gardinen fängt, weshalb diese wöchentlich abgenommen und gewaschen werden müssen.“
Das Fenster trennt die staubanfällige, verborgene innere Seite des Hauses von der Licht und Luft versprechenden äußeren. Die Grenze, die beide Sphären separiert, wird näher markiert durch die Gardine, an der Frau Wobbe von „hysterischen Reinlichkeitsgeboten“ gezwungen ihre Waschhandlungen vollzieht. Dabei gehört der ewige und aussichtslose Kampf vielleicht einem nur imaginären Staub. Die Zwanghaftigkeit weist zudem auf die psychische Dimension in Frau Wobbes Tun: Auch die Begierde und die tatsächlichen oder vermeintlichen Regularien der Moral werden voneinander getrennt. Weil der Staub dem ebenso begehrenden wie moribunden Körper entstammt, löst er zugleich Angst aus. Das Sündhafte der Nacht kann nur bei Seite geschoben werden, indem man nicht nachlässt und das Ritual beständig wiederholt.
Eine von Julio Cortázars frühen Erzählungen „Das besetzte Haus“ (Casa tomada, 1951) handelt von einem Geschwisterpaar, das in seinem Haus in Buenos Aires in einem geregelten, fast idyllischen Verhältnis lebt, bis sie durch merkwürdige Geräusche geängstigt sich zunächst gegen den hinteren Teil ihres Domizils verbarrikadieren, um dann schließlich das „besetzte“ Gebäude fluchtartig zu verlassen. Der Aufrechterhaltung der Ordnung vor der Vertreibung aus dem Paradies dient zugleich das rituelle Reinigen der Räumlichkeiten: „Es ist ja unglaublich, wieviel Staub sich auf den Möbeln ansammelt. Buenos Aires mag eine saubere Stadt sein, doch das nur dank ihrer Einwohner und nicht ihres Namens wegen. Zuviel Schmutz in der ‚guten Luft‘, und kaum weht ein Lüftchen, schon legt sich der Staub auf den Marmor der Konsolen und zwischen die Kreuzstickereien der Tischdecken und man hat ihn an den Fingerkuppen; es macht viel Arbeit, ihn mit dem Staubwedel wegzukriegen, er fliegt auf, bleibt eine Weile in der Luft und legt sich dann von neuem auf Möbel und Klaviere.“ Der Einbruch des Unerklärlichen, der Riss, der eine scheinbar feste Ordnung zerstört, kündigt sich durch die Unbotmäßigkeit des Staubs an. Die Dinge, an denen die Protagonisten hängen, werden von ihm attackiert.
In „Hundert Jahre Einsamkeit“ (Cien años de soledad, 1967) erzählt Gabriel García Márquez die Geschichte von Macondo, „ein von Staub und Hitze geschlagenes Dorf“ und dessen Gründerfamilie Buendía, und gleichermaßen die gewaltsame Historie des Landes, die sich trotz oder gerade wegen der Abgeschiedenheit Macondos dort wie in einem Brennglas spiegelt. Während über ein Jahrhundert die verschiedenen Buendías von den Anfängen bis zum Niedergang aufeinanderfolgen, wobei sich die Vornamen Arcadio und Aureliano wiederholen, erscheint bereits auf der ersten Seite des Romans die magische Figur des Zigeuners Melchíades, der über alchemistisches Geheimwissen verfügt und schon seit uralten Zeiten zu existieren scheint. Als Freund lebt er später in einem Zimmer im Haus der Familie, wo er zurückgezogen ein Konvolut von Texten in für andere unlesbaren Schriftzeichen verfasst. Nach seinem Tod wird der Raum abgeschlossen, bis einer der Nachfahren vom familientypischen Wissensdurst getrieben die Herausgabe des Schlüssels verlangt. „Niemand hatte sie [die Kammer] betreten, seit man Melchíades‘ Leichnam herausgetragen und vor die Tür ein Schloß gehängt hatte, dessen einzelne Teile vom Rost zusammengeschweißt waren. Doch als Aureliano Segundo die Fenster öffnete, drang vertrautes Licht herein, das gewohnt schien, das Zimmer alltäglich zu erhellen, und dieses wies nicht die geringste Spur von Staub oder Spinnweben auf, sondern war gefegt und säuberlich, besser gefegt und säuberlicher als am Tag der Beerdigung; […] Alles war so frisch, daß mehrere Wochen später, als Ursula mit einem Eimer Wasser und einem Schrubber zum Putzen ins Zimmer trat, sie nichts zu tun fand.“ Melchíades erscheint, jedoch ist er als gespensterhaftes Phänomen nur für Aureliano Segundo sichtbar. Er „sprach ihm von der Welt, suchte ihm seine alte Weisheit einzuimpfen, weigerte sich aber, seine Manuskripte zu übersetzen. ,Niemand darf ihren Sinn kennenlernen, solange nicht hundert Jahre vorbei sind.‘, sagte er.“ Erst einem weiteren Nachfahren der Buendías erschließen sich die Schriften, nachdem er herausgefunden hatte, dass sie in Sanskrit verfasst waren. „Aureliano schritt im Studium des Sanskrits fort, während Melchíades immer seltener kam, immer ferner wurde und sich endlich in der strahlenden Mittagshelle auflöste. […] Nun wurde die Kammer empfänglich für Staub, Hitze, Termiten, bunte Ameisen, Motten, die die Weisheit der Bücher und Pergamente in Sägemehl verwandeln sollten.“ Unerbittlich holt sich die Natur das Haus zurück. „Santa Sofía von der Frömmigkeit kämpfte allein weiter, […] riß die Büschel von Spinnweben, die in wenigen Stunden wieder da waren, von den Wänden und schabte die Termitengänge ab. Doch als sie sah, daß auch Melchíades‘ Kammer sich mit Staub und Spinnweben überzog, wenngleich sie sie dreimal am Tag fegte und abstaubte, und daß sie trotz ihres Putzfimmels von Ruin und Elendsluft bedroht war, […] gab sie sich geschlagen.“ Erst der Letzte der Buendías kann schließlich die Pergamente des Melchíades entschlüsseln und erkennt, dass sie von der Familie und vom Dorf handeln; und er „begann den Augenblick zu entziffern, den er gerade durchlebte, und enträtselte ihn, während er ihn erlebte“.
Astrid Lindgrens Kinder von Bullerbü aus der gleichnamigen Romantrilogie (1947 – 1952) verstehen es aufgrund ihrer kindlich unbefangenen Denkart und durch ihre wohlbegründete Umdeutung der konventionellen Sichtweise den Staub durchweg positiv zu sehen: „Es staubte ganz entsetzlich auf der Schotterstraße […] und wenn die Autos vorbeifuhren, wirbelten sie dicke Staubwolken auf, und wir standen mitten im Staub. Es war unangenehm und ich sagte: „Uh, wie es staubt.“ Aber da fragte Lasse, warum ich das sage. „Warum sagst du nicht auch ‚Uh, wie die Sonne scheint‘ oder ‚Uh, wie die Vögel zwitschern’“. Wer hatte denn befohlen, dass man es schön finden solle, wenn die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, und nicht, wenn es staubt? Und da beschlossen wir, es schön zu finden, wenn es staubte. Als das nächste Auto vorbei war und wir so in Staubwolken gehüllt waren, dass wir einander kaum sehen konnten, da sagte Lasse: „Oh, wie herrlich es heute staubt!“.