 Nicht nur wegen seiner Knappheit spielt Wasser in der andinen Kosmovision eine bedeutende Rolle. Die mit den neoliberalen Strukturreformen in der Dritten Welt einhergehende Privatisierungswelle der öffentlichen Versorgung überzog Bolivien in den 1990er Jahren und führte Ende des Jahrzehnts zur Privatisierung der öffentlichen Wasserversorgung in der Stadt Cochabamba. Die Erhöhung der Wasserpreise bei ausbleibenden Subventionen für die Armen löste den „Wasserkrieg“ im Jahr 2000 aus, in dessen Folge eine soziale Bewegung die Rücknahme der Privatisierung sowie den Rückzug von Aguas del Tunari, einem multinationalen Wasserkonsortium, erzwang. 2005 kam es infolge ausgrenzender Vertragsbedingungen zu Unruhen in der Stadt El Alto. Der vorliegende Beitrag geht, unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen, auf die Ursachen und Auswirkungen der bolivianischen Wasserkonflikte der letzen zehn Jahre ein. Die entscheidende Frage ist, weshalb sich die Konflikte gerade in Bolivien sowie aufgrund der Ressource Wasser ereigneten.
Nicht nur wegen seiner Knappheit spielt Wasser in der andinen Kosmovision eine bedeutende Rolle. Die mit den neoliberalen Strukturreformen in der Dritten Welt einhergehende Privatisierungswelle der öffentlichen Versorgung überzog Bolivien in den 1990er Jahren und führte Ende des Jahrzehnts zur Privatisierung der öffentlichen Wasserversorgung in der Stadt Cochabamba. Die Erhöhung der Wasserpreise bei ausbleibenden Subventionen für die Armen löste den „Wasserkrieg“ im Jahr 2000 aus, in dessen Folge eine soziale Bewegung die Rücknahme der Privatisierung sowie den Rückzug von Aguas del Tunari, einem multinationalen Wasserkonsortium, erzwang. 2005 kam es infolge ausgrenzender Vertragsbedingungen zu Unruhen in der Stadt El Alto. Der vorliegende Beitrag geht, unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen, auf die Ursachen und Auswirkungen der bolivianischen Wasserkonflikte der letzen zehn Jahre ein. Die entscheidende Frage ist, weshalb sich die Konflikte gerade in Bolivien sowie aufgrund der Ressource Wasser ereigneten.
Bevor es um das Thema Wasserkonflikte geht, soll ein kleiner Vergleich ausgewählter sozioökonomischer Daten Boliviens und Deutschlands, bezogen auf die Gegenwart, angestellt werden. Während Deutschland 2010 einen Entwicklungsindex (HDI) von 0,885 aufwies und sich damit auf einer Länderskala auf Rang 10 positionierte, war Bolivien mit einem Wert von 0,643 auf Rang 95 zu finden. Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen (Kaufkraft) lag 2009 in Deutschland bei 36.780 US-Dollar, in Bolivien dagegen bei gerade einmal 4.250 US-Dollar, wobei noch die immensen Ungleichheiten (besonders Stadt-Land-Gefälle sowie ethnisch determinierte Unterschiede) in der Einkommensverteilung innerhalb des Andenlandes berücksichtigt werden müssen. Auch beim Blick auf die Trinkwasser- und Abwasserversorgung zeigen sich, wie zu erwarten, deutliche Unterschiede: Hierzulande liegt der Versorgungsgrad mit Trinkwasser bei 99 Prozent, jener der Abwasserversorgung bei 96 Prozent. Die Werte in Bolivien bewegten sich 2008 bei 82 bzw. 44 Prozent, wobei realistische Annahmen für die Trinkwasserversorgung eher von etwa 70 Prozent ausgehen. Die Quoten der Wasser-/Abwasserversorgung korrelieren meist mit den Angaben zur Lebenserwartung der Bevölkerung. Während sich die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland 2010 bei etwa 80 Jahren bewegte, lag sie in Bolivien im selben Jahr bei knapp über 66 Jahren.
Bedeutung und Nutzung von Wasser im bolivianischen Andenhochland
Einen enormen Einfluss auf die Wasserressourcen haben sowohl die Bevölkerungsverteilung wie auch das Klima. Von Boliviens knapp zehn Millionen Einwohnern leben zirka 52 Prozent im westlichen Hochland (27 Prozent der Fläche des Landes) und etwa 26 Prozent in den nach Osten zum Tiefland hin abfallenden Tälern (13 Prozent der Fläche). Die geographischen Regionen des Hochlandes und der Täler sind arid bzw. semiarid und leiden unter zu geringen Niederschlägen, weshalb die Bewässerung des kultivierten Landes eine wichtige Rolle spielt. Hinzu kommt eine Verschärfung der Wasserversorgungslage infolge der durch die Klimaerwärmung eingetretenen Gletscherschmelze in den Anden.
Historisch-kulturell gesehen gilt Wasser in Bolivien nicht nur als Ressource, sondern ist auch ein wesentliches (göttliches) Element der andinen Kosmovision. Die andinen Kulturen sind auch als „hydraulische Gesellschaften“ bekannt, die – bedingt durch Wasserknappheit – innovative Bewässerungssysteme entwickelt haben. Die Verteilung des Wassers erfolgte nach Bedarf, Gemeinschaftsmustern, Gewohnheit sowie zyklischer Verfügbarkeit. Die kollektiven Wasserrechte sind eine wichtiges Element der andinen Weltsicht, was sich in der Nutzung in den „usos y costumbres“ (Übers.: Bräuche und Gewohnheiten) widerspiegelt. In der Gegenwart spielt die Bewässerung sowohl eine wichtige Rolle in der Versorgungssicherheit wie auch im sozialen Zusammenhalt der Gemeinwesen im bolivianischen Hochland. Das lokale und regionale Wassermanagement erfolgt auch heutzutage über „usos y costumbres“, die unter anderem durch kulturelle Sichtweisen, historische Prozesse, die Distanz zu Städten, ökologische und produktive Aspekte bestimmt werden, aber trotzdem dynamischer Natur sind.
Der erste „Wasserkrieg“: Cochabamba 1999/2000
 Der oft als Musterbeispiel anti-neoliberaler bzw. von Anti-Privatisierungskämpfen charakterisierte „Wasserkrieg“ in Cochabamba fand im Kontext politökonomischer Strukturanpassungen (u.a. Privatisierung öffentlicher Bereiche verbunden mit Massenentlassungen) statt, die Bolivien aufgrund seiner Verschuldung von internationalen Gläubigern wie der Weltbank und dem IWF diktiert wurden. Hinzu kamen ein um 1950 einsetzendes Bevölkerungswachstum, mit einer Verdoppelung der Einwohnerzahl etwa alle 25 Jahre, sowie eine enorme Landflucht, die eine Umkehrung des Verhältnisses von Land- und Stadtbevölkerung in den Jahren 1984/85 herbeiführte. Anfang der 1990er Jahre erfolgte innerhalb der Weltbank ein Paradigmenwechsel im Bezug auf die Ausgestaltung der weltweiten Trinkwasserversorgung: Die Favorisierung öffentlicher Eigentumsstrukturen wurde zugunsten privatwirtschaftlicher Modelle aufgegeben. Unter dem Schlagwort der Effizienzsteigerung sollte die Versorgung über kostendeckende Tarifsysteme verbunden mit den notwendigen Investitionen in die Infrastruktur ausgestaltet werden. Die von den internationalen Finanzinstitutionen ab diesem Zeitpunkt an Bolivien vergebenen Kredite waren an die Bedingung der Privatisierung der Wasserversorgung geknüpft. 1999 erließ die bolivianische Regierung unter Präsident Banzer ein Gesetz, das die Privatisierungen im Wassersektor juristisch legitimierte.
Der oft als Musterbeispiel anti-neoliberaler bzw. von Anti-Privatisierungskämpfen charakterisierte „Wasserkrieg“ in Cochabamba fand im Kontext politökonomischer Strukturanpassungen (u.a. Privatisierung öffentlicher Bereiche verbunden mit Massenentlassungen) statt, die Bolivien aufgrund seiner Verschuldung von internationalen Gläubigern wie der Weltbank und dem IWF diktiert wurden. Hinzu kamen ein um 1950 einsetzendes Bevölkerungswachstum, mit einer Verdoppelung der Einwohnerzahl etwa alle 25 Jahre, sowie eine enorme Landflucht, die eine Umkehrung des Verhältnisses von Land- und Stadtbevölkerung in den Jahren 1984/85 herbeiführte. Anfang der 1990er Jahre erfolgte innerhalb der Weltbank ein Paradigmenwechsel im Bezug auf die Ausgestaltung der weltweiten Trinkwasserversorgung: Die Favorisierung öffentlicher Eigentumsstrukturen wurde zugunsten privatwirtschaftlicher Modelle aufgegeben. Unter dem Schlagwort der Effizienzsteigerung sollte die Versorgung über kostendeckende Tarifsysteme verbunden mit den notwendigen Investitionen in die Infrastruktur ausgestaltet werden. Die von den internationalen Finanzinstitutionen ab diesem Zeitpunkt an Bolivien vergebenen Kredite waren an die Bedingung der Privatisierung der Wasserversorgung geknüpft. 1999 erließ die bolivianische Regierung unter Präsident Banzer ein Gesetz, das die Privatisierungen im Wassersektor juristisch legitimierte.
Der im Spanischen „guerra del agua“ genannte Kampf der Bevölkerung von Cochabamba gegen einen übermächtig erscheinenden Goliath ereignete sich im Zeitraum von Oktober 1999 bis April 2000. Er hatte seinen Vorläufer im so genannten „Brunnenkrieg“ („guerra de pozos“), in dem Stadt und Umland von Cochabamba Mitte der 1990er Jahre um die Kontrolle, Förderung und Bewirtschaftungsform des Wassers stritten. Zur Ausgangslage in Cochabamba ist festzuhalten, dass Stadt und Region durch einen hohen Wasserverbrauch von Landwirtschaft und Industrie an häufigen Wasserknappheiten leiden und dass eine Verschlechterung der Wasserver- und -entsorgung infolge des urbanen Wachstums (Migration) eintrat, mit dem das öffentliche Unternehmen SEMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) überfordert war. Unter Boliviens drei größten Städten hat Cochabamba die schlechteste Wasserversorgungslage und eine der ungerechtesten Verteilungssituationen. Während wohlhabende Haushalte und Unternehmen subventioniertes Wasser aus der Leitung erhalten, beziehen die armen, meist indigenen Bewohner Wasser zu höheren Preisen über Tanklaster, Gemeinschaften mit eigenen Brunnen oder lokale Wasserkooperativen.
1999 handelte Aguas del Tunari, Tochterfirma von International Water Ltd., einem Firmenkonsortium mit Beteiligung der US-Baufirma Bechtel und des Energieunternehmens Edison aus Italien, ohne öffentliche Beteiligung und hinter verschlossenen Türen mit der bolivianischen Regierung und der lokalen Verwaltung eine 40-jährige Monopolkonzession der Wasserver- und -entsorgung in Cochabamba aus. Diese garantierte – ohne Berücksichtigung von Service und Qualität – eine jährliche Rendite von 15 bis 17 Prozent. Die Konzession beinhaltete die Konfiszierung und damit Enteignung gemeinschaftlich errichteter und genutzter Brunnen. Kurz darauf erfolgten Preiserhöhungen für die Konsumenten, deren Wasserrechnungen zwischen 50 und 250 Prozent anstiegen. In einem Land wie Bolivien, wo viele Menschen mit weniger als einem oder zwei US-Dollar am Tag auskommen müssen, war das ein enormer Preisanstieg.
Unter dem Dach der Coordinadora por la defensa del agua y de la vida (i. F. Coordinadora) versammelten sich daraufhin mehrere Organisationen, wie die wichtigsten Gewerkschaften, die Vereinigungen und Komitees der Bewässerer und Wasserversorger, Umweltgruppen und andere lokale Institutionen. Sie wehrten sich gegen die Konzession und wollten über Mobilisierungen, Demonstrationen und Blockaden erreichen, dass der Vertrag und das ihn stützende, nachträglich erlassene Wassergesetz rückgängig gemacht werden. Die Coordinadora wurde zur „Stimme des Volkes“ und führte die Proteste an, die trotz starker staatlicher Repressionen stattfanden. Aufgrund des Einsatzes von Polizei und Militär glich Cochabamba an einigen Tagen einem Kriegsschauplatz. Die Regierung schreckte auch vor der Verhängung von Ausgangssperren und Ausnahmezustand sowie dem Schusswaffeneinsatz nicht zurück. Dieser kostete einen Toten und etliche Verletzte und heizte den Volkszorn zusätzlich an. Am 10. April 2000 lenkte die Regierung Banzer augrund der starken Proteste schließlich ein und annullierte den Vertrag mit Aguas del Tunari/Bechtel, dessen Vertreter inzwischen das Land verlassen hatten.
In der Folge verklagte Bechtel Bolivien vor einem Schiedsgericht der Weltbank über Investitionsstreitigkeiten (ICSID) auf mehr als 25 Mio. US-Dollar Schadensersatz. Die Klage wurde 2006 nach internationalem zivilgesellschaftlichen Druck zurückgezogen. Nachdem die bolivianische Regierung SEMAPA zu einem symbolischen Wert zurückgekauft hatte, erfolgte eine Umstrukturierung des Unternehmens, unter Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure wie der Coordinadora in Aufsichts- und Leitunsgremien. Die Rückkehr zur öffentlichen Dienstleistung zeitigte leider nicht die entsprechenden Erfolge. Im Jahr 2009 war die Wasserversorgung von Cochabamba geprägt durch Unterfinanzierung, eine mangelhafte Infrastruktur, hohe Leitungsverluste von über 50 Prozent und einer hohen Anzahl armer Haushalte, die nach wie vor nicht mit Wasser versorgt wurden. SEMAPA machte Schlagzeilen mit Korruption, Vetternwirtschaft, Intransparenz und Ineffizienz, woraufhin die Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) dringend benötigte Kredite auf Eis legte.
Der zweite „Wasserkrieg“: El Alto 2004/2005
 Das auf über 4.000 Metern Höhe gelegene El Alto ist die zweitgrößte Stadt Boliviens mit zirka einer Millionen Einwohnern und bildet zusammen mit der Schwesterstadt La Paz den bevölkerungsreichsten Ballungsraum Boliviens. Sie ist die am schnellsten wachsende Stadt des Landes (Verdoppelung der Einwohnerzahl zwischen 1992 und 2010), mit einem hohen indigenen Bevölkerungsanteil (über 80 Prozent) und einer der höchsten Armutsquoten (über 70 Prozent der Bewohner leben unterhalb der Armutsgrenze), sowie fehlenden Versorgungsanschlüssen (Wasser und Strom) in den meisten Wohnvierteln. Die öffentliche Wasser- und Abwasserversorgung SAMAPA (Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) konzentriert sich vor allem auf die wohlhabenden Stadtteile von La Paz.
Das auf über 4.000 Metern Höhe gelegene El Alto ist die zweitgrößte Stadt Boliviens mit zirka einer Millionen Einwohnern und bildet zusammen mit der Schwesterstadt La Paz den bevölkerungsreichsten Ballungsraum Boliviens. Sie ist die am schnellsten wachsende Stadt des Landes (Verdoppelung der Einwohnerzahl zwischen 1992 und 2010), mit einem hohen indigenen Bevölkerungsanteil (über 80 Prozent) und einer der höchsten Armutsquoten (über 70 Prozent der Bewohner leben unterhalb der Armutsgrenze), sowie fehlenden Versorgungsanschlüssen (Wasser und Strom) in den meisten Wohnvierteln. Die öffentliche Wasser- und Abwasserversorgung SAMAPA (Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) konzentriert sich vor allem auf die wohlhabenden Stadtteile von La Paz.
1997 bekam das Konsortium Aguas de Illimani S.A. (AISA) eine 30-jährige Wasser- und Abwasserkonzession für die Städte La Paz und El Alto zugesprochen. Hinter AISA stand der französische Mischkonzern Suez Lyonnaise des Eaux (heute GDF Suez), eines der weltweit größten Unternehmen, das 55 Prozent der Aktien hielt, sowie bolivianisches und argentinisches Kapital. Mit den Ereignissen in Cochabamba erwarb die Internationale Finance Corporation (IFC), eine Gesellschaft der Weltbankgruppe, acht Prozent der Aktien – ein klares politisches Signal für internationale Geldgeber. Zentrales Ziel der Privatisierung war es, Versorgungsquoten von 100 Prozent in La Paz bzw. 80 Prozent in El Alto zu erreichen. Unter dem Label „pro poor“ sollten in El Alto 70.000 neue Anschlüsse geschaffen und über die gesamte Laufzeit 350 Mio. US-Dollar investiert werden, davon 80 Mio. US-Dollar in den ersten fünf Jahren. Die Vertragskonditionen gingen wie bereits zuvor zu Lasten der Bevölkerung: AISA bekam ein Monopolrecht über die Wasserressourcen im Konzessionsgebiet (d.h. Verbot der Nutzung gemeinschaftlicher und familiärer Brunnen), die Tarife wurden an den US-Dollar gekoppelt und dem Unternehmen eine Rendite von 13 Prozent garantiert.
Es folgten die Verteuerung von Neuanschlüssen von 335 auf 445 US-Dollar sowie Preisanstiege für Wasser und Abwasser. Wie sich herausstellte, entsprach das tatsächlich zu bedienende Gebiet von AISA (Servicegebiet) bei weitem nicht dem Konzessionsgebiet, weshalb keine Verpflichtung bestand, die Wasserversorgung in bislang unerschlossene Gebiete zu erweitern. Deshalb konnte AISA relativ schnell volle Serviceabdeckung verkünden, obwohl 130.000 Menschen in El Alto keinen Zugang zu Wasser hatten. Fast 70.000 Menschen wurden vom Service ausgeschlossen, da Anschluss für AISA nur das Verlegen der Leitungen, nicht aber der letzten Meter zu den Häusern bedeutete, und sich die Bewohner keinen Neuanschluss leisten konnten.
Im Februar und Oktober 2003 gingen die Büros von AISA in El Alto als Zeichen gegen die Ausplünderung Boliviens durch die multinationalen Unternehmen in Feuer auf. Die mächtigen Nachbarschaftsräte von El Alto (FEJUVE) verhandelten ab Juli 2004 mit der Regierung von Carlos Mesa, um die Konzessionsbedingungen zu verbessern. Nachdem der Regierung eine Verschleppung der Angelegenheit vorgeworfen wurde, forderten die FEJUVE auf Druck der Bevölkerung und gesellschaftlicher Akteure ab November 2004 die Rücknahme der Konzession, da wesentlich Vertragsinhalte nicht erfüllt wurden. Die bolivianische Regierung wurde von Internationalen Finanzorganisationen wie auch der KfW, GTZ und der deutschen Botschaft unter Druck gesetzt, das Modell der Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) als neue Gesellschaftsform für SAMAPA zu wählen, da sonst keine Kredite für zukünftige Investitionen fließen würden. Im Dezember 2004 und Januar 2005 bestreikten und blockierten die Alteños schließlich die Stadt sowie Zufahrtsstraßen nach La Paz und forderten die sofortige Rücknahme der Konzession. Die Regierung lenkte nach wenigen Tagen ein, um kein Blutvergießen wie im ersten „Wasserkrieg“ oder im „Gaskrieg“ von 2003 zu riskieren und kündigte die Aufhebung des Vertrages mit AISA an.
Auch in El Alto brachte die Rücküberführung in öffentliches Eigentum nicht den gewünschten Erfolg. AISA sollte ursprünglich in ein öffentlich-soziales Wasserunternehmen übergehen, dessen Ziele eine effiziente und nachhaltige Versorgung sowie die Ausdehnung der Anschlüsse auf bisher nicht versorgte Stadtgebiete waren. Anfang 2007 übernahm eine nationale Entwicklungsgesellschaft für eine Übergangsperiode die Wasser- und Abwasserversorgung von La Paz und El Alto, danach sollte entweder ein Unternehmen nach dem ÖPP-Modell oder – so die Forderung der FEJUVE – eines mit einem Bürgerhaushalt nach Vorbild von Porto Alegre in Brasilien ins Leben gerufen werden. In der Realität passierte jedoch lange nichts und AISA ging mit allen Strukturen in einem neuen öffentlichen Unternehmen, genannt EPSAS (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento), auf. Im Januar 2007 wurde der Konzessionsvertrag zwischen der neuen bolivianischen Regierung von Evo Morales und Aguas de Illimani im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Um eine Klage von Suez vor dem ICSID abzuwenden, übernahm die Regierung Kreditschulden in Höhe von 9,6 Mio. US-Dollar und entschädigte die AISA-Aktionäre (u.a. Suez) mit 5,5 Mio. US-Dollar. Nachdem sich zwischenzeitlich die Kosten für einen Wasseranschluss in La Paz und El Alto um 20 US-Dollar auf 175 US-Dollar erhöht hatten, wurde die Wasser- und Abwasserversorgung beider Städte 2009 öffentlich und getrennt voneinander ausgeschrieben.
Einschätzung und Ausblick
 An dieser Stelle soll die eingangs gestellte Frage aufgegriffen werden, warum sich die Konflikte in Bolivien und aufgrund der Ressource Wasser abgespielt haben. Zum einen wurde dargelegt, welche überragende Bedeutung das Wasser im andinen Hochland infolge seiner Knappheit sowie seiner Stellung in der Kosmovision der indigenen Bevölkerung besitzt. Wurden die beiden Wasserkonflikte international vor allem als Fanal für den Kampf gegen den Neoliberalismus und ein Gegenlenken zur konzerngesteuerten Globalisierung angesehen, ging es den Bolivianern in erster Linie darum, wer über ihre Grundbedürfnisse, Lebensbedingungen und Ressourcen entscheidet. Darüber hinaus müssen die Ereignisse in einem politischen Kontext gesehen werden, der seit den 1990er Jahren geprägt war durch das Aufbegehren der Indigenen und Marginalisierten Boliviens gegen die seit Jahrhunderten bestehende politische und soziale Exklusion, eng verknüpft mit Ausbeutung und Rassismus.
An dieser Stelle soll die eingangs gestellte Frage aufgegriffen werden, warum sich die Konflikte in Bolivien und aufgrund der Ressource Wasser abgespielt haben. Zum einen wurde dargelegt, welche überragende Bedeutung das Wasser im andinen Hochland infolge seiner Knappheit sowie seiner Stellung in der Kosmovision der indigenen Bevölkerung besitzt. Wurden die beiden Wasserkonflikte international vor allem als Fanal für den Kampf gegen den Neoliberalismus und ein Gegenlenken zur konzerngesteuerten Globalisierung angesehen, ging es den Bolivianern in erster Linie darum, wer über ihre Grundbedürfnisse, Lebensbedingungen und Ressourcen entscheidet. Darüber hinaus müssen die Ereignisse in einem politischen Kontext gesehen werden, der seit den 1990er Jahren geprägt war durch das Aufbegehren der Indigenen und Marginalisierten Boliviens gegen die seit Jahrhunderten bestehende politische und soziale Exklusion, eng verknüpft mit Ausbeutung und Rassismus.
Der Misserfolg der Privatisierungen im Wassersektor ist zurückzuführen auf die undemokratische, intransparente sowie von oben durchgesetzte Art und Weise der Konzessionen, die zusammen mit der sozial ungleich und ungerecht ausgestalteten Versorgung die ärmsten Bevölkerungsteile traf und ihre traditionelle Lebensweise („usos y costumbres“) ignorierte. Die Prozesse der Rückführung in öffentliches Eigentum nach den „Wasserkriegen“ scheiterten insbesondere an der Schwierigkeit, ein belastbares gemeinschaftliches oder anders geartetes Besitzmodell zu etablieren, das sich der in Bolivien allgegenwärtigen Korruption und Vetternwirtschaft entzogen und eine wirksame soziale Kontrollfunktion eingeschlossen hätte.
Dass es trotzdem funktionieren kann, zeigt das Gemeinschaftsprojekt Programa de Apoyo Sectorial en el Abastecimiento de Agua y Saneamiento (PASAAS) der Zona Sur in Cochabamba. Das mit Geldern der Europäischen Union unterstützte Programm ist Ergebnis einer Vereinbarung zwischen der bolivianischen Regierung und der EU. Jedoch wurden die lokalen Wasserkomitees nicht nur explizit mit einbezogen, sie geben auch den Ton bei PASAAS an. Die Komitees und die Organisation ASICA-SUR im armen Südteil der Stadt regeln und überwachen den kompletten Prozess der Planung, Ausschreibung, Vergabe und Durchführung der Wasserversorgung. Mit dem Projekt wurden die bestehenden Strukturen nicht einfach obsolet, PASAAS baute im Gegenteil gezielt auf der bereits existierenden kommunitären Wasserversorgung und ihrer Organisation auf. Ein weiterer wichtiger Punkt des Programms ist die Aus- und Weiterbildung der teilhabenden Bevölkerung in Fragen der Technik, der Verwaltung, der Hygiene und von Umweltbelangen. Auf diesem Weg sind viele Menschen in den Prozess eingebunden und werden darüber hinaus in die Lage versetzt, die Wasserversorgung innerhalb der Gemeinschaft in die eigenen Hände zu nehmen.
Die Proteste haben andererseits dazu geführt, dass die bolivianische Wassergesetzgebung insofern geändert wurde, dass nun ausdrücklich die Rechte der kollektiven Organisationen anerkannt wurden, sich innerhalb einer vom Staat an eine staatliche oder private Organisation erteilten Konzession mit Trinkwasser zu versorgen. Die Anfang 2009 unter Boliviens erstem indigenen Präsidenten verabschiedete neue Verfassung sieht unter anderem vor, dass „Jede Person das Recht auf universellen und gerechten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Trinkwasser, Abwasser, … [hat]“ und dass „Die Zugänge zu Wasser und Abwasser Menschenrechte [bilden], weder Gegenstand von Konzessionen noch Privatisierung [sind] und Lizenzen und Verzeichnissen gemäß dem Gesetz [unterliegen].“ (1) Die notwendigen Investitionen zur Verbesserung der Wasserver- und -entsorgung in Bolivien wurden 2010 vom Ministerium für Umwelt und Wasser auf etwa eine Mrd. US-Dollar geschätzt, wobei im Nationalen Entwicklungsplan 2006-2010 Investitionen in Höhe von 528 Mio. US-Dollar vorgesehen waren.
Es liegt noch ein Stück Weg vor den Bolivianern, um zu einer guten und gerechten Wasser- und Abwasserversorgung zu gelangen und die Forderungen der beiden „Wasserkriege“ in die Realität umzusetzen.
(1) Art. 20 Abs. 1 und 3 Nueva Constitución Política del Estado
————————-
Bildquellen: [1] & [4] Water Advocates, Michael di Biase, [2] Corrado Scropetta, [3] Oriana Eliçabe



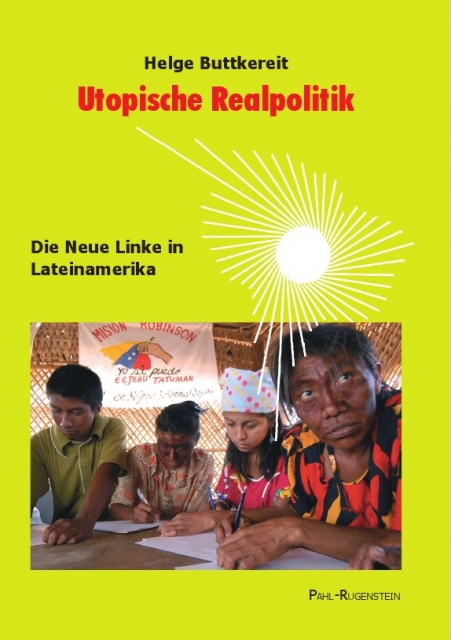
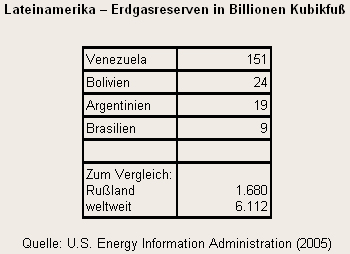

こんばんは。
女性ならみん