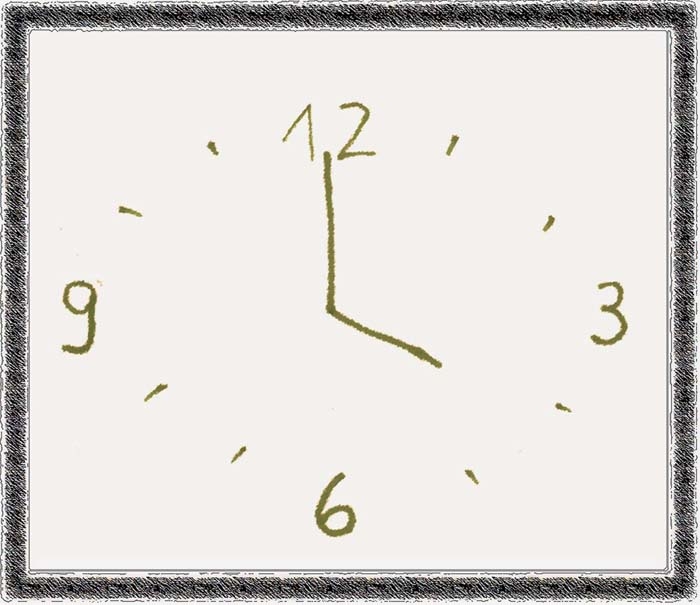„Marasmus und Leere“
In der dritten Erzählung des Bandes „Die Ausgewanderten“ (1992) beschreibt W. G. Sebald, wie einer der Protagonisten, der penible Großonkel Ambros Adelwarth, über ein detailgenaues Gedächtnis verfügt, mit dem „aber kaum mehr eine mit diesem Gedächtnis ihn verbindende Erinnerungsfähigkeit“ einhergeht. Sebalds Erzähler ist angesichts einer nur noch schwer begreifbaren Realität stets auf mediale Abstützung angewiesen. Die mühselige Rekonstruktion der Biografie des Onkels erfolgt unter Zuhilfenahme von mündlich und schriftlich fixierten Erinnerungen, wie Tagebüchern, Fotoalben, Interviews und Ortsterminen.
Als eine Art Kammerdiener, der „nur mehr aus Korrektheit bestand“, angestellt bei der amerikanischen Millionärsfamilie Solomon, war Ambros Adelwarth damit betraut, das Leben des zwischen Genialität und Irrsinn oszillierenden Sohnes Cosmo, einem Erfinder, chronisch vom Glück verfolgtem Spieler und Reisenden, im Lot zu halten. In dieser Funktion findet Adelwarth seine Rolle, scheitert jedoch letztendlich im Kampf gegen den Irrsinn. Doch selbst nach dem Niedergang seiner Arbeitgeberfamilie bleibt er noch auf Posten: Die „Hauptaufgabe des Adelwarth-Onkels war jetzt das Hüten des nahezu menschenleeren, zum Großteil mit weißen Staubblachen verhängten Hauses.“ Am Ende begibt er sich freiwillig in die Psychiatrie von Prof. Fahnstock ins idyllisch gelegene Ithaca, wo Jahre zuvor schon Cosmo behandelt worden war. Dort unterwirft er sich, um seine Depressionen zu bekämpfen, der Elektroschock-Therapie, die in ihrer Behauptung der Reinigung durch Schock an Vorstellungen aus dem Ersten Weltkrieg von der läuternden Kraft des Fronterlebnisses gemahnt. Erst Fahnstocks Nachfolger, Dr. Abramsky, erkennt die Sinnlosigkeit dieser Methode. Noch lange nach der Schließung der Anstalt berichtet dieser von seiner immer wiederkehrenden Vision, in der er das schon lange verlassene und einsturzgefährdete Klinikgebäude in sich zerfallen sieht: „Und so geschieht es dann auch, vor meinen Traumaugen, mit unendlicher Langsamkeit, und eine große, gelbliche Wolke steigt auf und verweht, und an der Stelle des ehemaligen Sanatoriums bleibt nichts als ein Häufchen puderfeines, blütenstaubähnliches Holzmehl.“
Den Eindruck des Zerfalls hatte Ambros Adelwarth bereits in dem Tagebuch seiner Palästina-Reise festgehalten, die er mit Cosmo 1913 unternahm, also in jenem Jahr vor dem Ersten Weltkrieg, auf das Sebald in seinen Erzählungen immer wieder rekurriert: „Große Staubwolken rollen durch die Luft. Grauenvolle Verlassenheit und Leere. […] Knöcheltief mancherorts der pudrige Kalkstaub. […] Verfall, nichts als Verfall, Marasmus und Leere.“
1991 besucht der Erzähler das ehemals mondäne nordfranzösische Seebad Deauville – ein weiterer Lokaltermin, da Cosmo hier, ebenfalls im Jahr 1913, im Casino ans Magische grenzende Glücksspielerfolge gefeiert hatte. Nun aber, nach Ablauf des Jahrhunderts, ist der Eindruck deprimierend: Die „Villen boten fast ausnahmslos ein Bi ld der Verwahrlosung und Verlassenheit. Bleibt man, wie ich es bei meinem ersten morgendlichen Spaziergang durch die Straßen von Deauville getan habe, eine Zeitlang vor einem dieser anscheinend unbewohnten Häuser stehen, so tut sich seltsamerweise fast jedesmal, sei es im Parterre, sei es in der Beletage oder im oberen Stock, einer der geschlossenen Fensterläden etwas auf, und es erscheint eine Hand, die mit auffallend langsamer Bewegung ein Staubtuch ausschüttelt, so daß man unweigerlich bald denkt, ganz Deauville bestehe aus dusteren Interieurs, in denen zu ewig unsichtbarem Dasein und ewigem Abstauben verurteilte Frauenspersonen lautlos herumgehen und darauf lauern, daß sie einem zufällig vor ihrem Gefängnis stehenbleibenden und an der Fassade hinaufblickenden fremden Passanten mit ihrem Staubfetzen ein Zeichen geben können.“ Die an Georges Batailles „dicke Zimmermädchen“ gemahnenden „Frauenspersonen“ erscheinen wie ein satirisches Pendant zum Adelwarth-Onkel und dessen Kampf um den Erhalt einer Familie als Entsprechung zu dem gegen den Staub – beides gleich sinnlos.
ld der Verwahrlosung und Verlassenheit. Bleibt man, wie ich es bei meinem ersten morgendlichen Spaziergang durch die Straßen von Deauville getan habe, eine Zeitlang vor einem dieser anscheinend unbewohnten Häuser stehen, so tut sich seltsamerweise fast jedesmal, sei es im Parterre, sei es in der Beletage oder im oberen Stock, einer der geschlossenen Fensterläden etwas auf, und es erscheint eine Hand, die mit auffallend langsamer Bewegung ein Staubtuch ausschüttelt, so daß man unweigerlich bald denkt, ganz Deauville bestehe aus dusteren Interieurs, in denen zu ewig unsichtbarem Dasein und ewigem Abstauben verurteilte Frauenspersonen lautlos herumgehen und darauf lauern, daß sie einem zufällig vor ihrem Gefängnis stehenbleibenden und an der Fassade hinaufblickenden fremden Passanten mit ihrem Staubfetzen ein Zeichen geben können.“ Die an Georges Batailles „dicke Zimmermädchen“ gemahnenden „Frauenspersonen“ erscheinen wie ein satirisches Pendant zum Adelwarth-Onkel und dessen Kampf um den Erhalt einer Familie als Entsprechung zu dem gegen den Staub – beides gleich sinnlos.
In einer verlassenen Industrieanlage in den Docks von Manchester hat die Hauptperson der vierten Erzählung, der Maler Max Aurach, der in späteren Ausgaben von Sebald in Max Ferber umbenannt wurde, sein Atelier, seit er in den 1940er Jahren dorthin emigriert war. Die nordenglische Stadt stand lange Zeit für die einst blühende britische Industrie, wie auch für einen rabiaten Kapitalismus, wirkt allerdings in den 1960er Jahren degradiert und chronisch verarmt. Max Aurach (Ferber) ist von einem unerbittlichen Schaffensdrang besessen. Seine Werke entstehen, indem er das Gezeichnete immer wieder auswischt, bis die Abbilder seiner persönlichen Geister von selbst aufscheinen, „hervorgegangen aus einer langen Ahnenreihe grauer, eingeäscherter, in dem zerschundenen Papier nach wie vor herumgeisternder Gesichter.“ Den Staub, der dabei entsteht, lässt er hernieder sinken und wie ein Sediment sich auftürmen, denn dieser „sei ihm viel näher als das Licht, die Luft und das Wasser. Nichts sei ihm so unerträglich wie ein Haus, in dem abgestaubt wird, und nirgends befinde er sich wohler als dort, wo die Dinge ungestört und gedämpft daliegen dürfen unter dem grausamtenen Sinter, der entsteht, wenn die Materie, Hauch um Hauch, sich auflöst in nichts.“ Überdies hat der Qualm der Fabrikschlote Manchesters, seit Jahren unbeseitigt, das Nordfenster von Aurachs Atelier bearbeitet. Gutes Licht, besonders das aus Norden, war geradezu die Bedingung für die Eignung einer Immobilie als Künstleratelier. Der Kohlenstoffstaub als toter Rest einer vormals florierenden Industrie, der das Atelierfenster bedeckt, erscheint wie die Antithese zum Licht- und Luftpathos des Jahrhundertbeginns.
Eine Rückkehr an die Orte der Kindheit ist riskant. In „Il ritorno in patria“, der letzten Erzählung des Bandes „Schwindel.Gefühle“ (1990), nähert sich der Erzähler sowohl physisch als Wanderer als auch mental seinem Allgäuer Heimatdorf. Zusammen mit einem Nachbarn macht er sich an die Puzzlearbeit der Erinnerung, deren eine mit dem „Café Alpenrose“ verbunden ist, das niemals Kundschaft hatte und von zwei alten Jungfern betrieben wurde. Einst wurde es dem Erzähler, der die beiden skurrilen, am Rande des Irrsinns lavierenden Frauen in Begleitung seines Großvaters besuchte, untersagt „in den Dachboden hinaufzusteigen, wo […] der graue Jäger logierte“. Nun, nach dreißig Jahren, macht er sich an die Erkundung des gespenstischen Orts. Die dort wahllos gelagerten Gegenstände kommen ihm vor wie eine „Versammlung“, die, als ein Störenfried unerlaubterweise hineingeplatzt, erstarrt war. Der Staub ist ihm zunächst eine Begleiterscheinung der abgestellten Dinge. „In einer Ecke glänzte eine Baßtuba matt unter der sie bedeckenden Staubschicht heraus“. Es zeigt sich, dass der Staub die Herrschaft übernommen hat und der Verfallsprozess längst abgeschlossen ist. „Weiter auf dem Dachboden herumforschend […] fiel mir gleich einer Erscheinung, die sich einmal deutlicher, einmal schwächer […] zu erkennen gab, eine uniformierte Gestalt in die Augen. Tatsächlich war es […] eine alte Schneiderpuppe“ mit einer historischen Uniform bekleidet. „Vielleicht, weil sie verborgen gewesen war hinter dem durch das Lukenfenster in das Dachbodendunkel einfallenden Lichtschleier, in welchem unablässig die Glanzpartikel einer ins Schwerelose sich auflösenden Materie durcheinanderwirbelten, machte die graue Gestalt sogleich einen äußerst geheimnisvollen Eindruck auf mich […]. Als ich aber, dem Augenschein nicht ganz trauend, näher herantrat und an einen der leer herunterhängenden Uniformärmel rührte, ist dieser, zu meinem blanken Entsetzen, in Staub zerfallen.“ Das ans Licht gebrachte Vergangene zerbröselt – wie Nosferatu der Untote in der Sonne – zu Nichts.
In dem Roman „Austerlitz“ (2001) bringt Sebald die alles beherrschende Natur mit dem Wuchern der Stadt London in Zusammenhang: Die Metropole erscheint nicht als Ergebnis rationaler Baustrategie, sondern vielmehr als das eines biologischen Prozesses: „Über die solchermaßen mit dem Staub und den Knochen zusammengesunkener Leiber versetzte Erdschicht hinweg war im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts die Stadt gewachsen in einem immer verwinkelter werdenden Gewirr fauliger Gassen und Häuser, zusammengebacken aus Balken, Lehmklumpen und jedem sonst verfügbaren Material für die niedrigsten Bewohner von London.“ Unter der Oberfläche der modernen City der Reichen, für die Gebäude wie der Bahnhof Liverpool Street Station stehen, kommen wie versteckte Texte auf einem Palimpsest die Dämonen zum Vorschein.
Im Barock galt das Theater als Metapher für die Welt und ihre Eitelkeit. Sebald zieht in „Die Ringe des Saturn: eine englische Wallfahrt“ (1995) Vergleiche zwischen der Bühne und dem Traum, der für ihn wie ein seltsames „Theater, in dem wir Dichter, Schauspieler, Maschinist, Bühnenmaler und Publikum in einem sind“, ist. Als würde man durch „etwas Nebel- und Schleierhaftes“ gleich einem optischen Instrument schauen, wird die Welt im Traum deutlicher: „Ein kleines Wasser wird zu einem See, ein Windhauch zu einem Sturm, eine Handvoll Staub zu einer Wüste, ein Körnchen Schwefel im Blut zu einem vulkanischen Feuer.“ Zur Beschreibung der Traumkulissen greift er auf die antike Vier-Elemente-Lehre des Naturphilosophen Empedokles zurück und ordnet dementsprechend den Makrokosmos Wüste wie auch den Mikrokosmos Staub dem Urelement Erde zu.
Patagonien – das staubige Ende der Welt
In Patagonien ist durch eine spärliche Vegetation und den ständigen Wind der Staub derart vorherrschend, dass man ihn häufig als Metapher für das ganze südliche Lateinamerika benutzt findet. Bruce Chatwin hatte in seinem mittlerweile als Klassiker geltenden Porträt „In Patagonien“ (In Patagonia, 1977) eine aus kleinen Episoden und Miniaturen zusammengesetzte Annäherung verfasst, deren faszinierende, subjektive Sicht man nicht mit einem Baedecker verwechseln sollte. In Paul Therouxs Reisebericht „Der alte Patagonien-Express“ (The Old Patagonian Express, 1979) endet seine Zugfahrt, die ihn von den USA immer weiter Richtung Süden führt, abrupt im Nirgendwo und Nichts. Hier entdeckt er „das patagonische Paradox: Hier mußte man entweder Miniaturist sein oder sich für enorme, leere Weiten interessieren.“ In seiner sehr kurzen Erzählung „Polvo – Das Staubkorn“ (Polvo, 1980) beschreibt Theroux anhand einer kleinen, völlig unbedeutenden und unattraktiven Ortschaft gleichsam den gesamten riesigen Landstrich. Der Makrokosmos Patagonien findet sich hier auf den Mikrokosmos eines Staubkorns zusammengepresst, das wie in einem Genom alles Wesentliche enthält, jedoch einer Entschlüsselung bedarf.
Der nur drei Druckseiten umfassende Text liest sich zunächst als Parodie eines herkömmlichen Reiseführers, mit dessen Hilfe dem Touristen gemeinhin seine Destination verständlicher gemacht werden soll – ein Hilfsmittel, das nur in Kombination mit der Realität seinen Zweck erfüllt. Vom ersten Abschnitt an werden in „Polvo – Das Staubkorn“ die obligatorischen statistischen Zahlen und Fakten, Angaben zu Kultur und Geografie, die Erwähnung berühmter Persönlichkeiten sowie praktische Tipps und Warnungen über den Text verteilt, wobei die typografische Präsentation (Kursiv- und Fettdruck, Abkürzungen, Klammerausdrücke) den Charakter der Authentizität noch unterstützt. Darüber hinaus wird durch die auf die Geschichte der Einwanderung deutenden walisischen Namen sowie die lateinischen biologischen Fachbezeichnungen der Eindruck erweckt, dass sich der Verfasser mit den Gegebenheiten vor Ort, beglaubigt durch die Wissenschaften, voll umfänglich auskennt.
Mit völlig aus der Luft gegriffenen Ratschlägen, wie zum Beispiel dass der Reisende der vor Ort vorherrschenden Wasserknappheit mit dem Bohren eines Brunnens begegnen möge, kippt das Ganze dann jedoch rasch ins Absurde. Vollzogen wird dieser Bruch obendrein mit der Häufung von Ausdrücken der Mutmaßung wie „möglicherweise“, „diese Vermutung liegt … nahe“, „wahrscheinlich“, „von denen es heißt, sie seien “, „der Legende nach“, mit denen die Faktizität des Genres abermals aufgeweicht wird.
Therouxs Reisebücher gleichen alle – wie die von Bruce Chatwin oder W.G. Sebald – vielmehr essayistischen Betrachtungen, deren Bezüge auf andere Texte wichtiger sind als die Beschreibung des Orts selbst und d ie für den Rucksacktouristen eher ungeeignet sein dürften. Im Gegensatz zum klassischen Cicerone beziehen sie ihre Quellen hauptsächlich aus dem Subjekt und der Intertextualität. In „Polvo – Das Staubkorn“ klingt dieses Genre an, indem zum Beispiel Bildungswissen wie Charles Darwins „Die Fahrt der Beagle“ (The Voyage of the Beagle, 1839) und William Shakespeares „Ein Wintermärchen“ (The Winter’s Tale, 1611 uraufgeführt/ 1623 veröffentlicht) zitiert wird.
ie für den Rucksacktouristen eher ungeeignet sein dürften. Im Gegensatz zum klassischen Cicerone beziehen sie ihre Quellen hauptsächlich aus dem Subjekt und der Intertextualität. In „Polvo – Das Staubkorn“ klingt dieses Genre an, indem zum Beispiel Bildungswissen wie Charles Darwins „Die Fahrt der Beagle“ (The Voyage of the Beagle, 1839) und William Shakespeares „Ein Wintermärchen“ (The Winter’s Tale, 1611 uraufgeführt/ 1623 veröffentlicht) zitiert wird.
In nuce finden bedeutende geografische Zonen Patagoniens in dem Flecken Polvo ihr Echo. Die Bewohner sind walisischer Herkunft, was real auf die Gegend um Gaiman in der argentinischen Provinz Chubut im Norden zutrifft, wo sich im Jahre 1899 die gegen Ende des Textes erwähnte Hochwasserkatastrophe ereignete. Die Fingerabdrücke auf den Felsen deuten auf die Handabdrücke der zum Weltkulturerbe zählenden Cueva de las Manos am Río Pinturas, im Zentrum Patagoniens gelegen. Fast schon an der Grenze zu Feuerland liegt die erwähnte Stadt Río Gallegos, ebenfalls im Süden der kalbende Gletscher am Lago Argentino.
Auch die üblichen unverzichtbaren Kuriositäten werden selbstverständlich aufgeführt: Die patagonischen Riesen und der legendäre König von Araukanien und Patagonien – alles findet sich – ebenso wie die landestypische Fauna (Guanakos, Zorillos) und Flora (Dornengestrüpp und Kaktus) – im Dörfchen Polvo widergespiegelt. Aus einer Menge Steinchen könnte sich so wie bei einem Mosaik ein Bild des Landes ergeben, nur dass die Elemente sich so recht nicht fügen wollen.
Was allerdings wie auf einem Palimpsest unleugbar aufscheint, ist die blutige Vergangenheit Patagoniens, die – an den ermordeten Vater Hamlets gemahnend – ihr Unwesen treibt. Sowohl zu Anfang als auch am Ende der Erzählung wird General Juan Manuel de Rosas erwähnt, der seinen Lebenssinn in der Ausrottung der indianischen Urbevölkerung sah. Seine Taten sind gleichfalls Thema eines Wandgemäldes im Museo de Polvo. Der „diensthabende Museumswächter“, der nur zu dem Zweck seinen Schlaf unterbricht, „um den Besucher zu ermahnen, sich nicht auf die Schaukästen zu lehnen“, erscheint in diesem Totenreich aus seltsam disparaten, nicht länger in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringenden Artefakten als eine Art Hadeswächter. Diesen Exponaten entspricht das Sammelsurium, das den Touristen auf dem Markt als Handwerk nicht mehr existierender Indianer angedreht wird.
Polvo ist eine sterbende Ortschaft, die „ständig sinkende Einwohnerzahlen zu beklagen“ hat. Im Durchschnitt sind die Bewohner dreiundsiebzig Jahre alt. Die junge Bevölkerung ist abgewandert. „Einst der Lieblingsaufenthaltsort der patagonischen Riesen, die in dieser Gegend überaus zahlreich gewesen sein sollen und derentwegen frühe Kartenwerke die Legende „Regio Gigantum“ ziert, hat Polvo mit angesehen, wie diese Ureinwohner in Zahl und Körpergröße über die Jahre hin schrumpften, bis Mitte des Jahrhunderts nur noch ein einziger übrig war. Auf ihn Jagd zu machen wurde zum Volkssport und ist Teil der reichen Folklore von Polvo.“ Die über dem Dorf kreisenden Todesboten sind so zahlreich, dass „der Himmel […] regelmäßig schwarz“ wird. Dieser am südlichen Ende Lateinamerikas weit verbreitete schwarz gefiederte Truthahngeier Cathartes aura ernährt sich hauptsächlich von Kadavern und ist in der Vergangenheit von den Siedlern insbesondere auf Feuerland intensiv bejagt worden, um die dort grasenden Lämmer zu schützen. Noch 1917 gab es vier Pence für jeden abgelieferten Schnabel des verhassten Federviehs. Zu der Zeit von General Rocas Wüstenkrieg (Campaña de Roca al desierto) wurde für jedes abgeschnittene Ohr eines Feuerlandindianers ein Pfund Sterling bezahlt.
Überall sind Hinweise auf Vergangenes, die aber anscheinend niemand dechiffrieren will: Eine abseits gelegene kleine Lehmziegelhütte stellt eine Spur für das reale Vorhandensein des letzten Riesen dar – der Reisende wird allerdings vor der nur zu Fuß zu bewältigenden Tour gewarnt und somit davon abgehalten, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Dort erwarten den Besucher urzeitliche, seltsame, angeblich zehntausend Jahre alte, in den Felsen gedrückte Zeichen, die sich jedoch niemand mehr zu deuten anschickt. Von einem noch längeren Trip zu einer Begräbnisstätte wird dem durchschnittlichen Touristen noch dringlicher abgeraten. Wieder ist an die Vergangenheit nicht zu rühren! Die walisischen Inschriften auf den Grabsteinen der ersten Siedler sind kaum noch entzifferbar. Die Spuren der Individuen sind verwischt, die Vergangenheit scheint getilgt. Den Einwanderern von dem Ort Polvo, dessen Name sich auch als eine zu Staub zermahlene, nicht mehr erkennbare Geschichte deuten lässt, ist also dasselbe Schicksal beschieden wie den Indianern, die sie dereinst von ihren angestammten Gebieten verdrängt hatten. Der Mechanismus des Todes scheint hier als ein ewiges Gesetz: „In einem anderen Zeitalter müssen Dinosaurier auf diesem staubigen Plateau herumgestreift sein und ihre Eier dort abgelegt haben, wo heute Schafe grasen, ohne auch nur die geringste Spur hinterlassen zu haben.“
Für Theroux – und nicht nur für ihn – ist Patagonien das Ende der Welt und das Ende aller möglichen Reisen, ein Ort, dessen Vergangenheit, Spuren im Staub hinterlassend, nur noch schattenhaft erahnbar ist.
„Welch ein Meisterwerk ist der Mensch! wie edel durch Vernunft! wie unbegrenzt an Fähigkeiten! in Gestalt und Bewegung wie bedeutend und wunderwürdig, im Handeln wie ähnlich einem Engel! im Begreifen wie ähnlich einem Gott! die Zierde der Welt! das Vorbild der Lebendigen! Und doch, was ist mir diese Quintessenz von Staube?“
William Shakespeare, „Hamlet, Prinz von Dänemark“ (The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmark, 1604)
„Der Staub, der Shakespeare war, nicht zu entziffern.“
Jorge Luis Borges, „Dinge“ (Cosas, 1972)
——————————————
Bildquellen: [1] [2] Quetzal-Redaktion_fq