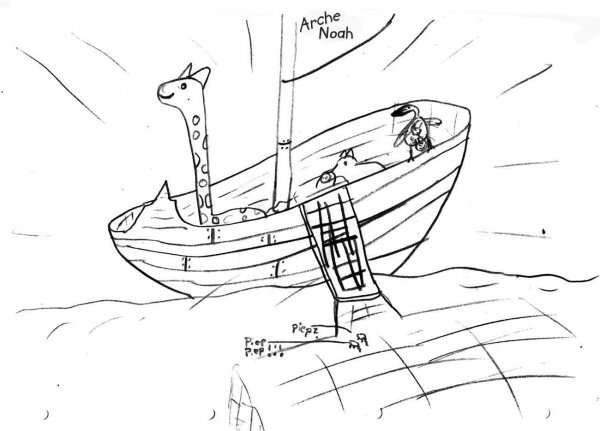Gefährlicher Staub
Die Industrialisierung, die ab 1830 einsetzte, war in England am schnellsten und weitesten entwickelt und rief mit einer Kombination aus zukunftsweisender Produktionsweise und menschenverachtender Ausbeutung der Arbeiter eine kritische Publizistik auf den Plan. In seiner Studie über die Arbeitsbedingungen in den großen Industriestädten „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ (1845) widmet Friedrich Engels auch den gesundheitlichen Konsequenzen der Emission von Stäuben in den Fabriken, vor allem der boomenden Textilindustrie eindrucksvolle Abschnitte: „In vielen Zimmern der Baumwoll- und Flachsspinnereien fliegt eine Menge faseriger Staub umher, der namentlich in den Kardier- und Hechelzimmern Brustbeschwerden erzeugt. […] Die gewöhnlichsten Folgen dieses eingeatmeten Staubes sind Blutspeien, schwerer, pfeifender Atem, Schmerzen in der Brust, Husten, Schlaflosigkeit, kurz alle Symptome von Asthma, die im schlimmsten Falle in der Auszehrung endigen.“ Engels betont, dass dem Staub in den Industrieanlagen nicht zu entkommen war.
Aber der Staub droht nicht nur in Innenräumen. Eine Unterscheidung von Zivilisation und Natur ist obsolet, da mit Beginn der Industriellen Revolution auf vorher nie dagewesene Weise in die Natur eingegriffen wird.
Die Verarmung der ländlichen Bevölkerung in den US-amerikanischen und kanadischen Great Plains während der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre war die Folge eines durch den Menschen verursachten Umweltdesasters, genauer gesagt einer durch Monokulturen ausgelösten Bodenerosion. Die dadurch vermehrt auftretenden furchtbaren Staubstürme bedingten neben anderen ökonomischen Ursachen einen Massenexodus insbesondere aus den Mittelweststaaten Arkansas und Oklahoma über die Route 66 in Richtung Kalifornien, was dort u. a. zu fremdenfeindlichen Übergriffen durch die ansässige Bevölkerung führte. Die miserable Situation dieser aus der so genannten Dust Bowl vertriebenen Menschen ist Gegenstand von John Steinbecks Klassiker „Früchte des Zorns“ (The Grapes of Wrath, 1939), in dem am Beispiel einer Familie die soziale Lage der inneramerikanischen Wirtschaftsflüchtlinge aufgezeigt wird.
Die Natur holt sich die verlassenen Gebäude rasch zurück, die Spuren der ehemaligen Bewohner werden getilgt. „Die Häuser waren verlassen, und verlassene Häuser zerfallen schnell. Risse zogen sich von den Nägeln aus durch die Holzverschalung. Staub setzte sich auf die Fußböden, und nur die Spuren von Mäusen und Wieseln und Katzen waren darauf zu sehen.“
Der Staub, der zu der Vertreibung der Menschen geführt hat, bleibt und nimmt das in Besitz, was die Flüchtlinge zurücklassen mussten.
Ungefähr zur gleichen Zeit, als John Steinbeck für seinen Roman sowohl bejubelt wie angefeindet wurde, hat sich Woody Guthrie, Initiator der – nicht nur – amerikanischen Folkbewegung ebenfalls mit dem Phänomen der Staubstürme auseinandergesetzt; allerdings kannte er als Bewohner der Stadt Pampa im Norden von Texas die Stürme aus eigener Anschauung und war Zeuge des Schwarzen Palmsonntags (14.4.1935), an dem ein zerstörerischer Staubzyklon der Ortschaft eine wahrhaft apokalyptische Katastrophe bereitete. In dem Song „Der große Staubsturm“ (The Great Dust Storm), den er auf der Schallplatte „Balladen aus der Dust Bowl“ (Dust Bowl Ballads, 1940) einspielte, die als eine der ersten Konzeptalben zählt, hat er das Ereignis festgehalten:
„Uns traf am 14. April im 35. Jahr
der schlimmste aller Staubstürme,
den je die Menschheit sah.
Aus tödlich schwarzen Wolken
er hernieder fuhr
und grub in unsre Heimat
die schaurig tiefste Spur.“
In Guthries Roman „Haus aus Erde“ (House of earth, 1947) sieht der Kleinpächter Tike Hamlin die einzige Möglichkeit, sich aus seinem Elend zu befreien und damit die alleinige Alternative zur Migration im persönlichen Besitz eines Stück Lands, auf dem er ein allen Unbilden der Natur trotzendes Haus aus Lehmziegeln eigenhändig errichten würde. Der Plan, der an den Machtverhältnissen scheitert, ist deshalb bemerkenswert, weil er aus der Gegnerschaft der Natur eine Hilfe bei der Lösung seiner Probleme machen will, bestehen doch die Ziegel aus eben dem Staub, gegen den sie ihn und seine Familie schützen sollen. „ ‚Nächstes Mal, wenn wieder einer von diesen großen fiesen Staubstürmen kommt, wartest du, bis er am schlimmsten ist. […] Dann schnappst du dir deinen Hut, rennst raus und fängst ihn ein. […] Dann rennst du zum eisernen Wassertank, hältst den Hut mitsamt Staubsturm ins Wasser und lässt ihn drin, bis der Sturm sich beruhigt hat, bis aller Wind und alle Luft raus sind und der Sturm sich wieder in Erde, in Dreck verwandelt hat. Dann gehst du los, legst den Hut, wohin du willst, und das wird dein Land sein. Deine Farm. Deine Ranch.‘ “
Ein ebenso ambivalentes Verhältnis zum omnipräsenten Staub seines Landes zeigt Juan Rulfo. In der Erzählung „Man hat uns Land gegeben“ (Nos han dado la tierra, 1945) teilt die Regierung einigen Bauern Boden zu, den die Begünstigten eigentlich gar nicht haben wollen, da die Unfruchtbarkeit der Gegend bekannt ist: „Hier gibt es so wenig Erde, daß der Wind gar nichts zum Aufwirbeln hätte, wenn er ein bißchen spielen wollte.“ Doch als sie das zugeteilte Gebiet erreichen, wird der Staub zum Hoffnungsträger: „Je tiefer wir kommen, desto besser wird die Erde. Staub steigt von uns auf, so, als klettere da eine Herde Maultiere hinunter. Aber es freut uns, daß wir staubig werden. Es freut uns. Nachdem wir elf Stunden lang die Härte des Llanos unter unseren Füßen gespürt haben, ist es sehr angenehm, in dieses Etwas eingehüllt zu sein, das sich auf einen legt und nach Erde schmeckt.“
 In der Erzählung „Talpa“ (Talpa, 1950) erscheint das gleiche Eingehülltsein in Staub in einem anderen Kontext und mit unterschiedlicher Bewertung. Tanilo aus dem Dorf Zenzontla leidet an sehr schmerzhaften Geschwüren. Sein Wunsch, ihn zur wundertätigen Heiligen Jungfrau von Talpa zu bringen, wird ihm von seiner Frau und seinem Bruder erfüllt, von deren heimlicher Liaison er jedoch nichts ahnt. Auf dem Weg schwinden seine Kräfte, er bittet umkehren zu dürfen, doch Ehefrau und Bruder zerren ihn zum Wallfahrtsort, wohlwissend, dass sie ihn damit dem Tode ausliefern. Unterwegs, als sie den Pilgerweg erreichen, schließen sie sich dem Heer der Zahllosen an, „die von überallher kamen und gleich uns […] wie in die Strömung eines Flusses geraten waren, wo wir von allen Seiten hin und her gestoßen wurden, als würden wir, mit Schnüren aus Staub aneinandergebunden, vorwärts getrieben. Denn durch das Gedränge der vielen Menschen stieg von der Erde ein weißer Staub auf, wie Maisstreu, stieg ganz hoch auf und fiel zu Boden. Aber die Füße wirbelten ihn beim Gehen wieder auf, und dann stieg er von neuem in die Höhe. So war dieser Staub zu jeder Stunde über uns und unter uns. Und über der Erde war der leere Himmel; keine Wolken, nur Staub. Aber der Staub gibt keinen Schatten.“ Tanilos Leiden ähneln immer mehr einer Passion („Dann verlangte er nach einer Dornenkrone.“), auf die keine Auferstehung folgt. Die Erfrischung durch das Wasser trügt. Die Zeit scheint sich nur zäh zu bewegen. Der Staub steht für die letztendliche Hoffnungs- und Ausweglosigkeit des Landes und seiner Bevölkerung: „Und mir kam es vor, als wäre das Leben noch nie so langsam und widerwillig dahingegangen […]. Es war, als wären wir ein Gewimmel ineinander verknäuelter Würmer und ringelten uns unter der Sonne in dem geballten Staubnebel, der uns alle auf demselben Weg eingeschlossen hatte und gefangenhielt. Die Blicke folgten der Staubwolke; sie trafen auf den Staub, als prallten sie auf etwas Undurchdringliches. Und der Himmel ewig grau, eine graue und schwere Masse, die von oben her uns alle erdrückte. Nur manchmal, wenn wir über einen Fluß gingen, stand der Staub höher und sah heller aus. Wir tauchten unsere fiebrigen, verschmutzten Köpfe in das grüne Wasser, und für einen Augenblick ging von uns allen ein bläulicher Dunst aus, ähnlich dem Hauch, der aus dem Mund kommt, wenn es kalt ist. Aber kurze Zeit darauf verschwanden wir wieder im Staub“.
In der Erzählung „Talpa“ (Talpa, 1950) erscheint das gleiche Eingehülltsein in Staub in einem anderen Kontext und mit unterschiedlicher Bewertung. Tanilo aus dem Dorf Zenzontla leidet an sehr schmerzhaften Geschwüren. Sein Wunsch, ihn zur wundertätigen Heiligen Jungfrau von Talpa zu bringen, wird ihm von seiner Frau und seinem Bruder erfüllt, von deren heimlicher Liaison er jedoch nichts ahnt. Auf dem Weg schwinden seine Kräfte, er bittet umkehren zu dürfen, doch Ehefrau und Bruder zerren ihn zum Wallfahrtsort, wohlwissend, dass sie ihn damit dem Tode ausliefern. Unterwegs, als sie den Pilgerweg erreichen, schließen sie sich dem Heer der Zahllosen an, „die von überallher kamen und gleich uns […] wie in die Strömung eines Flusses geraten waren, wo wir von allen Seiten hin und her gestoßen wurden, als würden wir, mit Schnüren aus Staub aneinandergebunden, vorwärts getrieben. Denn durch das Gedränge der vielen Menschen stieg von der Erde ein weißer Staub auf, wie Maisstreu, stieg ganz hoch auf und fiel zu Boden. Aber die Füße wirbelten ihn beim Gehen wieder auf, und dann stieg er von neuem in die Höhe. So war dieser Staub zu jeder Stunde über uns und unter uns. Und über der Erde war der leere Himmel; keine Wolken, nur Staub. Aber der Staub gibt keinen Schatten.“ Tanilos Leiden ähneln immer mehr einer Passion („Dann verlangte er nach einer Dornenkrone.“), auf die keine Auferstehung folgt. Die Erfrischung durch das Wasser trügt. Die Zeit scheint sich nur zäh zu bewegen. Der Staub steht für die letztendliche Hoffnungs- und Ausweglosigkeit des Landes und seiner Bevölkerung: „Und mir kam es vor, als wäre das Leben noch nie so langsam und widerwillig dahingegangen […]. Es war, als wären wir ein Gewimmel ineinander verknäuelter Würmer und ringelten uns unter der Sonne in dem geballten Staubnebel, der uns alle auf demselben Weg eingeschlossen hatte und gefangenhielt. Die Blicke folgten der Staubwolke; sie trafen auf den Staub, als prallten sie auf etwas Undurchdringliches. Und der Himmel ewig grau, eine graue und schwere Masse, die von oben her uns alle erdrückte. Nur manchmal, wenn wir über einen Fluß gingen, stand der Staub höher und sah heller aus. Wir tauchten unsere fiebrigen, verschmutzten Köpfe in das grüne Wasser, und für einen Augenblick ging von uns allen ein bläulicher Dunst aus, ähnlich dem Hauch, der aus dem Mund kommt, wenn es kalt ist. Aber kurze Zeit darauf verschwanden wir wieder im Staub“.
Eine sehr beeindruckende Schilderung eines verheerenden Staubsturms findet sich auch in Winfried Georg Sebalds „Die Ringe des Saturn: eine englische Wallfahrt“ (1995). Der Erzähler erinnert sich, dass es mitten am Tag binnen kürzester Zeit dunkel wurde und ein Wind aufkam, „der in gespenstisch sich drehenden Wirbeln den Staub über die ausgedörrten Landflächen blies. […] Das Staubmehl strömte von links gegen rechts, von rechts gegen links, von allen Seiten gegen alle Seiten, es stieg in die Höhe empor und rieselte aus der Höhe hernieder, ein einziges Flirren und Flimmern, das wohl eine Stunde fortdauerte […]. Als der Sturm sich legte, tauchten allmählich die wellenförmigen Sandverwehungen, die das Bruchholz unter sich begraben hatten, aus der Düsternis auf. […] Ringsum war es totenstill, kein Hauch rührte sich mehr, kein Vogellaut war zu hören, kein Rascheln, nichts, und obgleich es nun wieder lichter wurde, blieb doch die im Zenit stehende Sonne verborgen hinter den lange noch in der Luft hängenden Fahnen aus dem blütenstaubfeinen Puder, welcher zuletzt übrigbleibt von der sich selber langsam zermahlenden Erde.“
Den realen Hintergrund zu diesem Staubsturm lieferte dem Autoren der am 16. Oktober 1987 in England wütende Orkan, der 29 Menschen das Leben kostete und einen immensen Sachschaden anrichtete.
In dem Roman „Pedro Páramo“ (Pedro Páramo, 1955) beschreibt Juan Rulfo die im ursprünglichen Sinne kultivierende Funktion des Staubs, wenn er durch Wasser gebunden wird. „Als es Morgen wurde, fielen dicke Regentropfen auf die Erde. Es klang hohl, wenn sie sich in den weichen, losen Sand der Furchen bohrten.“ Der Mensch begnügt sich mit der Vorbereitung des Bodens, um dann der Natur den Rest zu überlassen. „Fulgor Sedano spürte den Geruch der Erde und schaute hinaus, um zu sehen, wie der Regen in die Furchen eindrang […] Komm her, lieber Regen, laß dich schön fallen, bis du müde wirst! Nachher verzieh dich dahinten hin! Vergiß nicht, daß wir das ganze Land gepflügt haben, nur damit du dir einen guten Tag machen kannst!“
Die Kombination von Staub und Flüssigem findet sich als Metapher in dem im Kontext des Spanischen Bürgerkriegs verfassten geschichtsphilosophischen Prosastück „Staub und Tränen“ (Polvo y lágrimas, 1939) des Dichters Léon Félipe und zwar im übertragenen Sinne als die Grundstoffe jeder Kultur. „Unser Reichtum ließ sich nie an dem messen, was wir haben, sondern daran, wie wir damit umgehen.“ Dem Individuum kommt also eine wenn auch nur bedingt aktive Rolle zu. Nicht der naturgegebene Regen, sondern die aus dem Elend resultierenden Tränen der Menschen dienen als Beschleuniger der Reaktion. Epochen der Zerstörung stehen solchen des Aufstiegs und der Blüte gegenüber. Letztere sind durch Gestaltung gekennzeichnet: „ … der Staub neigt dazu, sich ganz folgsam in Struktur und Form zu binden und mitzuspielen. Nachdem nun aber Form und Struktur untergegangen sind, fordert der Staub seine Freiheit und Unabhängigkeit ein.“
Auf Grund der fundamental durch das Ausgeliefertsein des Menschen geprägten Auffassung stellte sich dem damals bereits im Exil lebenden Spanier die Frage der Sinnfälligkeit einer politisch engagierten Literatur: „Und das ist jetzt meine Qual: Wohin mit meinen Träumen und Wehklagen, damit sie Bedeutung erhalten, die Zeichen einer Sprache und ein verständliches und harmonisches Gedicht bilden?“
Der auch von Ernesto Che Guevara hochgeschätzte Léon Félipe wählt in seinem Gedicht „Ich bin ein Vagabund“ (Yo soy un vagabundo, 1943) für die, die ihr Leben dem Kampf gegen das Unrecht widmen, das Bild des Vagabunden. In Zeiten der „Ungerechtigkeit und des Tyrannen“, in denen der Mensch verlassen ist, „weil Gott taub ist und alle dort droben schlafen“, kommt der Poesie eine bedeutende Funktion zu:
„Die Poesie ist das Menschenrecht
eine Türe aufzustoßen,
eine Fackel anzuzünden,
eine Mauer niederzureißen,
den Aufseher aufzuwecken
mit einem Fluch
oder einer Gotteslästerung.“
Die Figur des Vagabunden ist kein romantischer Topos und ebenso wenig die des sozial deklassierten Herumtreibers, vielmehr ist sie die mythische Gestalt dessen, der aus innerer Notwendigkeit und angesichts der Verhältnisse keine andere Wahl hat als die einzig adäquate historische Rolle des Oppositionellen einzunehmen.
„Ich bin nur ein Vagabund
sonder Stadt und Stamm.
Und mein Exodus ist schon alt,
nicht erst gestrig wie der Deinige.
In meinen Kleidern schläft der Staub aller Wege
und steckt die Ausdünstung vieler Qualen.
Das Schweißband meines Hutes ist fettig
mein Wanderstock hat sich verbogen
und an meiner Schuhsohle kleben Blut,
das Wehklagen
und die Erde vieler Friedhöfe.“
Die mit allgemein quantifizierenden Begriffen versehenen Formulierungen (der Staub aller Wege, die Ausdünstung vieler Qualen, die Erde vieler Friedhöfe), die mit den auf das Individuum bezogenen Ausdrücken (meine Kleider, das Schweißband meines Hutes, meine Schuhsohle) verklammert sind, zeigen, dass das lyrische Ich den Anspruch hat, für viele zu sprechen.
Der ecuadorianische Dichter Jorge Carrera Andrade bringt in seinem Gedicht aus der gleichnamigen Sammlung „Buch des Exils“ (Libro del destierro, 1970) die „Peitschen aus Staub“ mit der schmerzhaften Erfahrung langjährigen Exils und daraus resultierender Entfremdung und Einsamkeit in unmittelbaren Zusammenhang.
„Ich erkenne dich, Wind des Exils,
wenn du Plünderer mit deinen Peitschen aus Staub
in den Gärten dein Unwesen treibst.“
Der Staub und die Künste
Neben dem formbaren Eisen gehört das industriell herstellbare, Transparenz und Helligkeit bietende Glas zu den neu entdeckten Materialien, die die junge Architekten- und Ingenieursgeneration ab circa 1850 begeisterten. In seinem Essay „Erfahrung und Armut“ (1933) erinnert Walter Benjamin an den Visionär Paul Scheerbart, der in seiner Streitschrift „Glasarchitektur“ (1914) die Änderung der Kultur „durch Einführung der Glasarchitektur, die das Sonnenlicht und das Licht des Mondes und der Sterne nicht nur durch ein paar Fenster in die Räume lässt“ propagiert. Dem bereits um 1860 erfundenen Staubsauger räumt Scheerbart ein eigenes etwas skurriles Kapitel ein, in dem gleichermaßen den notorisch den Staub begleitenden Insekten der Kampf angesagt wird:
„Der Staubsauger – auch im Park – zugleich als Insektenvertilger
Der Staubsauger wird in allernächster Zukunft uns so wichtig erscheinen wie die Wasserleitung. Und man wird den Staubsauger auch im Park verwenden, da die parkettierten Parkwege vom Staube freizuhalten sind. Dann wird man naturgemäß die Staubsauger auch als Insektenvertilger gebrauchen. Es ist geradezu haarsträubend, dass der Staubsauger heute noch nicht zum Insektenvertilgen gebraucht wird. Dass der Staubsauger bereits bei Beseitigung des Straßenstaubes Verwendung findet, setze ich als bekannt voraus.“
Benjamin verteidigt Scheerbarts Abhandlung zur Glasarchitektur, allerdings unter einer durch die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs geänderten Perspektive. Glas wird nun als ein Material aufgefasst, das zu einer von Krieg und Inflation geprägten Generation passt, denen die übermittelte Erfahrung ihrer Väter sich samt und sonders als Lügen erwiesen hat. Die staubabweisende Eigenschaft des Glases steht für Nüchternheit und Klarheit und das Bestreben, keine Spuren zu hinterlassen und setzt sich somit von der bürgerlichen Plüschkultur, die in den überladenen Interieurs auf vielerlei Art die Spuren der Bewohner aufwies, auf das Entschiedenste ab.
Die Malerei begann sich ebenfalls in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom Diktat des Narrativen und Repräsentativen loszulösen. Die Entwicklung der Fotografie befreite sie von einer oberflächlichen Darstellung der Wahrnehmung. Vorrangig ging es den Impressionisten darum, die sichtbare Welt unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu erfassen. Claude Monet hat schon früh bestimmte Sujets (Getreideschober, Pappeln, Kathedrale von Rouen) in Serie gemalt. In dem Dorf Giverny, bei Vernon in der Normandie gelegen, wo er ein Haus erworben hatte, legte er zunächst einen Ziergarten an, den er durch einen Wassergarten mit einem Seerosenteich erweiterte, beides Motive, die von ihm immer wieder künstlerisch umgesetzt wurden. Unerträglich war ihm die durch die Anlage verlaufende Straße, da der Staub, der von den Fahrzeugen aufgewirbelt wurde, sich auf die Blätter der Pflanzen, insbesondere der Seerosen legte und ihnen den Glanz nahm. 1907 wurde die Durchfahrt auf Wunsch des Künstlers asphaltiert, wobei er von den anfallenden 2.800 Franc Kosten 1.200 Franc aus eigener Tasche bezahlte.
Für Picasso und seine Mitstreiter spielte die illusionistische Abbildung der Wirklichkeit vollends keine Rolle mehr. Wer mit den Gesetzen der Zentralperspektive aufgewachsen war, auf den mussten „Die Mädchen von Avignon“ (Les Demoiselles d‘Avignon, 1907) des Spaniers wie ein Schock wirken, selbst wenn man wie der Kunsthändler Daniel-Henry Kahnweiler zu den Förderern der junge Avantgarde ab 1900 gehörte: „Ich betrat den seltsamen Raum, in dem Pablo sein Atelier hatte. Die Tapete hing in Fetzen von der Bretterwand. Auf den aufgerollten Leinwänden und dem alten Sofa lag dicker Staub. Neben dem Ofen erhob sich wie erstarrte Lava ein Berg Asche. Es war grässlich. Sein neues Bild erschien allen irrsinnig und monströs.“ Zu der Zeit arbeitete und lebte Picasso in der unter dem Namen „Bateau-lavoir“ berühmt gewordenen Holzbaracke auf dem Montmartre. Ab 1918 bezog er sein Atelier in der Pariser Rue de La Boétie. Dass der Zustand dieser Künstlerwerkstatt, die nach herkömmlicher Ansicht völlig verkommen erscheinen musste, nicht nur einer anti-bourgeoisen Attitüde geschuldet war, hat Picasso in einem der Interviews mit dem Fotografen Brassaï, die unter dem Titel „Gespräche mit Picasso“ (Conversations avec Picasso, 1964) veröffentlicht worden sind, erläutert. Nachdem sein Freund ihn in dem Gespräch vom 20. Oktober 1943 auf die schichtenbezogene Vorgehensweise in aktuellen archäologischen Grabungen aufmerksam gemacht hat, die es erlauben, in die jahrtausendjährige Geschichte einzutauchen, entgegnet Picasso: „Und wem haben wir das zu verdanken? Dem Staub! Die Erde hat keine Putzfrau, und der täglich fallende Staub bleibt liegen … Alles, was aus der Vergangenheit geblieben ist, hat der Staub uns erhalten … Sehen Sie, hier auf diesem Haufen, hat er in einigen Wochen eine dicke Schicht gebildet. Erinnern Sie sich, in der rue La Boétie fingen in einigen Räumen meine Sachen schon an, unterm Staub zu verschwinden …Ich will Ihnen etwas verraten: wenn ich immer verboten habe, daß in meinem Atelier saubergemacht wird, dann nicht nur aus Angst, jemand könnte mir meine Sachen durcheinanderbringen, sondern vor allem, weil ich mich auf den Schutz des Staubes verlassen konnte … Er ist mein Verbündeter … Ich habe ihm immer erlaubt, sich abzulagern, wie es ihm gefällt … Er ist eine Schutzschicht … Wenn hier oder da der Staub fehlt, dann hat jemand meine Sachen berührt … Ich sehe sofort, ob jemand dagewesen ist … Und weil ich immer mit Staub, ja im Staub lebe, trage ich mit Vorliebe graue Anzüge, die einzigen, auf denen er keine Spuren hinterläßt …“ Der Staub wird positiv gesehen, weil er dazu beiträgt, die Dinge zu konservieren. Er ermöglicht daher, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne Verschüttetes verfügbar zu halten. Den Künstler unterstützt er bei dessen Kampf gegen die verrinnende Zeit.
 Zwischen 1915 und 1923 arbeitete der französische Mitbegründer der Konzeptkunst Marcel Duchamp an seinem auch als „Großes Glas“ (Le Grand Verre) bekannten Glasbild „Die Braut wird von ihren Junggesellen entkleidet, sogar“ (La Mariée mise à nu par ses célibataires, même). Das „Große Glas“, das von Berechnungen zu einer Perspektive der Vierten Dimension begleitet wurde und unvollendet blieb, fotografierte der amerikanische Künstler Man Ray 1920, nachdem Duchamp es längere Zeit in seinem New Yorker Studio hatte einstauben lassen. Durch die lange Belichtungszeit entstanden rätselhafte, fast dreidimensional wirkende Strukturen. Eines der Fotos wurde in der u. a. von André Breton herausgegebenen Zeitschrift „Littérature“ (Jg. 2, Nr. 5, 10/1922) abgedruckt unter dem Titel: „Hier die Domäne von Rrose Sélavy. Gesehen aus einem Flugzeug 1921. Wie trocken sie doch ist. Wie fruchtbar sie doch ist. Wie glücklich sie doch ist. Wie traurig sie doch ist!“ (Voici le domaine de Rrose Sélavy. Vue par un aeroplane 1921. Comme il est aride. Comme il est fertile. Comme il est joyeuse. Comme il est triste!“.) Der sprechende Frauenname „Rrose Sélavy“, 1920 aus einem Wortspiel hervorgegangen, war eins von Marcel Duchamps Pseudonymen. Während der eigentliche Titel des Fotos „Dust Breeding“ (Staubzucht, 1920) dem Staub biologische, naturhafte Eigenschaften zuschreibt, scheinen die im Untertitel der Zeitschriftenpublikation wiedergegebenen Adjektive (trocken – fruchtbar – glücklich – traurig) den vielfach beschriebenen Weg des Menschen vom Kultur- und Naturwesen zum Staub rückgängig machen zu wollen. Sie lassen sich gleichwohl so verstehen, wie Duchamp in einem seiner Gespräche mit dem Kunstkritiker Pierre Cabanne das unverständliche „même“ im Titel des „Großen Glas“ interpretiert hat: „Ein Adverb also im besten Sinne des Adverbs. Ohne Sinn nämlich.“
Zwischen 1915 und 1923 arbeitete der französische Mitbegründer der Konzeptkunst Marcel Duchamp an seinem auch als „Großes Glas“ (Le Grand Verre) bekannten Glasbild „Die Braut wird von ihren Junggesellen entkleidet, sogar“ (La Mariée mise à nu par ses célibataires, même). Das „Große Glas“, das von Berechnungen zu einer Perspektive der Vierten Dimension begleitet wurde und unvollendet blieb, fotografierte der amerikanische Künstler Man Ray 1920, nachdem Duchamp es längere Zeit in seinem New Yorker Studio hatte einstauben lassen. Durch die lange Belichtungszeit entstanden rätselhafte, fast dreidimensional wirkende Strukturen. Eines der Fotos wurde in der u. a. von André Breton herausgegebenen Zeitschrift „Littérature“ (Jg. 2, Nr. 5, 10/1922) abgedruckt unter dem Titel: „Hier die Domäne von Rrose Sélavy. Gesehen aus einem Flugzeug 1921. Wie trocken sie doch ist. Wie fruchtbar sie doch ist. Wie glücklich sie doch ist. Wie traurig sie doch ist!“ (Voici le domaine de Rrose Sélavy. Vue par un aeroplane 1921. Comme il est aride. Comme il est fertile. Comme il est joyeuse. Comme il est triste!“.) Der sprechende Frauenname „Rrose Sélavy“, 1920 aus einem Wortspiel hervorgegangen, war eins von Marcel Duchamps Pseudonymen. Während der eigentliche Titel des Fotos „Dust Breeding“ (Staubzucht, 1920) dem Staub biologische, naturhafte Eigenschaften zuschreibt, scheinen die im Untertitel der Zeitschriftenpublikation wiedergegebenen Adjektive (trocken – fruchtbar – glücklich – traurig) den vielfach beschriebenen Weg des Menschen vom Kultur- und Naturwesen zum Staub rückgängig machen zu wollen. Sie lassen sich gleichwohl so verstehen, wie Duchamp in einem seiner Gespräche mit dem Kunstkritiker Pierre Cabanne das unverständliche „même“ im Titel des „Großen Glas“ interpretiert hat: „Ein Adverb also im besten Sinne des Adverbs. Ohne Sinn nämlich.“
Der deutsche Konzeptkünstler Joseph Beuys vertrat den Anspruch, dass die Kreativität nicht mehr mittelbar über die abgebildete Realität wirken, sondern unmittelbar zum Verändern des Lebens genutzt werden soll. Er nutzte Materialien, deren Eigenschaften aus dem alltäglichen Kontext genommen mythisch aufgeladen Assoziationsräume eröffnen sollen, in denen sich politisch engagierte Zivilisationskritik mit einem schamanischen Konzept des Künstlers zusammenschließt. Bekannt sind seine Arbeiten mit Filz, Fett und Wachs. In seinen Objekten „Halbiertes Filzkreuz mit Staubbild Marta“ (1960) und „Halbiertes Filzkreuz mit Staubbild Magda“ (1960/1965) kombiniert er ein in der Mitte längs abgeschnittenes christliches Kreuz aus Filz mit einem gerahmten zweiten Bild, das Staub als Signet der Sterblichkeit enthält anstelle des Corpus‘ der christlichen Ikonografie. 1980 fertigte Andy Warhol eine Reihe mit dem Porträt von Joseph Beuys, dessen Engagement er großen Respekt zollte. Einen Teil der Siebdrucke bestreute er mit Diamantstaub, was von Warhols Biograf Victor Bockris „als Antwort eines Amerikaners auf Materialien, die Beuys in seinen apokalyptischen Werken verwendete“ gedeutet wurde. Diamanten zählen aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften Transparenz und Härte zu den wertvollsten Materialien der Erde, bestehen hingegen chemisch aus reinem Kohlenstoff, also der Grundlage von allem, was lebt und stirbt.
Während im 20. Jahrhundert durch ein zunehmendes Hygienebewusstsein dem Staub als unerwünschtem Gast auch in den Museen der Kampf angesagt wurde, erhielt er zeitgleich Kunststatus und zog als geschätztes Exponat in die Ausstellungshallen ein.
Ende der 1980er Jahre ersuchte der deutsche Konzeptkünstler Joachim Rönneper zahlreiche Museen in Europa um Proben von Museumsstaub nebst Kommentierung. Das Ergebnis seines Ansinnens stellte der Künstler an verschiedenen Orten zur Schau und brachte damit das Allgegenwärtige, Gewöhnliche und Unerwünschte in jene heilige Institution, die einst mit Raritäten- und Kuriositätenkabinetten, den so genannten Panoptika, ihren Anfang genommen hatte.
Der österreichische Künstler Erwin Wurm wies mit seinen Staubskulpturen (1990 – 1993) auf das, was abwesend ist. Werke, vielmals Objekte der Anbetung einer Kunstreligion, wie sie seit der Jahrhundertwende en vogue waren, sind bei ihm nur noch als Auslassungen und Begrenzungen von Glasvitrinen, Sockeln oder Glasstürzen erkennbar, die durch die Ränder des Staubes lediglich erahnbar werden.
Im Jahr 2000 installierte der Österreicher Dieter Buchhart sein Staub Museum in einem 2,5 x 2,5 m großen Grenzhäuschen zwischen Oberndorf und Laufen an der Salzach. Der ganz in Weiß gehaltene Museumsraum darf nicht betreten werden. Einzig dem Staub ist es hier gestattet, sich ungestört zu vermehren. Der Künstler bedient sich dieses Mediums, um seine politische These, die vielen seiner Werke zu Grunde liegt, dass das Einzelwesen in der Masse untergeht und nicht wahrgenommen wird, zu veranschaulichen.
Seit 2004 jagt der selbsternannte Kölner Staubsammler Wolfgang Stöcker für sein Deutsches Staubarchiv weltweit historische Stäube: „Der Staub ist ein Demokrat. Er lebt in Hütten und Palästen. Wenn er sich ablagert, kümmert es ihn nicht, ob er das auf einem Rembrandt oder einer Werbetafel tut. Für den Staub sind alle gleich.“