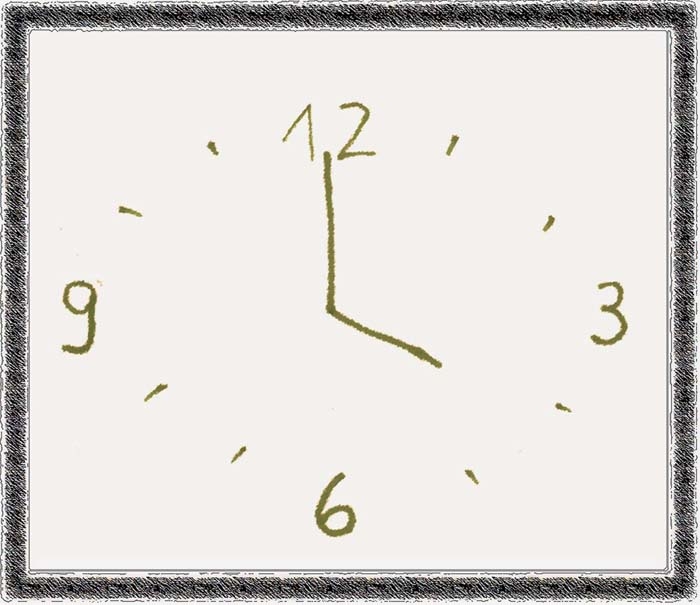Dieses alles sind ja Adamskinder, und eines Gemächts miteinander,
und zwar nur von Staub und Aschen!
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen,
Der Abenteuerliche Simplicissimus Teutsch (1668 /69)
Staub ist ein leichtes Gemisch, das aus feinen Partikeln unterschiedlichster organischer wie anorganischer Herkunft besteht. Gehörig aufgewirbelt und über erstaunliche Distanzen bewegbar, legt er sich nicht selten in beachtlichen Mengen auf Mensch, Ding und Natur. Meist koexistiert er friedvoll mit den anderen Wesen der Erde, im Zusammenhang mit meteorologischen Phänomenen und wenn er industriell erzeugt wird, zeigt er sich jedoch äußerst angriffslustig und zerstörerisch. Komplette Staubfreiheit lässt sich nur mit technischen Mitteln in so genannten Reinräumen herstellen. Ansonsten stellt sich der Kampf des Menschen gegen den Staub – in den USA wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dafür sogar eigens ein Gerät erfunden – als genauso aussichtslos dar wie die legendären Mühen des Sisyphos. Dauerhaft sind die ungeliebten Staubablagerungen von keiner noch so gut ausgerüsteten Putzkolonne zu entfernen. Amorph formt unser ständiger Begleiter die Gegenstände nach, überlebt sie immerdar und bleibt hartnäckig und auf ewig der stolze Sieger.
Dem Staub sind in allen Sprachen der Welt zahlreiche Wortschöpfungen, Redewendungen und Sprichwörter geschuldet. Der Schriftsteller Walter Scott hat mit der Figur des Gelehrten Dr. Dryasdust (Doktor Staubtrocken) die mit ihrer Pedanterie langweilenden Experten aufs Korn genommen und mit diesem Begriff Aufnahme in die englischsprachigen Wörterbücher gefunden.
In der Weltliteratur wie auch in der bildenden Kunst ist der Staub von alters her ein beliebtes Motiv. Weil er die Grenze des für den Menschen mit bloßem Auge sichtbaren Bereichs bildet, taucht er oft dann auf, wenn es um die Toten und die Untoten geht und weist auf die vergehende, begrenzte Lebenszeit, den Verfall der Dinge und das unerbittliche Rinnen der Sanduhren.
Staub, Zeit und Ewigkeit
Antigone, die Heldin der auf das Jahr 442 vor Christus datierten gleichnamigen Tragödie des Sophokles, widersetzt sich dem Dekret König Kreons und bedeckt den Leichnam ihres Bruders Polyneikes, dem wegen Verrat eine Bestattung verweigert wurde, mit Staub, um ihm den Zutritt zum Totenreich zu ermöglichen. Die Aktion der Tragödin versuchen die Wächter des Herrschers durch das Entfernen der dünnen Staubschicht vom Körper des Toten rückgängig zu machen. Ein Staubsturm sorgt für Turbulenz und als die Bewacher die Augen wieder öffnen können, ertappen sie das junge Mädchen, wie sie ihren Bruder erneut symbolisch begräbt: „Und bringet Staub mit beiden Händen, schnell, und aus dem wohlgeschlagnen Eisenkruge kränzt sie dreimal mit Ergießungen den Toten.“ Prinzipientreue gegen Regimetreue, Familienliebe gegen das Recht des Staates – so werden die Handlungen der Gegenspieler kontrastiert. Die Heldin begründet im Eingangsdialog ihr Tun zugleich noch mit einer ganz nüchternen  Abwägung: Die von Kreon angedrohte Todesstrafe schrecke sie aus folgendem Grund nicht: „Und dann ist’s mehr Zeit, daß denen drunten ich gefall, als hier. Dort wohn ich ja für immer einst.“ Der Staubsturm, der dieser mutigen jungen Frau, die als Leitfigur des zivilen Ungehorsams erachtet wird, zu Hilfe kommt, zeigt, dass ihr Handeln auf die Sympathie der Elemente stößt. Der Entstaubungsversuch der Schergen des Regenten hingegen erfolgt aus blanker Angst vor der Autorität.
Abwägung: Die von Kreon angedrohte Todesstrafe schrecke sie aus folgendem Grund nicht: „Und dann ist’s mehr Zeit, daß denen drunten ich gefall, als hier. Dort wohn ich ja für immer einst.“ Der Staubsturm, der dieser mutigen jungen Frau, die als Leitfigur des zivilen Ungehorsams erachtet wird, zu Hilfe kommt, zeigt, dass ihr Handeln auf die Sympathie der Elemente stößt. Der Entstaubungsversuch der Schergen des Regenten hingegen erfolgt aus blanker Angst vor der Autorität.
Ausgehend von einer Betrachtung über die ewige Natur und ihren zyklischen Charakter mahnt der Dichter Horaz im Jahre 13 vor Christus in einer seiner Oden, dass uns nichts vor dem unumkehrbaren Tod bewahrt und dass niemand weiß, ob es ein Morgen gibt. „Sind aber wir hinabgesunken, wo der fromme Aeneas, wo der reiche Tullus und Ankus ist, o dann sind wir Staub und Schatten.“ Pulvis et umbra wurde zum Topos eines meist tröstlich gemeinten memento mori. Als Empfehlung für die Gestaltung des Daseins hat Horaz neben der Aufforderung, die verbleibende Zeit zu nutzen (carpe diem) bestimmt auch das Ideal der Seelenruhe (Ataraxia) des griechischen Philosophen Epikur, zu dessen Schülern der Römer sich explizit zählte, im Sinn gehabt.
Wie der Spruch von der melancholisch-tröstlichen Beliebigkeit bei nur geringem Perspektivwechsel ins Grauenhafte kippen kann, beobachtet Wilhelm Raabe in seiner Erzählung „Fabian und Sebastian“ (1882): „Wir sagen: Es ist ein anderes, ruhig und ergeben zu wissen: Pulvis et umbra sumus, Staub und Schatten sind wir; und ein anderes, mitten im Tumult und Genuß bei vollständigen Leib- und Seelenkräften zu merken: Staub und Nacht sind über dir und um dich, rieselnder Sand und Dunkelheit werden dich begraben!“ Hoffen auf den Tod und die Angst vor ihm, der mal als Freund und Teil des Lebens und mal als Horror auftreten kann, beides parallelisiert sich in der Doppelgesichtigkeit des Staubs, der uns freundlich einhüllen oder grausam ersticken kann.
Im Alten Testament ist Staub vielfach mit der Besinnung auf die Vergänglichkeit alles Irdischen verbunden und oft tief pessimistisch konnotiert. „Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück.“ (Gen 3,19). Alles wurde erschaffen und ist daher dem Verfall unterworfen. Der Mensch hat somit keinen Grund zum Hochmut. Der Begriff der vanitas steht im Mittelpunkt des Predigers Salomon; dieser in der Einheitsübersetzung mit „Windhauch“ übertragene Begriff wird bei Martin Luther zu „Eitelkeit“ im Sinne von Nichtigkeit, leerer Schein. Der Versuch, sich mit dem Ansammeln irdischer Güter gegen den Tod wappnen zu wollen oder sich gegenüber anderen erschaffenen Wesen für privilegiert zu halten, ist zum Scheitern verurteilt . „Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: wie dies stirbt, so stirbt er auch, und haben alle einerlei Odem […]; denn es ist alles eitel. […] es ist alles von Staub gemacht und wird wieder zu Staub.“ (Prediger 3,19-20).
Der Vanitas-Gedanke wurde in der bildenden Kunst, in der er einen ganzen Kanon von Symbolen eröffnete, mannigfaltig aufgegriffen. Das Gemälde „Allegorie der Vergänglichkeit“ (Alegoría de la vanidad, 1634) des Barockmalers Antonio de Pereda y Salgado zeigt beispielhaft eine Ansammlung von Dingen, die auf einer Tischplatte wie zufällig ausgebreitet sind und als Kommentar die Unterschrift „nil omne“ (alles ist nichtig) tragen: eine erloschene Kerze, mehrere Totenschädel, eine abgelaufene Sanduhr, Geld und Schmuck, ein Kartenspiel und auf den Haufen geworfene Teile eines Ritterpanzers. Doch die zentrale Gestalt ist ein Engel, der in der rechten Hand ein Porträt Kaiser Karls V. haltend mit der linken auf einen Globus zeigt – ein Hinweis auf die Eroberungen in der Ära des Habsburgers, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, der indes zum Zeitpunkt der Entstehung des Gemäldes bereits den Weg alles Irdischen gegangen war. Dann, wenn der Staub die Nachfolge des Herrschers antritt, erhalten die nutzlos gewordenen, in gespensterhafte Zwischenreiche verbannten Dinge ihre neue Bedeutung als Allegorien der ablaufenden Zeit, eine Art Gegenwelt, die noch Jorge Luis Borges im 20. Jahrhundert in seinem Gedicht „Die Sanduhr“ (El reloj de la arena, 1960) beschwört:
So steht’s vor uns, das allegorische Gerät,
das wir gestochen sehn in Nachschlagwerken,
das Stück, das von ergrauten Antiquaren
verwiesen wird in jene Aschenwelt
des Schachbrettläufers ohne Partner, des
entmannten Degens, des verwischten Teleskops,
des Sandelholzes, an dem Opium frißt,
des Staubs, des Ungefähren und des Nichts.
Das Sonett „Während du mit Deinem Haar um die Wette strahlst“ (Mientras por competir con tu cabello, 1582) des Lyrikers und Dramatikers Luis de Góngora y Argote kann als ein Beispiel für eine Vanitas-Darstellung gelten, die eine moralisierende Absicht verfolgt. Einer vornehmen Dame wird verdeutlicht, dass sich ihr noch güldenes Haar genauso wie sie selber am Ende ihres Lebens „zu Erde, zu Rauch, zu Staub, zu Schatten“ und schließlich „zu Nichts“ verflüchtigen wird. Eitelkeit ist hier zugleich in seiner anderen Bedeutung, der Selbstverliebtheit zu verstehen. Erde, Rauch, Staub, Schatten und Nichts können als Stufenleiter des Verfalls angesehen werden.
Kaum ein Barockdichter, bei dem man die Thematik des Körpers zwischen Schönheit und Verfall nicht findet. Martin Opitz sieht zum Beispiel in seiner „Beschluß Elegie“ (1623) die Liebe als Vergängliches, weil sie an den Körper gebunden ist.
Wo soll die Schönheit seyn / wann alles wird vergehen /
Die Lippen von Corall / diß Alabaster Bild /
Die Augen so jhr seht gleich als zwo Sonnen stehen /
Der rothe Rosenmund / der weissen Brüste Schild?
Sie sollen / wie ich hör als Asch‘ vnd Staub entfliehen/
Vnd gehen allzugleich den Weg der Eitelkeit.
Dementgegen steht die Sicht des Francisco de Quevedo, der in der Schlusszeile von seinem „Sonett an Lisi“ (Soneto a Lisi, 1648) in dem Bild des „verliebten Staubs“ seinen Glauben an die Liebe, die über den Tod hinaus reicht, manifestiert.
Andreas Gryphius will die Symbolik der Kurzlebigkeit als Aufforderung verstanden wissen, sich vom Irdischen ab- und dem Göttlichen zuzuwenden. In seinem Sonett „Es ist alles Eitel“ (1637) werden, wie auf zahlreichen anderen Vanitas-Darstellungen, gleich mehrere Attribute kombiniert:
Ach! was ist alles diß / was wir vor köstlich achten /
Als schlechte Nichtigkeit / als Schatten / Staub vnd Wind;
Als eine Wiesen-Blum / die man nicht wider find’t.
Noch wil was ewig ist kein einig Mensch betrachten!
Die Todesverfallenheit auf den gesamten Planeten übertragend findet sich bei den Dichtern der Empfindsamkeit zahlreich die heute fast vergessene Metapher des Staubbewohners, die im Grimmschen Wörterbuch noch wie folgt definiert ist: „bewohner des staubs (d. h. der irdischen, vergänglichen welt im gegensatz zum göttlichen jenseits)“ sowie „armer, kleiner, irrender mensch“. In dem Gedicht „Die Geliebte“ (1774) stellt Ludwig Christoph Heinrich Hölty die subjektive, zeitlose Sphäre der Geliebten der irdischen Welt gegenüber, die als Schöpfung zu verehren der Verliebte in seinem Wahn verpasst:
Würde mein heißer Seelenwunsch Erfüllung,
Brächt‘ ein gütig Geschick mich ihr entgegen,
Eine flügelschnelle Minut‘ in ihrem
Himmel zu athmen;
Seliger wär‘ ich dann als Staubbewohner.
O dann würd‘ ich den Frühling beßer fühlen,
Beßer meinen Schöpfer in jeder Blume
Schauen und lieben!
Fast zweihundert Jahre später ist in Pablo Nerudas „Ode an ein paar gelbe Blumen“ (Oda a unas flores amarillas, 1956) die nur kurzzeitig aufblitzende Betrachtung einer Blume bedeutender als das in seinem endlosen Rhythmus für Ewigkeit stehende Meer.
Staub sind wir, werden wir sein.
Nicht Luft, nicht Feuer noch Wasser,
sondern
Erde,
Erde allein
werden wir sein,
vielleicht
ein paar gelbe Blumen.
Von den alchemistischen vier Elementen gehört dem staubgeborenen Menschen die Erde, mit und auf der er – wie eine bescheidene Blume – seine Zeit zu bestehen hat.
In Nerudas „Ode an den alten Dichter“ (Oda a un viejo poeta, 1956) zerfällt die Rose, die der sterbende alte Poet in seinen Händen gehalten hat, am Ende seines Lebens genauso wie sein Körper zu Staub.
Dort ließ ich ihn umherwandernd zurück,
bedrängt von seinem Tod, […]
[…]
und Hand in Hand
gingen beide fort,
hin
zu einem leeren Schlafgemach,
als würden sie schlafen in ihm,
wie wir schlafen werden
und alle
Menschen:
eine
welke
Rose
in
der
Hand,
die ebenfalls stirbt,
zu Staub verwandelt.
Der Dichter und Theologe John Donne kontrastiert in seinen „Andachten“ (Devotions, 1624) den durch seine Körperlichkeit Krankheit und Schwäche ausgelieferten Menschen mit der Weite der Möglichkeiten seines Geistes. Der nach dem Bilde Gottes Erschaffene existiert doch ständig am Rande des Nichts: „Wie ist es bestellt um den Menschen in all seinem großen Denken und Handeln, wenn er am Ende doch nur schwindet und wird zu einer Handvoll Staub?“
Ein verzweifelter Mensch kann sich, obwohl noch am Leben, bereits in der Ewigkeit des Todes wähnen. Die Imagination findet ihre phobische Ausprägung in der Idee, lebendig begraben zu werden. In der viktorianischen Ära war die Taphephobie, d. h. die zu der damaligen Zeit nicht ganz unberechtigte Angst scheintot beerdigt zu werden, besonders verbreitet. Edgar Allan Poe nahm sich dieses Themas mit den Kurzgeschichten „Das vorzeitige Begräbnis“ (The Premature Burial, 1844) sowie „Der Untergang des Hauses Usher“ (The Fall of the House of Usher, 1839) u. a. an.
In Alfred Tennysons langem Gedicht „Maud“ (Maud, 1855) wird der Protagonist, nachdem er vom Hinscheiden der Geliebten erfahren hat, in der Irrenanstalt von der Wahnvorstellung, lebendig unter dem Trottoir der Stadt beerdigt zu sein, verfolgt.
Tot, längst tot,
Längst tot!
Und eine Handvoll Staub mein Herz,
Und über den Kopf mir die Räder jagen“
Das zur Handvoll Staub verkommene Herz steht für den Tod der großen Liebe.
Nach den Schlachten des Ersten Weltkriegs, die die Welt einmal mehr als das wahre Reich des Todes erkennbar werden ließen, nimmt auch Thomas Stearns Eliot im Eingangskapitel seines Jahrhundertgedichts „ Das wüste Land“ (The Waste Land, 1922) John Donnes Sentenz wieder auf. Inspiriert vom 12. Kapitel des Predigers Salomon lässt er die Vision einer abgestorbenen Landschaft erstehen und bringt sie in Zusammenhang mit dem existenziellen, nun also über psychiatrische Kategorien hinausgreifenden Grundphänomen der Angst, das das Zwanzigste Jahrhundert bestimmt:
Und ich will dir weisen ein Ding, das weder
Dein Schatten am Morgen ist, der dir nachfolgt,
Noch dein Schatten am Abend, der dir begegnet;
Ich zeige dir die Angst in einer Handvoll Staub.
Die Überschrift des Kapitels, aus dem diese Zeilen stammen, „Die Beerdigung der Toten“ (The Burial of the Dead) nimmt Bezug auf das in der anglikanischen Kirche in revidierter Form bis heute gültige „Allgemeine Gebetbuch“ (Book of Common Prayer, 1549). Dort finden sich die bei christlichen Begräbnissen benutzten Begriffe „Staub“ und „Asche“ in Verbindung mit dem Gedanken einer Auferstehung der Toten: „Nachdem es dem Allmächtigen Gott nach seiner weisen Vorsehung gefallen hat, die Seele unseres entschlafenen Bruders aus dieser Welt zu sich zu nehmen, legen wir seinen Leib in Gottes Acker – Erde zur Erde, Asche zur Asche, Staub zum Staube – in Erwartung der allgemeinen Auferstehung am jüngsten Tage“.
In Evelyn Waughs Roman „Eine Handvoll Staub“ (A Handful of dust, 1934) geht es um eine Art Tour de Force des Scheiterns, eine exemplarische Darstellung der Absurdität des Lebens: Nachdem der englische Adelige Tony Last beruflich wie privat Schiffbruch erlitten hat, versucht er als Begleiter eines Forschungsreisenden einen Neuanfang und findet sich am Ende wie lebendig begraben im brasilianischen Urwald als Gefangener eines Siedlers wieder, der sich Mr. Todd nennt, und dem er immer und immer wieder aus den Werken von Charles Dickens vorzulesen hat. In seinem Afrika-Roman „Am unteren Flusslauf“ (The Lower River, 2012) griff Paul Theroux diese Motivik abermals auf.