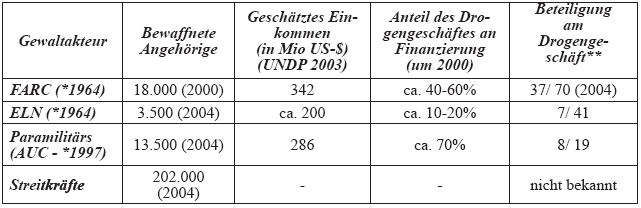Auf ihrem jüngsten Treffen in Madrid im Juni 2022 hat die NATO unter Federführung Washingtons ein neues Strategiekonzept verkündet, in dem Russland als größte Bedrohung definiert und China als Herausforderer der „wertebasierten Ordnung“ ins Visier genommen wird. Damit ist auch für den letzten Zweifler klar, dass die Weltpolitik in eine Ära der offenen Großmächte-Rivalität zurückgekehrt ist, die in erschreckend Vielem an die Situation vor dem Ersten Weltkrieg erinnert. Damals bildete Europa das Epizentrum des Kampfes um den „Platz an der Sonne“, während die USA sich in der Tradition des sogenannten Isolationismus abseits zu halten schienen. Aber es war gerade Washingtons Krieg gegen Spanien, in dem 1898 der Startschuss für das Rennen um die Neuaufteilung der Welt abgefeuert wurde. Erstmals jagte eine neue imperialistische Macht einem Imperium der „Alten Welt“ die Reste seines Kolonialbesitzes ab. Die USA, die 1776 selbst aus einer anti-kolonialen Revolution hervorgegangen waren, mauserten sich damit zum anerkannten Mitglied im Klub der imperialistischen Großmächte. Ein bedeutsamer Aufstieg, den sie mit ihrer Teilnahme an der Niederschlagung des chinesischen Boxeraufstandes (2. November 1899 – 7. September 1901), Seite an Seite mit Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich-Ungarn, Russland und Japan, besiegelten. Es sind diese Zusammenhänge, die dazu herausfordern, nochmals einen Blick auf jenen „splendid little war“ zu werfen.
Vorgeschichte: Von der inneren zur äußeren Expansion
Zwischen dem Friedensvertrag von Paris, mit dem die britische Kolonialmacht 1783 die Unabhängigkeit der USA anerkannte, und dem Jahr 1898 liegen mehr als 100 Jahre, in denen die USA ihr Territorium mehr als vervierfachten. Es gibt wohl keinen modernen Staat, der in – historisch gesehen – so kurzer Zeit zur Kontinentalmacht expandierte. Bereits 1867, als Washington von Russland gegen die Zahlung von 7,2 Mio. Dollar Alaska erworben hatte, umfasste das US-Territorium eine Fläche von 9.370.031 km², d.h. damals fehlten lediglich knapp 500.000 km² bis zur heutigen Ausdehnung der nordamerikanischen Supermacht. Die wichtigsten Etappen der territorialen Ausdehnung der USA nach Westen werden durch den Louisiana Purchase (1803), die Annexion von Texas (1845), die Teilung des Oregon-Territoriums (1846) und den Krieg gegen Mexiko (1846-1848) markiert. Bereits der Kauf der französischen Kolonie Louisiana für 15 Mio. Dollar erbrachte eine Verdoppelung des damaligen Territoriums von 2.310.619 km² auf 4.455.095 km². Unter der Präsidentschaft von James Polk (1845-1849) vergrößerten sich die USA noch einmal um insgesamt 3.120.668 km², wobei Krieg (gegen Mexiko) bzw. die Androhung von Krieg (gegen Großbritannien) eine entscheidende Rolle spielten. Der Erwerb von Kuba, bis 1898 letztes Juwel des spanischen Kolonialimperiums in Amerika, scheiterte hingegen an der Weigerung Madrids.
Bereit dieser kurze Überblick offenbart zwei Grundmuster der Expansion der USA: Geld und Krieg. Ob Washington soft power (Geld) oder hard power (Krieg) bevorzugte, hing von der jeweiligen Kosten-Nutzen-Kalkulation ab. Ideologisch wurde der Aufstieg der USA zur Kontinental- und später (ab 1898) auch zur Hegemonialmacht durch das Konzept des Manifest Destiny, nach dem ihnen das gottgegebene Recht der permanenten Expansion zufiel. Dieser Anspruch richtete sich sowohl gegen das Ein- oder Vordringen externer (europäischer) Mächte (Frankreich, Großbritannien, Spanien) als auch gegen schwache Nachbarn (Kanada, Mexiko) und die indigene Urbevölkerung. Abgesichert wurde dieses Vorgehen durch die Monroe-Doktrin, die bis heute einen Eckpfeiler der US-amerikanischen Außenpolitik bildet. In dieser proklamiert Washington einseitig ein Verbot kolonialer Neuerwerbungen durch europäische Staaten in der Westlichen Hemisphäre, womit zugleich der Hegemonialanspruch der USA auf dem Doppelkontinent formuliert wird.
 Hauptopfer sind neben Mexiko, das mit dem Friedensvertrag von Guadelupe Hidalgo mehr als die Hälfte seines damaligen Territoriums verliert, die indigenen Völker Nordamerikas. So lebte zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiet der heutigen USA zwischen 5 und 15 Millionen Indianer, deren Zahl sich bis zum Ende des Jahrhunderts auf knapp 200.000 Überlebende drastisch reduzierte (Keating 2020, S. 13). Auch wenn der größte Teil der Urbevölkerung durch Krankheiten, die von Siedlern aus der „Alten Welt“ eingeschleppt worden waren, getötet wurde, spielen solche systematisch angewandten Techniken des Genozids an den Indianern wie die zahlreichen Massaker an Wehrlosen, die Tötung von Millionen von Büffeln, die Vertreibung in unwirtliche Gebiete, die Zerstörung der Sozialstrukturen und die Umerziehung der Kinder in residential schools eine zentrale Rolle bei der „inneren“ Expansion des Siedlerstaates (Chavez/ Phan 2018). Gemäß der „logic of elimination“ (Patrick Wolfe), die dem Siedlerkolonialismus immanent ist, hatte auch die weiße Bevölkerung der USA ein elementares Interesse an immer mehr Land, keineswegs aber an der dort lebenden indigenen Bevölkerung. Diese galt vielmehr als Hindernis für Wachstum und Fortschritt, so dass das Motto „Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer!“ bis zum Ende der Indianerkriege und der offiziellen Schließung der frontier im Jahr 1890 gängige Praxis war.
Hauptopfer sind neben Mexiko, das mit dem Friedensvertrag von Guadelupe Hidalgo mehr als die Hälfte seines damaligen Territoriums verliert, die indigenen Völker Nordamerikas. So lebte zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiet der heutigen USA zwischen 5 und 15 Millionen Indianer, deren Zahl sich bis zum Ende des Jahrhunderts auf knapp 200.000 Überlebende drastisch reduzierte (Keating 2020, S. 13). Auch wenn der größte Teil der Urbevölkerung durch Krankheiten, die von Siedlern aus der „Alten Welt“ eingeschleppt worden waren, getötet wurde, spielen solche systematisch angewandten Techniken des Genozids an den Indianern wie die zahlreichen Massaker an Wehrlosen, die Tötung von Millionen von Büffeln, die Vertreibung in unwirtliche Gebiete, die Zerstörung der Sozialstrukturen und die Umerziehung der Kinder in residential schools eine zentrale Rolle bei der „inneren“ Expansion des Siedlerstaates (Chavez/ Phan 2018). Gemäß der „logic of elimination“ (Patrick Wolfe), die dem Siedlerkolonialismus immanent ist, hatte auch die weiße Bevölkerung der USA ein elementares Interesse an immer mehr Land, keineswegs aber an der dort lebenden indigenen Bevölkerung. Diese galt vielmehr als Hindernis für Wachstum und Fortschritt, so dass das Motto „Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer!“ bis zum Ende der Indianerkriege und der offiziellen Schließung der frontier im Jahr 1890 gängige Praxis war.
Mit dem Ende des Bürgerkrieges (1865), dem Bau großer Infrastrukturprojekte wie der ersten transkontinentalen Eisenbahn (1869), der landwirtschaftlichen Erschließung der Great Plains (verstärkt ab 1880) und der rasch voranschreitenden Industrialisierung (ab 1865) wuchsen die USA zur ökonomischen Großmacht heran. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zeigten alle volkswirtschaftlichen Indikatoren steil nach oben: Die Zahl der Arbeitskräfte stieg von 6 Mio. (1870) auf 30 Mio. (um 1900), in dieser Zeitspanne wuchs der Wert der industriellen Güter von ca. 3 Mrd. Dollar auf über 13 Mrd., das Bruttosozialprodukt verdreifachte sich zwischen 1869 und 1896, das Pro-Kopf-Einkommen stieg von 1860 bis 1890 um 150 Prozent und das Nettoeinkommen der Industriearbeiter im selben Zeitraum um 50 Prozent (Czaja 2004, S. 13, Fußnote 5).
Der rasante Aufstieg wurde jedoch von der Wirtschaftskrise 1893-1897 abrupt unterbrochen. Beide Faktoren – das schnelle Wachstum des Binnenmarktes und die Depression beförderten Ende des 19. Jahrhunderts den Übergang von der inneren zur äußeren Expansion. Hinzu kam, dass in den 1890er Jahren die spanische Kolonialherrschaft in Kuba und den Philippinen in eine tiefe Krise geraten war, was den lang gehegten Begehrlichkeiten zur Annexion auf US-amerikanischer Seite einen neuerlichen Schub verlieh. Eine dritte Krise, der rapide Niedergang Chinas, trieb den imperialistischen Wettlauf zur Aufteilung Chinas weiter voran. Als er 1894-1898 seinen bisherigen Höhepunkt erreichte, fühlte sich Washington zusätzlich unter Entscheidungsdruck gesetzt. Sowohl die Regierung als auch die Unternehmer setzten angesichts dieser drei sich überlappenden Krisen auf eine expansionistische Politik, deren doppelte Stoßrichtung auf die Karibik bzw. den Pazifik zielte und im Spanisch-Amerikanischen Krieg schließlich ihren markanten Kulminations- und Umschlagpunkt fand (Schoonover 2003, S. 65ff, 101). „Auch wenn sich die Transformation der Rolle der USA in der Welt nicht auf ein singuläres Ereignis reduzieren lässt, so stellt doch der Spanisch-Amerikanische Krieg den Durchbruch dieser Entwicklung dar, über den der spätere Präsident Woodrow Wilson (1902 – P.G) treffend äußerte: ‚No war ever transformed us quite as the war with Spain transformed us.’“ (Viehrig 2013, S. 7)
Der Krieg gegen Spanien: Verlauf und Ergebnisse
Den Anlass für den Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 lieferte der Unabhängigkeitskampf des kubanischen Volkes gegen die spanische Kolonialherrschaft. Nachdem der erste Unabhängigkeitskrieg 1868-1878 gescheitert war, nahmen die Independendistas unter Führung von José Martí, Antonio Maceo und Máximo Gómez 1895 den zweiten Versuch, die Insel zu befreien. Der zweite Unabhängigkeitskrieg begann am 24. Februar mit dem Grito de Baire. Der frühe Tod von Martí, der als ziviler Führer der Revolution zugleich deren strategischer Kopf und bedeutendster Außenpolitiker war, am 19. Mai 1895 riss eine Lücke, die trotz späterer militärischer Erfolge von keinem der übrigen Führungspersönlichkeiten ausgefüllt werden konnten. Die Spanier reagierten mit äußerster Brutalität auf den Guerillakampf der Mambí-Armee. Obwohl die Mehrheit der US-Bevölkerung mit den kubanischen Rebellen sympathisierte, blieb die Frage, ob Washington militärisch intervenieren sollte, vorerst offen.
Als es am 15. Februar 1898 zu einer verheerenden Explosion auf dem US-Kriegsschiff Maine kam, das zu einem nichtgenehmigten „Freundschaftsbesuch“ im Hafen von Havanna vor Anker lag, nahm der Kongress in Washington dies zum Anlass, um am 19. April eine Resolution zu verabschieden, die eine militärische Intervention auf Kuba erlaubte. Am 21. April ordnete US-Präsident William  McKinley (1897-1901) eine Seeblockade der Insel an, woraufhin Spanien am 23. April den USA den Krieg erklärte. Die USA, die schon lange Begehrlichkeiten gegenüber Kuba entwickelt und dort auch wirtschaftlich eine starke Präsenz aufgebaut hatten, gingen gut vorbereitet in den Kampf gegen Spanien. Sie begannen ihren Expansionskrieg jedoch nicht in der Karibik, sondern im östlichen Pazifik. Nachdem sie den Hafen von Hongkong verlassen hatte, besiegte die US-Asienflotte am 1. Mai 1898 das spanische Pazifik-Geschwader in der Bucht von Manila. Im Juni landeten die ersten US-Truppen auf Kuba und am 25. Juli besetzten sie Puerto Rico. Bereits am 3. Juli war die gesamte spanische Atlantikflotte von der weit überlegenen US-Kriegsmarine in der Seeschlacht vor Santiago de Cuba vernichtet worden. Die menschlichen Verluste direkter Kriegshandlungen waren auf Seiten Spaniens zwar höher (775 Gefallene) als die der USA (nach unterschiedlichen Angaben 345 bzw. 385 Gefallene), insgesamt aber relativ niedrig (der Historiker Raymond Carr geht von insgesamt 2.129 Gefallenen aus – alle Zahlenangaben aus: Küppers 2013, S. 12).
McKinley (1897-1901) eine Seeblockade der Insel an, woraufhin Spanien am 23. April den USA den Krieg erklärte. Die USA, die schon lange Begehrlichkeiten gegenüber Kuba entwickelt und dort auch wirtschaftlich eine starke Präsenz aufgebaut hatten, gingen gut vorbereitet in den Kampf gegen Spanien. Sie begannen ihren Expansionskrieg jedoch nicht in der Karibik, sondern im östlichen Pazifik. Nachdem sie den Hafen von Hongkong verlassen hatte, besiegte die US-Asienflotte am 1. Mai 1898 das spanische Pazifik-Geschwader in der Bucht von Manila. Im Juni landeten die ersten US-Truppen auf Kuba und am 25. Juli besetzten sie Puerto Rico. Bereits am 3. Juli war die gesamte spanische Atlantikflotte von der weit überlegenen US-Kriegsmarine in der Seeschlacht vor Santiago de Cuba vernichtet worden. Die menschlichen Verluste direkter Kriegshandlungen waren auf Seiten Spaniens zwar höher (775 Gefallene) als die der USA (nach unterschiedlichen Angaben 345 bzw. 385 Gefallene), insgesamt aber relativ niedrig (der Historiker Raymond Carr geht von insgesamt 2.129 Gefallenen aus – alle Zahlenangaben aus: Küppers 2013, S. 12).
Im Friedensvertrag von Paris, den beide Kriegsparteien am 10. Dezember 1898 unterzeichneten, musste Spanien Puerto Rico (einschließlich der Spanischen Jungferninseln), Guam und die Philippinen an die USA abtreten und erhielt dafür von den USA 20 Mio. US-Dollar. Wie im sogenannten Teller-Amendment vom 16. April 1898 festgelegt, wurde Kuba formal von Spanien unabhängig, blieb aber bis 1902 unter US-Besatzung. Durch die Aufnahme des Platt-Amendment in die kubanische Verfassung von 1901 wurde die faktische wirtschaftliche, politische und militärische Abhängigkeit Kubas von den USA besiegelt. Bis zu seiner Aufhebung 1933, die im Zuge der Good Neighbor Policy unter Franklin D. Roosevelt erfolgte, hatten die USA jederzeit das Recht, in Kuba zu intervenieren, was sie nach der Gründung der Republik Kuba 1902 auch mehrfach (1906-1909, 1912, 1917-1922) taten. Bis heute unterhalten sie an der Bucht von Guantanamo gegen den Wille der kubanischen Regierung einen Militärstützpunkt. Im Schatten des Spanisch-Amerikanischen Krieges annektierte Washington am 12. August 1898 außerdem die Republik Hawaii. Ein Jahr später teilten sich die USA mit Deutschland die Samoa-Inseln, die auf halbem Wege zwischen Hawaii und Neuseeland im Pazifik liegen. Als Amerikanisch-Samoa sind sie bis heute eine Kolonie der USA.
Durch ihren schnellen und überwältigenden militärischen Sieg über Spanien etablierten sich die USA mit dem Übergang ins 20. Jahrhundert nicht nur als neue imperialistische Kolonialmacht mit Besitzungen in der Karibik und im Pazifik. Darüber hinaus nutzten sie ihren Machtzuwachs, um sich als regionale Hegemonialmacht in der von ihnen als Einflussgebiet beanspruchten Westlichen Hemisphäre zu profilieren. Bereits im Vorfeld des Spanisch-Amerikanischen Krieges hatte Washington im Grenzstreit zwischen der britischen Kolonie Guyana und Venezuela, der 1895 ausgebrochen war, ihre Fähigkeit deutlich gemacht, die Monroe-Doktrin nunmehr auch gegen den Widerstand Großbritanniens geltend zu machten. Deren Erweiterung in Gestalt des Roosevelt Corollary 1904, mit der sich die USA selbst zum „Sheriff“ im karibisch-lateinamerikanischen „Hinterhof“ ernannten, war nur folgerichtig. Mit wechselnden Strategien, die vom Big Stick über die Dollar Diplomacy bis zur bereits erwähnten Good Neighbor Policy reichten, baute Washington seine Hegemonialposition weiter aus. Im Verbund mit ihrer ökonomischen Stärke besaßen die USA drittens alle Voraussetzungen, um nunmehr gegenüber der imperialistischen Konkurrenz den Status einer Weltmacht einzufordern. Die spezifische Verknüpfung dieser drei Dimensionen – Kolonial-, Hegemonial- und Weltmacht – stellt nicht nur eine neue Qualität in der Erfolgsstory der USA dar, sondern legt zugleich den Grundstein für ein global ausgreifendes American Empire, das mit den Siegen der USA im Ersten und Zweiten Weltkrieg klare Konturen gewann.
Weltpolitische Verknüpfungen: Konsequenzen für das American Empire
Was macht nun den Spanisch-Amerikanischen Krieg zum Kristallisationspunkt im American Empire-building? Legt man den dreifach neuen Status der USA als Kolonial-, Hegemonial- und Weltmacht zugrunde, dann ergeben sich – direkt und indirekt – folgende Konsequenzen aus dem Krieg von 1898: Die erste betrifft die Geopolitik. Der schnelle und vergleichsweise leichte Sieg über Spanien bestätigte nicht nur den Status der USA als moderne Seemacht, sondern legte auch den Grundstein dafür, dass die junge US-Navy bis Anfang der 1920er Jahre mit der britischen Kriegsflotte gleichziehen konnte. Die Fertigstellung des Panamakanals im August 1914, der durch eine gesonderte US-Militärzone gesichert wurde, tat ein übriges, dass die USA neben Großbritannien zur führenden Seemacht aufstiegen. 1898 bildete zudem den Schlusspunkt im Kampf um die Hegemonie über die Westliche Hemisphäre. Die Ausschaltung aller Rivalen und das neue geopolitische Gewicht der USA hatten zur Folge, dass sich die USA nunmehr als geostrategisch gut geschützter de facto Insel-Staat von kontinentalen Ausmaßen etablieren konnten. „Thus, although the U.S. was not an island, it transform itself into an island-State for strategic purposes by eliminating al rivals to its hegemony in the Western Hemisphere. The Spanish-American War of 1898 was the last step toward this goal.“ (Akturk 2006, S. 66) Dieser nordamerikanische Inselstaat – umgeben von zwei Ozeanen und schwachen bzw. freundlichen Nachbarn – bildet seit seiner Vollendung 1898 den Kern des American Empire.
Eine zweite Konsequenz des Sieges von 1898, die sich als ein weiterer Kulminationspunkt des amerikanischen Empire-buildings erweisen sollte, war die Herausbildung eines neuen, US-spezifischen Typus des Imperialismus. „Es darf als unbestritten gelten, daß der Spanisch-amerikanische Krieg von 1898 mit dem durch ihn bewirkten Erwerb von Kolonien in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika und ihres Verhältnisses zur Außenwelt im eigentlichen Sinn des Wortes Epoche gemacht hat.“ (Angermann 1967, S. 694) Der neue Status als „moderne Kolonialmacht“ (Daniel Immerwahr) geriet in Konflikt mit dem anti-kolonialen Gründungsmythos der USA, welcher mit der „Imperialismus-Debatte“ im Zuge des Krieges von 1898 offen ausbrach. Während es die Anhänger einer imperialistischen Expansion unter Führung des späteren Präsidenten Theodore Roosevelt (1901-1909) als Pflicht der dazu „auserwählten“ USA ansahen, die Bevölkerung der Philippinen ebenso wie die Kubaner und andere, nicht-weißen Völker im Namen von Manifest Destiny und Monroe-Doktrin zu „zivilisieren“, argumentierten die „Anti-Imperialisten“, dass die „koloniale Herrschaft über andere Völker gegen das Lebensgesetz der amerikanischen Demokratie verstoße“ (ebenda, S. 716).
Der Streit um die US-amerikanischen Kolonien, die bis heute Teil des American Empire sind, geht jedoch in mehrfacher Hinsicht am Kern des Problems vorbei. Denn im Unterschied zu den imperialistischen Ländern Europas gehört der Besitz eines „klassischen“ überseeischen Kolonialreiches nicht zu den zentralen Kriterien des US-Imperialismus. Auch schon vor der Entlassung der Philippinen in die Unabhängigkeit 1946 waren die US-Kolonien im Pazifik und in der Karibik im Vergleich zum nordamerikanischen Kernland eher unbedeutend. Vielmehr bildet das informal Empire der Westlichen Hemisphäre den Hauptteil der abhängigen Peripherie der US-Imperialismus. Die bis heute als Kolonien gehaltenen Territorien, von denen Puerto Rico mit einer Fläche 8.870 km²die größte ist, gehören funktional zu „Baselandia“ (Immerwahr 2019, S. 503-527), dem einzigartigen „Imperium der US-Militärbasen“, das sich über alle Weltmeere erstreckt und weltweit ca. 800 Stützpunkte umfasst. Der diesem Imperium innewohnende Militarismus führt nach Meinung des prominenten US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Chalmers Johnson zum „Selbstmord der amerikanischen Demokratie“. Andere Kolonialgebiete, die von den USA entweder annektiert (Hawaii 1898) oder von europäischen Mächten gekauft worden waren (Louisiana 1803, Florida 1819, Alaska 1867), sind heute als Bundesstaaten in die USA integriert. Wenn über den US-Imperialismus debattiert wird, bleibt meist ein spezieller, die USA seit ihrer Gründung prägender Typus des Kolonialismus un- oder kaum berücksichtigt. Es handelt sich dabei um den Siedlerkolonialismus, unter dem die indigenen Völker der American Indians, Alaska Natives und Native Hawaiians bis heute zu leiden haben. Alles in allem zeichnet sich der US-Imperialismus, der sich nach 1898 herausgebildet hat, durch eine spezifische Kombination folgender Elemente aus: Der Kern besteht aus einem geopolitisch bestens geschützten Siedlerimperium mit kontinentaler Dimension, das – wie die imperialistischen Mächte Europas – alle Merkmale eines hochentwickelten Monopolkapitalismus aufweist, während sich die abhängige Peripherie vom europäischen Muster des klassischen Kolonialreichs unterscheidet darin unterscheidet, dass die eigenen Kolonien nicht sehr zahlreich sind und – verglichen mit dem Kern – ein relativ kleines Territorium umfassen. Historisch gesehen stellen sie die Ausgangsbasis für das spätere, global ausgreifende „Imperium der Militärbasen“ dar.. Anders als beim europäischen Typus ist das „informal Empire“ mit Lateinamerika und der Karibik als unmittelbar an den Kern anschließender „Großraum“ eine sicherheitspolitische und ökonomische Schlüsselkomponente des American Empire unter dem Schutz der Monroe-Doktrin., während die Expansion nach Ostasien (China) damals (noch) nach dem Prinzip der „offenen Tür“ (open door policy) erfolgt Die hier beschriebene Struktur ist maßgeblich das Ergebnis des Krieges von 1898.
In dieser Gestalt repräsentiert das American Empire eine imperialistische Weltmacht, die in der Lage ist, die „Feuertaufe“ der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts ebenso siegreich zu bestehen wie den „Kalten Krieg“ gegen die Sowjetunion. Die Weichenstellung für die geostrategische Platzierung in diesen Kämpfen um die globale Hegemonie wird in entscheidendem Maße durch die Ergebnisse des Krieges von 1898 bestimmt, der damit den dritten Kulminationspunkt des American Empire-building darstellt. Während sich die USA mit Großbritannien weitgehend einigen können, geraten sie mit ihrer doppelten Expansion nach Süden (Lateinamerika und Karibik) und Westen (Pazifik bis Ostasien) zunächst in Konflikt mit Deutschland, später dann auch mit Japan. Aus dieser Konstellation ergibt sich a) sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg die Gegnerschaft der USA gegenüber Deutschland (1917-1918 bzw. 1941-1945) und b) der Konflikt mit Japan im Zweiten Weltkrieg (1941-1945). In allen drei Weltkonflikten formt sich das American Empire weiter aus, bis es schließlich knapp hundert Jahre nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg den Status einer globalen Supermacht ohne Konkurrenz erlangt. In diesem „unipolaren Moment“ (1990-2008) erreicht das American Empire seinen Höhepunkt, der sich jedoch zugleich als Kipppunkt (ab 2001) erweist. Auf dem Weg von der kolonialen Peripherie (bis 1776) über die Errichtung eines kontinentalen Siedlerimperiums mit semi-peripherem Status (bis 1898) und den Aufstieg zur imperialistischen Weltmacht (ab 1898) bis zur globalen Supermacht im Zentrum des kapitalistischen Weltsystems (ab 1990) erweist sich der Krieg von 1898 in der Retrospektive als erster, entscheidender Kulminationspunkt im American Empire-building. Er reicht damit in seiner Bedeutung weit über einen „prächtigen kleinen Krieg“ hinaus.
———————————————–
Literatur:
Akturk, Sener: A Military History of the New World Order and the Emergence ot he U.S. Hegemony, in: Alternatives. Turkish Journal of International Relations, vol. 5 (Spring & Summer 2006) No. 1 &2, S. 65-72
Angermann, Erich: Der Imperialismus als Formwandel des amerikanischen Expansionismus. Eine Studie über den Gedanken einer zivilisatorischen Sendung der Vereinigten Staaten, in: Jahrbuch für die Geschichte Lateinamerikas, Jg. 4 (1967), S. 694-725
Keating, Jessica: The Assimilation, Removal and Elimination of Native Americans. An Expert Guide, University of Notre-Dame 2020
Chavez Cameron, Susan/ Phan, Loan: Ten Stages of American Indian Genocide, in: Revista Interamericana de Psicología/ Interamerican Journal of Psychology, vol. 52 (2018) 1, S. 25-44
Czaja, Marek: Die USA und ihr Aufstieg zur Weltmacht um die Jahrhundertwende: die Amerikaperzeption der Parteien im Kaiserreich. Berlin 2004 (S. 13, Fußnote 5)
Immerwahr, Daniel: Das heimliche Imperium. Die USA als moderne Kolonialmacht. Frankfurt a. M. 2019
Küppers, Anne: Der Spanisch-Amerikanische Krieg. CGS-Discussion Paper 11, Bonn, Oktober 2013
Schoonover, Thomas: Uncle Sam’s War of 1898 and the Origins of Globalization. The University Press of Kentucky 2003
Viehrig, Johannes: „Propheten der Expansion“. Ideologische Grundlagen des amerikanischen Imperialismus zwischen Bürgerkrieg und Erstem Weltkrieg. Dissertation, Jena 2013
Zeuske, Michael: Insel des Extreme. Kuba im 20. Jahrhundert. Zürich 2000 (2., aktualisierte und stark erweiterte Auflage)
Bildquellen: [1] cooper_david_pixnio_cc; [2] wiki_cc; [3] quetzal-redaktion_gc