Aus dem Luxusgut Kaffee ist ein lifestyle-Produkt geworden. Das Getränk wird heute oft schnell, mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und einer großen Palette verschiedener Zutaten zubereitet und konsumiert. Die Kaffeekultur in Deutschland hat sich verändert, aber für die Tagelöhner auf den Kaffeeplantagen der Anbauländer ist alles beim alten geblieben. Viele leben in extremer Armut, geplagt von Hunger und Hoffnungslosigkeit.
Die Hose des achtjährigen Miguel hat mehrere Löcher, eins direkt über der linken Pobacke. Entweder hat er das noch nicht bemerkt oder es ist ihm egal. Wenn er sich reckt und streckt, um an die hohen Kirschen der Kaffeepflanzen zu gelangen, kann man sowieso sehen, dass er keine Unterhose trägt. „Manchmal sind wir richtig wütend“, schimpft er. „Es gibt Tage, da haben wir nicht genug zu essen. Dann tut uns der Magen weh.“
Hunger trotz fruchtbarer Felder
Die junge Frau Aleida Putúl wippt rhythmisch mit den Schultern, damit ihre kleine Tochter aufhört zu weinen. Sie hat sich das Baby mit einem Tuch auf den Rücken gebunden. Doña Aleida steht als letzte hinter acht Müttern, die alle auf die Ausgabe von Medikamenten und Nahrungsmittelhilfen warten. Auf dem Boden neben ihr sitzen zwei kleine Mädchen und halten sich an ihrem Rock fest. Bei allen drei Töchtern hat der Kinderarzt Symptome von Unterernährung festgestellt. Das Projekt Clinica Maxeña im Hochland von Guatemala bietet seinen bedürftigen Patienten billige Gesundheitsversorgung und Vorsorgekurse an. Doña Aleida ist dankbar. „Für uns ist das eine große Hilfe. Wir haben nicht viel Geld, und manchmal reicht das Essen nicht. Deshalb kommen wir hierher. Der Doktor hat meine Kinder schon oft geheilt.“
Doktor Aroldo Ixcot empfängt die Kinder in einem schlichten Büro, das vor Jahren mit Spendengeldern des deutschen Hilfswerks Adveniat ausgestattet wurde. „Die meisten Krankheiten der Bevölkerung werden durch ungenügende Ernährung verursacht. Die Armut ist extrem. Während der Erntesaison suchen vor allem Arbeiter der Kaffeeplantagen unsere Hilfe. Dort kommen sie mit Pestiziden in Berührung, mit Chemikalien. Hier in Santo Tomas gibt es eine, meiner Meinung nach, außergewöhnlich hohe Zahl an Krebserkrankungen: Rückenmarkkrebs, Magenkrebs, Leukämie. Es wäre sicher sinnvoll, zu überprüfen, woher das kommt. Die meisten dieser Leute sind seit Jahren in Kontakt mit Pestiziden, und sie haben keinerlei Schutz.“
Die Clinica Maxeña ist vor dreißig Jahren von einem US-amerikanischen Missionarsehepaar gegründet worden. Die Krankenschwester Sheila kam in den achtziger Jahren nach Santo Tomas. Sie ist eine resolute, zupackende Frau. Wenn es darum geht, hungernden Kindern zu helfen, ist sie engagiert bei der Sache. „Die Situation wird immer gravierender“, berichtet sie. „Jeden Tag sehen wir mehr unterernährte Kinder, vor allem Kleinkinder, die noch keine fünf Jahre alt sind. Deshalb haben wir mit einem Ernährungsprogramm begonnen. Den Hauptgrund für die Unterernährung der Kinder sehen wir bei den Müttern, die selber Hunger leiden. Nach der Geburt haben sie nur wenig Milch. Die trocknet schon bald aus, so dass die Säuglinge schnell unterernährt sind.“
In der Umgebung der Clinica Maxeña – auf über tausend Meter Höhe – sind die Anbaubedingungen ideal. Es regnet häufig. Alles ist grün, der Boden fruchtbar. Eigentlich sollte niemand Hunger leiden müssen. Zudem steigt die globale Nachfrage nach den braunen Bohnen stetig. Auf den Kaffeeplantagen der Großgrundbesitzer herrscht eifrige Geschäftigkeit. Doch den wirklichen Profit machen nur sehr wenige Personen. Der Anthropologe Virgilio Reyes von der staatlichen Universität USAC verweist auf die Statistik: „Zwei Prozent der Bevölkerung besitzen 65 Prozent des Landes. Die meisten Kleinbauern verfügen nur über kleine Grundstücke in kargen Bergregionen.“
Kinderarbeit auf den Kaffeeplantagen
Miguel trägt keine Schuhe, dafür aber eine Schirmmütze, auf die in dicken Lettern der Werbeslogan einer politischen Partei geschrieben steht: „Gemeinsam für den Fortschritt!“ Ich traf den kleinen Jungen bei einem Spaziergang durch die Felder der Finca San Jaime. Er hatte sich gerade einen Unterarm blutig gekratzt und saß nun im Schatten eines Kaffeestrauchs, um über die Wunde zu lecken. „Manchmal hängen nur wenige Kirschen am Strauch“, sagt er. „Dann strengst du dich fast umsonst an. Ich denke, unser Leben sollte nicht so sein.“
Miguels Bruder, der vierzehnjährige José, wischt sich mit einem schmutzigen Handrücken den Schweiß aus der Stirn. Er findet es nicht in Ordnung, dass kleine Kinder in der Hitze stehen und Kaffee ernten müssen. „Aber nur wenn wir alle zusammen arbeiten, wird es uns vielleicht eines Tages besser gehen“, glaubt er. „Mein Vater allein schafft das nicht. Die Besitzer der Kaffeefelder behandeln uns wie Hunde, aber wir wissen, dass wir alle gleich sind im Leben.“
Georg Krämer, Entwicklungssoziologe und Mitarbeiter des Welthauses Bielefeld, hat zahlreiche Analysen zur Problematik der Kinderarbeit veröffentlicht. „Auf der einen Seite bedeutet die Arbeit der Kinder ein Einkommen für die Familien“, sagt er. „Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass es zu Überausbeutung kommt, zur Ausnutzung der Kinder, zu gesundheitlichen Schäden durch zu viel Arbeit, durch das Schleppen der schweren Kaffeesäcke. Die Einhaltung von Mindeststandards müsste kontrolliert werden, um zu vermeiden, dass die Arbeit zu Gesundheitsschäden führt.“
Für Josés Mutter, Doña Marta, ist es normal, dass alle ihre Kinder von klein auf arbeiten. Ihre beiden Töchter haben eine feste Anstellung, die eine als Putzhilfe bei einer wohlhabenden Familie, die andere in einer Schneiderei. Auch Doña Marta hat schon als kleines Mädchen gearbeitet. Heute ist sie eine junge Frau, der die Last der Verantwortung ins Gesicht geschrieben steht. „Wir kämpfen mit den Kindern ums Überleben. Es geht ja nicht anders. Die Kleinen müssen das Arbeiten lernen, um Geld zu verdienen“
Während Doña Marta spricht, schaut sie schüchtern auf den Boden. An ihren schmutzigen, mit Risswunden übersäten Füßen trägt sie einfache Plastiksandalen mit kaputten Riemen. „Ich sage meinen Kindern, dass sie hart sein müssen. Das tut mir weh, aber so ist das Leben.“
Der Fincabesitzer
 Dem Besitzer der Finca San Jaime, Don Jaime Bonifaz, gehören zahlreiche Ländereien im Westen Guatemalas. Er ist 64 Jahre alt, hat graues Haar und einen auffällig dicken Bauch. Aber er ist fitt und unternehmungslustig. Auf seinen Reisen nach Europa und in die USA verhandelt er mit Geschäftspartnern und genießt das Nachtleben von Miami und Rotterdam. Seine Familie wohnt in einem exklusiven Viertel der guatemaltekischen Hauptstadt. Er selber verbringt seine Zeit lieber auf einer seiner sechs Fincas. Der kleine Miguel hat den Mann, für den er arbeitet, schon öfter gesehen. „Don Jaime ist ein wütender Mann. Er schimpft mit den Leuten und manchmal tritt er nach ihnen. Wer ihn um Arbeit bittet, den nennt er einen Dieb. Wenn er glaubt, jemand habe von ihm gestohlen, droht er mit einem Gewehr.“
Dem Besitzer der Finca San Jaime, Don Jaime Bonifaz, gehören zahlreiche Ländereien im Westen Guatemalas. Er ist 64 Jahre alt, hat graues Haar und einen auffällig dicken Bauch. Aber er ist fitt und unternehmungslustig. Auf seinen Reisen nach Europa und in die USA verhandelt er mit Geschäftspartnern und genießt das Nachtleben von Miami und Rotterdam. Seine Familie wohnt in einem exklusiven Viertel der guatemaltekischen Hauptstadt. Er selber verbringt seine Zeit lieber auf einer seiner sechs Fincas. Der kleine Miguel hat den Mann, für den er arbeitet, schon öfter gesehen. „Don Jaime ist ein wütender Mann. Er schimpft mit den Leuten und manchmal tritt er nach ihnen. Wer ihn um Arbeit bittet, den nennt er einen Dieb. Wenn er glaubt, jemand habe von ihm gestohlen, droht er mit einem Gewehr.“
Der Großvater von Don Jaime, Don Jaime senior, ist zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts aus Spanien nach Santo Tomas gekommen. Vor bald hundert Jahren hat er die erste Kneipe der Gegend eröffnet. Diese Geschichte hat José schon oft gehört. „Der alte Don Jaime hat den Leuten das Land weggenommen. Er hat Bier verkauft, aber weil die meisten nicht zahlen konnten, haben sie sich verschuldet. Auf diese Weise hat er sehr viel Land bekommen.“
Heute ist die Finca San Jaime der zentrale Standort des Landbesitzes von Jaime Bonifaz. Dort betreibt er auch eine Weiterverarbeitungsanlage für Kaffee, von der aus jedes Jahr rund fünfzigtausend Sack Kaffee in die Welt geschickt werden.
An der Einfahrt des Geländes der Finca San Jaime steht kein Schild, kein Hinweis auf Privatbesitz, keine Warnung, die den Zutritt verbieten würde. Trotzdem wissen die Leute, dass hier das Hoheitsgebiet von Jaime Bonifaz beginnt.
Die schmale Sandpiste führt kilometerweit vorbei an Kaffeefeldern soweit das Auge sehen kann. Plötzlich eröffnet sich der Blick auf eine riesige Wiese. Einige Jungen spielen Fußball. Zwischen den Kaffeefeldern liegt eine 900 Meter lange Graspiste, auf der ab und zu Don Jaimes jüngster Sohn mit seinem Privatflugzeug landet.
Während der Erntezeit kommt Don Jaime oft auf die Finca, um mit einem seiner Geländewagen über die verschlungenen Wege zwischen den Kaffeefeldern zu fahren und die Arbeit der knapp tausend Tagelöhner zu begutachten.
Sein Wohnhaus, die Hacienda, liegt hinter Stacheldraht inmitten der Finca. Miguel erzählt, er habe seinen Vater schon einige Male auf das Anwesen begleitet: „Es ist riesig, mit einem Schwimmbad. In dem Garten stehen viele Bäume mit Bananen, Mandarinen und Orangen. Dort lebt auch ein großer Hund, und es gibt viele Autos. Die Wächter lassen niemanden ohne Erlaubnis rein. Sie haben Gewehre und verstecken sich.“
Wochenlang hatte ich mich erfolglos um ein Gespräch mit Jaime Bonifaz bemüht. Auch zahllose Telefongespräche mit seiner freundlichen Privatsekretärin in einem Bürogebäude der Hauptstadt blieben ohne Ergebnis. Deshalb entschloss ich mich, in Santo Tomas auf ihn zu warten. Endlich fährt er in einem blitzsauberen, neuen Geländewagen an mir vorbei. An einer Kreuzung muss er halten. Ich klopfe an sein Fenster, stelle mich vor und bitte ihn um ein Interview. „Was bringt mir das?“ fragt er zurück. „Das interessiert mich nicht.“
Edgar Tec, der Vater von Miguel und José, wundert sich nicht, dass Don Jaime keine Zeit für mich hat: „Diese Leute sind nur am Geld interessiert. Wenn sie keinen Vorteil für sich sehen, bist du ihnen egal.“
Das sieht der Vorarbeiter Camilo anders. Er zeigt Verständnis für den rüden Charakter seines Chefs: „Er ist sehr streng, sehr ernst, anspruchsvoll. Wenn seine Persönlichkeit milder wäre, könnte er nicht die Kontrolle über all seine Geschäfte bewahren. Er muss aggressiv und kompromisslos sein, um die Fäden in der Hand zu behalten.“
Später bekomme ich doch noch Gelegenheit, Don Jaime näher kennen zu lernen. Ich hatte mein Auto neben einigen Hütten der fest angestellten Arbeiter seiner Finca geparkt. Als ich nach einer Weile zum Wagen zurückkomme, sind alle vier Reifen platt! Ich vermute, das hat Don Jaime veranlasst. Zudem ist die Zufahrtsstraße mit einem Balken und einem dicken Eisenschloss versperrt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als bis nach Santo Tomas zu laufen und Don Jamie in den Büroräumen der Fabrik um Hilfe zu bitten. Zuerst schimpft er: „Was fällt Ihnen ein, auf meine Finca zu fahren?“ Dann aber gibt er sich doch freundlich und hilfsbereit. Er bietet mir an, meine Reifen persönlich wieder mit Luft zu füllen.
Während wir in seinem Auto zurück zur Finca fahren, erzählt er einen anzüglichen Witz nach dem anderen. Zweimal hält er an, um mit jungen Frauen zu flirten, die am Straßenrand stehen. Offenbar lebt er in Santo Tomas wie ein König. Alle kennen den dicken Fincabesitzer, alle machen einen Diener vor ihm. Trotzdem flucht er, das Dorf sei voller Ganoven, die ihm seinen Kaffee stehlen wollen. Damit hat er wahrscheinlich Recht. José jedenfalls kennt einige Jungen, die schon öfters Kaffeekirschen geklaut haben. „Wenn sie überhaupt kein Geld und nichts zu essen haben, dann stehlen sie Kaffee. Aber wer erwischt wird, der wird eingesperrt.“ Miguel kann von drastischen Strafmaßnahmen berichten: „Letztens haben sie einen Mann geschnappt und ihn bis auf die Unterhose ausgezogen. Alle Leute mussten ihn treten. Die Wächter haben uns gesagt, dass sie diejenigen, die Kaffee klauen, ins Bein schießen werden. Gestern noch haben sie ganz in unserer Nähe auf einen Mann geschossen. Ich habe mich sehr erschrocken.“
Der Lohn
Auf der Finca San Jaime bekommen die Tagelöhner 36 Quetzales für das Pflücken von vier Kisten voll Kaffeekirschen. Das sind etwa drei Euro für hundert Pfund. Soviel kann ein ausdauernder Arbeiter an einem Tag pflücken, aber nur, wenn die Bedingungen günstig sind. Mit der Hilfe seiner Kinder schafft er natürlich mehr.
Doña Marta und ihre beiden Söhnen haben an diesem Tag nur knapp zwei Euro verdient. José ist enttäuscht. „Es werden so 24, 26 Quetzales sein, obwohl wir zu dritt gepflückt haben. Aber zum Essen brauchen wir 30 bis 40 Quetzales. Es reicht also nicht.“
Ein Liter Milch kostet in Guatemala fast einen Euro. Auch Fleisch ist teuer. Das kann sich Doña Marta nur selten leisten. Dafür sind frisches Obst und Gemüse günstig. Aber der Warenkorb für eine ausreichende Ernährung, so wie ihn das Kinderhilfswerk UNICEF beschreibt, steht Doña Marta nie zur Verfügung. Sie verdient ja nicht einmal den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn, und selbst der liegt weit unter dem Existenzminimum. Der Vorarbeiter Camilo gesteht unumwunden ein, dass er den Tagelöhnern zu wenig zahlt: „Sie bekommen weniger als den Mindestlohn und das auch nur während der Erntezeit. Den Rest des Jahres gibt es keine Arbeit. So gesehen geht es ihnen hier zur Zeit noch gut. Richtig hart wird es erst wieder, wenn die Ernte vorbei ist.“
Kurz bevor die Sonne untergeht, schleppen die Tagelöhner ihre gefüllten Säcke aus allen Winkeln der Kaffeefelder bis zu einer Wegkreuzung, an der sie sich in eine Wartereihe hinter einem Lastwagen stellen. Auf der Ladefläche steht Don Camilo mit einem Schreibblock unterm Arm. Darin sind alle Familien registriert, die auf der Finca arbeiten. Hinter den Namen trägt er die jeweiligen Ernteergebnisse ein. Meist entscheidet Don Camilo nach Augenmaß über das Gewicht der Kaffeesäcke. Doch wenn er es genau wissen will, werden die Kaffeekirschen nach und nach in eine Holzkiste gefüllt, in die angeblich genau 25 Pfund passen. Der junge Mann räumt ein, dass er nicht immer das exakte Gewicht in sein Heftchen notiert: „Wenn sich jemand nicht ordentlich benimmt, schreibe ich nicht alles auf. Zum Beispiel versuchen manche, mich reinzulegen, so wie der Mann dort drüben. Er hat gesagt, in seinem Sack seien fünf Kästen voll. Wir haben das überprüft. Es waren nur vier. Er wollte uns also bestehlen.“
Don Camilo ist nicht besorgt, dass er die Ernteergebnisse der Arbeiter fehlerhaft berechnen könnte. Wenn er am Ende der Woche die Summe bekannt gibt, protestiert nie jemand. Die meisten Pflücker können weder lesen noch rechnen. Außerdem wissen sie, dass es sich nicht lohnt, einen Streit anzufangen.
Der erfahrene Erntearbeiter Oscar Ilap gibt sich genügsam: „Manche Aufseher bestehlen uns. Aber wir sind nicht gekommen, um Probleme zu suchen. Wir sind zufrieden, mit dem was wir bekommen.“
Die Wohnverhältnisse
Einer der wenigen fest angestellten Arbeiter der Finca San Jaime ist Victor Pastor. Er verdient den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn von 57 Quetzales am Tag. Das sind fast fünf Euro. Während der Erntezeit ist es seine Aufgabe, die Kaffeebohnen in der Sonne zu trocknen. Mit Schaufeln und Rechen wenden er und einige seiner Kameraden die Bohnen auf einem großen Platz mit Zementfußboden.
In seiner Jugend war Don Victor selber Wanderarbeiter. Damals, vor fünfzig Jahren, schlief er nachts auf dem Fußboden der großen Wohnställe, den so genannten galeras. Seither hat sich nur wenig an den Wohnbedingungen der Wanderarbeiter verändert. „In den galeras ist das Leben hart“, sagt Don Victor. „Der Boden ist die blanke Erde. Die wird oft nass und schlammig. So war es immer. Aber die reichen Besitzer interessieren sich nicht dafür. Sie haben ja Geld. Die Armen müssen das aushalten, weil sie ihre Familie ernähren müssen. Da kann man nichts machen. Wenn sich jemand beschwert, sagt der Verwalter: ‚Wer arbeiten will, soll arbeiten, wer nicht will, soll abhauen. Hier wird niemand zurückgehalten.’“
Da geht es Miguel und José besser. Sie können jeden Abend nach Hause gehen. Ihre Hütte liegt keine Stunde Fußweg von dem Kaffeefeld entfernt. Das Grundstück hat die Mutter von einer Tante geerbt. José ist stolz auf sein Heim. „Unser Schlafzimmer ist aus Stein. Die angebaute Küche aus Lehm. Es ist ein einfaches Haus, ein respektables Haus, mit einem Dach, unter dem wir nicht nass werden. Ich danke Gott dafür, dass wir einen Ort haben, in dem wir wohnen können. Andere Leute haben das nicht.“
Insgesamt wohnen sieben Personen in dem einzigen Raum der Hütte. Sie schlafen auf drei Lagern. Über die Hälfte der guatemaltekischen Bevölkerung ist noch keine zwanzig Jahre alt. Die Zahl der Grundschulen hat sich in den letzten Jahren vervielfacht, so dass heute die meisten Kinder zumindest ein paar Jahre lang unterrichtet werden. José aber will nach der vierten Klasse eine Pause einlegen: „Es ist besser, wenn ich mir Arbeit suche. Ich werde wahrscheinlich nur wenig Lohn bekommen, aber erstmal kann ich nicht weiter zur Schule gehen. Meine Eltern haben nicht genug Geld.“
Erst seit kurzem bemüht sich die guatemaltekische Regierung ernsthaft darum, sicher zu stellen, dass die Bildung an den öffentlichen Schulen wirklich kostenlos ist. Trotzdem müssen viele der Unterrichtsmaterialien noch immer von den Eltern bezahlt werden. Für Josés Mutter bedeutet das eine große Bürde. „Er will nicht weiter zur Schule gehen, weil wir noch immer Schulden haben, wegen der Materialien im letzten Jahr. Ich sage ihm, dass wir das Geld schon irgendwie auftreiben werden. Aber ich habe vier Kinder. Manchmal kann ich nur dem einen Geld geben und dem anderen nicht.“
Der faire Handel
In Deutschland interessieren sich zunehmend mehr Kaffeekonsumenten für die Arbeitsbedingungen der Erntearbeiter auf den Plantagen. In einigen Fällen kaufen die Betreiberfirmen der Kaffeebars die Bohnen direkt bei Kleinbauerkooperativen in den Anbauländern. So werden Zwischenhändler ausgeschaltet und die Produzenten bekommen einen sehr viel besseren Preis ausbezahlt. Ähnlich funktioniert das Prinzip des fair gehandelten Kaffees mit dem TransFair-Gütesiegel. TransFair-Produkte werden heute in den meisten Supermarktketten angeboten. So haben die Konsumenten in Deutschland die Möglichkeit, die Lebensbedingungen einiger kleiner Kaffeeproduzenten und ihrer Familien deutlich zu verbessern.
Auch der Entwicklungssoziologe Georg Krämer aus Bielefeld bevorzugt fair gehandelten Kaffee. Doch er weiß, dass durch den Kauf in dieser Marktnische keine Breitenwirkung erzielt wird. Dafür sind die Absatzmengen zu gering. „Den fairen Handel gibt es in Deutschland seit 1970 mit dem mageren Ergebnis, dass heute zwei bis drei Prozent des Kaffees in Deutschland fair gehandelt werden.“
Bei dieser niedrigen Menge kann der faire Handel nahezu nichts an den Lebensbedingungen des Großteils der Tagelöhner in Ländern wie Guatemala ändern. Um die Situation der Arbeiter auf den großen Kaffeeplantagen zu verbessern, müssten sich die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb des Landes deutlich ändern. Das weiß auch der kleine José, und er möchte einen Beitrag leisten: „Es gibt viele Bauern, die protestieren, damit ihre Rechte respektiert werden. Ich finde es gut, wen sich die Armen zusammenschließen. Ich würde auch gerne kämpfen, für die Rechte der Bauern. Die Situation hier ist furchtbar, aber irgendwann wird es besser werden.“
—————————–
Bildquelle: Andreas Boueke_
Karte: University of Texas at Austin




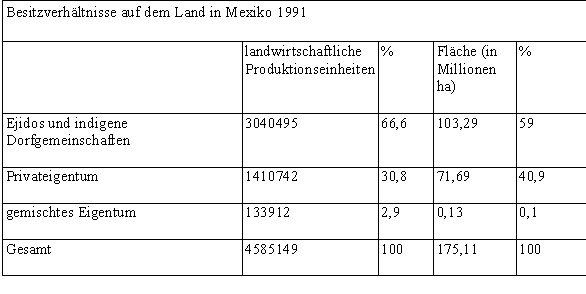


6 Kommentare