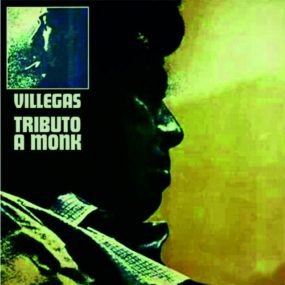Anlässlich der kürzlich erfolgten Veröffentlichung des Debütalbums des Pablo Tarantino Quartetts, Charnia (PK Records 2024), traf sich unser Quetzalmitarbeiter Gonzalo Compañy mit dessen Leiter, dem argentinischen Schlagzeuger, Komponisten und Dozenten Pablo Tarantino. In dem Gespräch, beschreibt der in Leipzig ansässige Musiker einige Mäander seines Lebens – von seiner frühen Kindheit, in der er seine Faszination für die Musik entdeckte, über seine ersten Schritte als Schlagzeuger und seine Ausbildungszeit bis hin zu seiner Etablierung als professioneller Musiker – und reflektiert über den Prozess des Komponierens und die Wechselfälle eines unabhängigen Musikers in der heutigen Welt. Nach dem ersten Teil, folgt nun der zweite Abschnitt eines ausführlichen Gesprächs, das Anfang des Jahres vor dem Lindenauer Markt in der Sächsischen Metropole stattfand.
Um auf das Thema Komposition zurückzukommen, aus welcher Perspektive schreibst du gerade? Du hast erwähnt, es sei damals wie ein Spiel. Wolltest du trotzdem etwas ausdrücken oder nur die erworbenen Werkzeuge in „Bewegung“ setzen?
Ich würde gerne glauben, dass es eher ein Spiel war, aber eigentlich muss ich zugeben, dass es auch etwas Ehrgeiz gab: Ich wollte etwas machen, und zwar einen guten Song. Aber ich sah, dass die Sachen, die herauskamen, nicht so gut waren – im Vergleich zu anderen Sachen, die ich mir angehört hatte und die offensichtlich besser klangen. Manchmal kamen Ideen heraus, die eigentlich Potenzial hatten, aber es war so frustrierend, sie zu formen und zu versuchen, sie besser klingen zu lassen. Mir fehlte auf jeden Fall eine Menge Übung in Sachen Harmonie, eine Menge Arbeit. Ich musste mich mehr ans Klavier setzen, um zu verstehen, warum die Akkorde sich so bewegen, wie sie sich verhalten, und was der Effekt der Voicings ist; all das, was die Pianisten tun. Man musste verstehen, warum das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Wenn ich also damals etwas tat, was man mir im Studium vorgeschlagen hatte, wie beispielsweise: „Schreiben Sie für nächste Woche einen Song mit modalen Wechselakkorden“, oder „mit Verwendung der Dominantenkette, 2-5-1“. Man hatte während des Studiums also sehr spezifische Dinge geübt, innerhalb der harmonischen Möglichkeiten, die zur Verfügung standen. Ich hatte dann die Übungen gemacht, als wären sie reine Mathematik oder Sudoku… Man weißt, dass man in einer bestimmten Tonart 8 Takte hat und dass, wenn man die Struktur „2-5-1, 2-5-1“ anwendet, die Teile miteinander verbindet, sich die Kreise schließt und das Ganze funktioniert.
Reine Form ohne Inhalt, ohne etwas auszudrücken
Das war reine Theorie. Auf der Klangebene funktioniert es auch, aber es ist nicht etwas, das man für einen bestimmten Effekt sucht, um bestimmte Empfindungen auszulösen, sei es mittels des harmonischen Rhythmus oder der Modi, die man verwendet. Erst wenn man Erfahrungen gesammelt hat, weiß man nicht nur, dass es diese Ressourcen gibt, sondern man erkennt auch die Kontexte, um gezielt die passenden Ressourcen einzusetzen. Wenn man dagegen nicht genug Erfahrung hat, um zu wissen, was die einzelnen Modi, die Skalen oder die Harmonien erzeugen, ist es ziemlich schwierig, sie in den Kontext, in dem man sie braucht, zu platzieren. Nachdem ich so viel Theorie gelernt hatte, war es für mich sehr wichtig, Dinge auszuprobieren, Übungen zu machen und dabei zu versuchen, etwas zu schaffen, das Sinn ergibt. Das ist der schwierigste Teil. Deshalb war das Komponieren in den ersten Jahren eher wie ein Sudoku, nur zum Spaß. Es könnte auch sein, dass einige dieser Ideen zwar Sinn ergaben, aber ihr Potenzial nicht ausreichte, um daraus einen Song zu machen.
Was musste in diesem Moment (den wir als Lehrzeit bezeichnen könnten) geschehen, um durch die Technik der Komposition das, was du erzählen oder beschreiben wolltest, auszudrücken?
Das ist für mich die entscheidende Frage. Es ist zwar schwer, den Zeitpunkt herauszufinden, aber das ist der Schlüssel zum Ganzen. Wenn man eher „experimentell“ komponiert, ist es gut, die unterschiedlichen Mittel auszuprobieren und an die Grenzen zu gehen, sowie zu versuchen, Ideen zu entwerfen, die zum Beispiel technisch komplexe Konzepte enthalten, sowohl rhythmisch als auch harmonisch: Polyakkorde, zwei Tonalitäten, die nebeneinander bestehen usw. All das ist auf theoretischer Ebene eigentlich sehr interessant. Doch wenn es um die Umsetzung in die Praxis geht, ist es schwierig zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, diese Elemente anzuwenden. Um die Frage zu beantworten: Für mich war es so, dass eines Tages der Moment kam, in dem ich mich fragte: Wer bin ich in all dem? Um auf den eingangs erwähnten Punkt zurückzukommen: Was ich wissen möchte, ist, wer ich bin. Selbst wenn es sehr schwierig ist, eine derartige Frage zu beantworten, habe ich versucht, das herauszufinden. Also habe ich weiter geschrieben und versucht zu erkennen, welches Ding von all den Dingen, die ich komponierte habe, einen „eigenen“ Charakter hatte. Mir wurde klar, dass meine verschiedenen Einflüsse in mir koexistieren: Genau das bin ich. Gleichzeitig hatte ich auch andere konkrete Strategien, wie z. B. eine Playlist zu erstellen, in die ich Songs einfügte, die ich ganz aus dem Herzen heraus auswählen könnte. Wenn ich einen Song hörte, der mir gefiel oder zu dem ich mich hingezogen fühlte (es konnte aufgrund der Melodie, des Rhythmus‘ etc. sein), fügte ich ihn der Wiedergabeliste hinzu. So habe ich über einen langen Zeitraum hinweg zahlreiche Songs eingesammelt.
Kannst du mir 5 davon nennen?
Ich könnte natürlich eine ganze Reihe von Musiker:innen nennen. Mir sind eine Menge Songs von Aaron Parks und Joel Ross aufgefallen. Von letzterem kann ich Dir einen Song erwähnen, Vartha, von dem ich später herausfand, dass er nicht von Vibraphonist Ross, sondern von Trompeter Ambrose Akinmusire geschrieben wurde. Jedenfalls ist Vartha auf Ross‘ Album Who are you? zu finden.
Der Song ist ironischerweise auf einem Album mit dem Titel Who are you? zu finden…
[Lacht] Das war mir gar nicht bewusst! Ich war von diesem Stück gefesselt. Ich erinnere mich, dass beispielsweise auch ein Song von Brad Mehldau mit seinem Trio herauskam.
…immer im Bereich des Jazz?
Ja, nun, es gab auch einen Song namens Malika, von Lionel Loueke, dem Gitarristen aus Benin. Wenn es um das Komponieren und Spielen geht, zeigt er seine ganz besondere Persönlichkeit, die die afrikanische Tradition seiner Heimat mit der Tradition des Jazz verbindet… das ist äußerst interessant. Das sind nur einige der Songs, an die ich mich jetzt erinnere, aber es gab selbstverständlich auch Stücke aus der klassischen Musik, hauptsächlich von Chopin. Aber auch von Bach, der kommt immer vor.
Bach steckt in Chopin…
Bach ist überall [lacht]. Chopin war schon immer einer der Komponisten, die den größten Einfluss auf mich hatten.
Irgendwann sahst du die Playlist an und es war, als stündest Du vor einem Spiegel?
Es war wie eine Art Experiment. Das war der erste Schritt des Vorhabens, das ich hatte. Als die Playlist relativ lang und vielfältig war, fing ich an, die einzelnen Songs genau analysieren. Ich wollte herausfinden, was diese Anziehungskraft, die dahinter steckt, erklären könnte. Hier befinden wir uns eher im theoretischen Bereich. Die entscheidenden Fragen waren also: Warum interessiere ich mich für diese Songs und was ist es, das mich emotional gesehen anzieht? Und Das zu beantworten, setze mich ans Klavier und schaue mir an, was da passiert. Somit konnte ich sehen, welche Elemente der Autor verwendete, wie die Struktur aussah etc. Nach all diesen einzelnen Analysen habe ich angefangen, Patronen zu finden
Das Genom!
Ja, genau! Das Ohr reagiert auf die Summe der Einflüsse, die man im Laufe seines Lebens erfährt. Die Musik, die man hört, formt unser Ohr und unseren Geschmack. Sobald man mit all dem konfrontiert ist, was auf der Playlist steht, ist es mehr als interessant, dieses Material zu durchleuchten. Was ich dabei lernte, sind die technischen Ressourcen in Bezug auf die Harmonie und alles, was die Musik ausmacht. Dies sind also die Dinge, die meine Emotionen erzeugen. Dann ist es wichtig, alles ruhen zu lassen. Es ist ja nicht so, dass man schon eine Formel in der Hand hat, die man kopieren und auf seine eigenen Songs anwenden kann. Doch wenn man dann Musik schreibt, werden diese Elemente zum Vorschein kommen. Das Interessante an der  Musiktheorie ist, dass man, wenn man sie einmal verstanden hat, beim nächsten Mal, wenn man einen bestimmten Effekt bei Schreiben eines Stückes hervorrufen will, genau weiß, wie man ihn erzeugen kann. Und damit komme ich zum zweiten Teil der Frage, der sich auf das Komponieren meines Albums Charnia bezieht. Wie bereits erwähnt, ging es vor allem darum, ehrlich zu mir selbst zu sein. Das war eine sehr schwierige Aufgabe, weil man auf musikalischer Ebene sehr vom Gruppenzwang konditioniert sind; was man glaubt, was andere von seiner Musik erwarten, nicht wahr? Denn man will Musik schreiben, die inhaltlich interessant und aufregend ist, und gleichzeitig kommerziell gut laufen kann, alles, man will das alles. Aber man kann nicht alles machen: Das ist meist kontraproduktiv und läuft Gefahr, zu einem eher unehrlichen Resultat zu führen. Ich weiß nicht, welches Ergebnis ich mit meiner Platte erzielen werde. Ich weiß nicht, wer sie sich anhören wird, ob sie gut ankommen wird oder nicht. Ich war nicht daran interessiert, Charnia unter diesem Gesichtspunkt zu schreiben. Wenn ich für einen Künstler arbeiten würde, der mich beauftragt, Stücke für eine kommerzielle Veröffentlichung zu schreiben, dann müsste ich bestimmte Komponenten verwenden, die das Publikum hören will. In meinem Fall habe ich die Musik geschrieben, die mir ehrlich eingefallen ist. Und dafür musste ich die Konflikte loslassen, die normalerweise beim Komponieren auftauchen: Das Ego, die inneren Stimmen, die einem sagen: „Nein, diese Akkordfolge ist zu einfach“, „diese Melodie ist zu offensichtlich“, „das wird zu naiv klingen“ etc. Man muss bedenken, dass es eine Menge Kolleg:innen gibt, die wirklich höllisch abgefahrenes Zeug machen – also sehr komplexe Musik. Deshalb wird man in dieser Szene, wenn man mit eher „einfacher“ Musik auftritt, vielleicht nicht so gut aufgenommen. Das Nicht-Musiker-Publikum interessiert mich mehr als das Musiker-Publikum, weil erstere alles eher von der emotionalen Seite her beurteilen und nicht von der theoretischen Ebene. Ich bin eher an jemandem interessiert, der Musik hört, ohne darüber nachzudenken, ob es sich um Jazz oder einen anderen Stil handelt. Es gibt Leute, die meinen: „Da ich keinen Jazz mag, wird mir dieses Album nicht gefallen“. Aber wenn man diese Beziehung nicht herstellen würde und einfach die Musik hören würde – ohne darüber nachzudenken, zu welchem Genre sie gehört oder woher sie kommt, hätte beispielsweise der zeitgenössische Jazz sicherlich mehr Anklang in der Öffentlichkeit. Ich mag es, wenn die Leute der Musik eine Chance geben, sie sorgfältig hören und sehen, ob sie dabei etwas fühlen, unabhängig davon, was auf theoretischer Ebene dahinter steckt. Wenn die Leute etwas empfinden, ist das Ziel erreicht. Meiner Meinung nach ist das der Punkt – und für mich persönlich das Hauptziel. Ich bin überzeugt, dass jeder, der so was tut, sich mit meiner Musik identifizieren kann. Einige der Hindernisse, auf die ich derzeit stoße (und das gilt auch für meine Kolleg:innen), bestehen darin, dass die meisten Leute, die „keinen Jazz hören“, uns nicht zuhören, weil wir unter diesem Etikett stehen – selbst wenn es sich um modernen Jazz handelt. Es gibt Leute, die meinen: „Ich höre keinen Jazz, weil ich keine Ahnung von Jazz habe“. Alle möglichen Vorurteile, die zu Recht damit zu tun haben, dass Jazz mit bestimmten Musikern assoziiert wird, die drei Millionen Noten spielen, während das Publikum im Abseits steht, ohne dass eine Verbindung hergestellt werden kann. Das passiert oft, und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es gibt viele Strömungen innerhalb des Jazz, und meine Musik ist, um auf das Wesentliche zurückzukommen, einfach deshalb Jazz, weil sie eine Geschichte erzählt, eine Melodie und eine Struktur sowie eine Form hat, und nicht zuletzt, weil wir den Raum für die Improvisationen erschaffen. Die Dialoge, die sich zwischen den geschriebenen Teilen abspielen, entsprechen zwar dem Bild des Jazz, aber es ist kein Jazz im Sinne, wie er in den 1930er, 1940er oder 1950er Jahren verstanden wurde. Es gibt Dinge, die damit zu tun haben, weil wir diese Art des Musizierens gelernt haben, aber es ist nicht darauf beschränkt. All dies koexistiert mit anderen Einflüssen, die aus populäreren Genres kommen, wie u. a. argentinischer Volksmusik oder dem Tango, sowie klassischer Musik.
Musiktheorie ist, dass man, wenn man sie einmal verstanden hat, beim nächsten Mal, wenn man einen bestimmten Effekt bei Schreiben eines Stückes hervorrufen will, genau weiß, wie man ihn erzeugen kann. Und damit komme ich zum zweiten Teil der Frage, der sich auf das Komponieren meines Albums Charnia bezieht. Wie bereits erwähnt, ging es vor allem darum, ehrlich zu mir selbst zu sein. Das war eine sehr schwierige Aufgabe, weil man auf musikalischer Ebene sehr vom Gruppenzwang konditioniert sind; was man glaubt, was andere von seiner Musik erwarten, nicht wahr? Denn man will Musik schreiben, die inhaltlich interessant und aufregend ist, und gleichzeitig kommerziell gut laufen kann, alles, man will das alles. Aber man kann nicht alles machen: Das ist meist kontraproduktiv und läuft Gefahr, zu einem eher unehrlichen Resultat zu führen. Ich weiß nicht, welches Ergebnis ich mit meiner Platte erzielen werde. Ich weiß nicht, wer sie sich anhören wird, ob sie gut ankommen wird oder nicht. Ich war nicht daran interessiert, Charnia unter diesem Gesichtspunkt zu schreiben. Wenn ich für einen Künstler arbeiten würde, der mich beauftragt, Stücke für eine kommerzielle Veröffentlichung zu schreiben, dann müsste ich bestimmte Komponenten verwenden, die das Publikum hören will. In meinem Fall habe ich die Musik geschrieben, die mir ehrlich eingefallen ist. Und dafür musste ich die Konflikte loslassen, die normalerweise beim Komponieren auftauchen: Das Ego, die inneren Stimmen, die einem sagen: „Nein, diese Akkordfolge ist zu einfach“, „diese Melodie ist zu offensichtlich“, „das wird zu naiv klingen“ etc. Man muss bedenken, dass es eine Menge Kolleg:innen gibt, die wirklich höllisch abgefahrenes Zeug machen – also sehr komplexe Musik. Deshalb wird man in dieser Szene, wenn man mit eher „einfacher“ Musik auftritt, vielleicht nicht so gut aufgenommen. Das Nicht-Musiker-Publikum interessiert mich mehr als das Musiker-Publikum, weil erstere alles eher von der emotionalen Seite her beurteilen und nicht von der theoretischen Ebene. Ich bin eher an jemandem interessiert, der Musik hört, ohne darüber nachzudenken, ob es sich um Jazz oder einen anderen Stil handelt. Es gibt Leute, die meinen: „Da ich keinen Jazz mag, wird mir dieses Album nicht gefallen“. Aber wenn man diese Beziehung nicht herstellen würde und einfach die Musik hören würde – ohne darüber nachzudenken, zu welchem Genre sie gehört oder woher sie kommt, hätte beispielsweise der zeitgenössische Jazz sicherlich mehr Anklang in der Öffentlichkeit. Ich mag es, wenn die Leute der Musik eine Chance geben, sie sorgfältig hören und sehen, ob sie dabei etwas fühlen, unabhängig davon, was auf theoretischer Ebene dahinter steckt. Wenn die Leute etwas empfinden, ist das Ziel erreicht. Meiner Meinung nach ist das der Punkt – und für mich persönlich das Hauptziel. Ich bin überzeugt, dass jeder, der so was tut, sich mit meiner Musik identifizieren kann. Einige der Hindernisse, auf die ich derzeit stoße (und das gilt auch für meine Kolleg:innen), bestehen darin, dass die meisten Leute, die „keinen Jazz hören“, uns nicht zuhören, weil wir unter diesem Etikett stehen – selbst wenn es sich um modernen Jazz handelt. Es gibt Leute, die meinen: „Ich höre keinen Jazz, weil ich keine Ahnung von Jazz habe“. Alle möglichen Vorurteile, die zu Recht damit zu tun haben, dass Jazz mit bestimmten Musikern assoziiert wird, die drei Millionen Noten spielen, während das Publikum im Abseits steht, ohne dass eine Verbindung hergestellt werden kann. Das passiert oft, und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es gibt viele Strömungen innerhalb des Jazz, und meine Musik ist, um auf das Wesentliche zurückzukommen, einfach deshalb Jazz, weil sie eine Geschichte erzählt, eine Melodie und eine Struktur sowie eine Form hat, und nicht zuletzt, weil wir den Raum für die Improvisationen erschaffen. Die Dialoge, die sich zwischen den geschriebenen Teilen abspielen, entsprechen zwar dem Bild des Jazz, aber es ist kein Jazz im Sinne, wie er in den 1930er, 1940er oder 1950er Jahren verstanden wurde. Es gibt Dinge, die damit zu tun haben, weil wir diese Art des Musizierens gelernt haben, aber es ist nicht darauf beschränkt. All dies koexistiert mit anderen Einflüssen, die aus populäreren Genres kommen, wie u. a. argentinischer Volksmusik oder dem Tango, sowie klassischer Musik.
Genau das ist es, was der Jazz ermöglicht, nicht wahr?
Richtig. Der Jazz ermöglicht mir diese Koexistenz. Jazz ist wunderbar, weil er alles integrieren kann. Man kann jedes Element einbringen und alles in eine Improvisation verwandeln. Das ist großartig. Es gibt einige Musiker, die den Jazz nicht als einen Stil, sondern eher als einen Geist beschreiben – wie eine soziale Bewegung, die darin besteht, sich auszutauschen, weiterzugeben, gemeinsam zu improvisieren und in ein musikalisches Gespräch zu treten. Das ist es, was mich am meisten interessiert.
Was ist in Deiner musikalischen Sprache von Argentinien und Lateinamerika?
Zumindest in dieser Phase habe ich versucht, mich nicht auf eine allzu sehr theoretische Ebene zu begeben. Das heißt, den ganzen Tango oder die ganze argentinische Folklore zu analysieren, bevor ich etwas getan habe. Ich wusste, dass ich, wenigstens in der Kompositionsphase von Charnia, alles, was mir zu Ohren gekommen war, auf natürliche Art und Weise bringen wollte. Es stimmt, dass ich während meiner Laufbahn viele Dinge gelernt habe, als ich Künstler wie Chango Farías Gómez gehört habe. Farías Gómez ist eine meiner grundlegenden Referenzen – ebenso Mercedes Sosa.
War sie auf der Playlist?
Ja, ich erinnere mich, dass es die Zamba para olvidar gab. Das ist ein Stück, das ich sehr bewegend finde. Auch Pedro Aznar hat sie gesungen. Er ist eine meiner argentinischen Vorbilder auf der Ebene der populären Musik. Aznar hat auch starke Verbindungen zur Folklore. Im Fall Cuchi Leguizamóns habe ich mir vorgenommen, mich nicht auf die theoretische Ebene zu begeben und zu versuchen, ihn zu analysieren, denn seine Musik ist äußerst komplex – sie ist jedoch eine ausstehende Aufgabe. Dafür habe ich viel Astor Piazzolla gehört. Für uns Argentinier:innen ist Piazzolla, ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll, ein Riese. Ich erinnere mich, dass ich, als ich noch ein Kind war, eines von Piazzollas Alben, das nicht zu seinen bekanntesten gehört, mehr als 100 Mal anhörte. Dabei handelt es sich um Summit, das Album auf dem Gerry Mulligan spielt. Mein Bruder hatte es für mich auf Kassette übertragen. Diese Platte und sowohl die bekanntesten als auch die wenig bekannten Piazzolla-Songs liefen bei mir zu Hause. Ich erinnere mich, dass Teresa, meine Frau, und ich, als wir 2017 in Berlin ankamen, in eine Buchhandlung gingen und ein fantastisches Buch mit Klavierarrangements von Piazzollas Werken kauften. Wenn auch nicht in aller Tiefe, habe ich dieses Buch analysiert und bin auf einige Werke, die mich bewegt haben, genauer eingegangen. Eines davon, das auf der Playlist stehen sollte, ist Oblivion. Dann gibt es noch andere Stücke, zum Beispiel Sin rumbo. Von diesem Stück habe ich keine Aufnahmen von Piazzolla am Bandoneon gefunden. Gewiss hat er viele Werke komponiert, die nicht in seiner Diskografie verzeichnet sind. Von dort aus begann ich zu untersuchen, was Piazzolla auf harmonischer und melodischer Ebene tat und ich fand dabei einige der Aspekte heraus, die ich über Emotionen bereits erwähnte. Ich weiß nicht, woher sie kamen, aber ich könnte sagen, dass ich Einflüsse aus der Folklore habe, die von Chango Farías Gómez, Mercedes Sosa und den anderen, die ich erwähnt habe, stammen – und auch etwas aus der lateinamerikanischen Musik sowie dem Tango. Vom traditionellen Tango habe ich Julio Sosa am häufigsten gehört, abgesehen von Carlos Gardel. Aus irgendeinem Grund traf mich Julio Sosa sehr hart, als ich bereits als Teenager anfing, dem Tango Aufmerksamkeit zu schenken. Von der populären Musik hat mich Luis Alberto Spinetta erobert, speziell sein Album Pelusón Of Milk, der in meinen Koffer kam, als ich mich auf die erste Reise nach Valencia machte,. Obwohl ich und meine Familie bloß einen Monat dort geblieben sind, reichte diese kurze Zeit völlig aus, um ein tiefes Gefühl der Entwurzelung zu verspüren: Ich litt unter einer brutalen Nostalgie. Damals saß ich jeden Tag vor der Stereoanlage und hörte mir dieses Album an. Es half mir nicht zusammenzubrechen. Ebenso andere Spinetta-Alben, die im Laufe der Zeit erschienen sind. Serú Girán, nicht alles davon; aber es hat mich auch getroffen
Hast du beispielsweise bei der Band Serú Girán darauf geachtet, was der Schlagzeuger, Oscar Moro, spielte, oder gefielen Dir die Songs überhaupt?
Ich war fasziniert von den Kompositionen und den Texten. Einerseits waren sie immer an der Grenze zum Kitsch, was mich besonders als Teenager entsetzte, als ich härteres Zeug hörte und damit konfrontiert wurde; aber andererseits bin ich mit Stevie Wonder aufgewachsen. Selbst wenn ich ihn noch nicht erwähnt habe, ist er nach wie vor eine sehr wichtige Stütze in meinem Leben. Ich habe Stevie-Wonder-Songs gesungen, als ich noch nicht einmal sprechen konnte – beispielsweise I Just Called To Say I Love You. Es gibt Familienanekdoten darüber, wie ich den Titel ausgesprochen habe [Lacht]. Michael Jackson ist ein anderer, den ich ebenfalls nicht nannte, aber er ist auch da auf meinem Podium. Das sind eine Art Säulen, die in meinem Leben ständig präsent waren. Nun, ich denke, gerade weil sie so offensichtlich waren, habe ich sie vorher nicht erwähnt.
Aber zurück zur argentinischen und lateinamerikanischen Musik: Ich sprach von lateinamerikanischer Musik, und hier wollte ich darauf hinweisen, dass meine Eltern eine gewisse Faszination für Juan Luis Guerra hatten, dessen Album Bachata rosa habe ich buchstäblich abgenutzt, weil ich es so oft gespielt habe. Apropos kitschig: Das ist eine Platte, die sich sehr auf diesem Gebiet bewegt, aber sie war doch emotional aufgeladen, und deswegen für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Fito Páez ist ebenfalls unverzichtbar. Ich würde sagen, vor allem zwei seiner Alben, denn den Rest habe ich aus den Augen verloren. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich seine Platten Tercer Mundo und El amor después del amor gehört habe, und welche fantastische Wirkung sie auf mich hatten. Wenn ja, kann ich nicht mit Präzision sagen, in welcher Form diese  Einflüsse in Charnia aufgetreten sind. Wenn sie nicht herausgekommen sind, werden sie es sicher irgendwann tun. Ich habe das Gefühl, dass es einige Dinge gibt, die erschienen sind, die in irgendeiner Weise mit all dem zu tun haben. Einige Aspekte vom Tango sind zweifelsohne in The Uproot, in dem das Weinen sehr präsent ist. Ein Lied, das einzig und allein uns allen gewidmet ist, die wir im Leben entwurzelt sind, musste unbedingt etwas Tango enthalten. Aber das ist etwas, das sich ergeben hat, ohne dass ich es suchte. Dieser Song hat sich ergeben, und es war eines der wenigen Stücke, die herauskamen, als ob sie schon immer da gewesen wären. Zumindest die grundlegende Idee kam sehr fließend heraus. Es gibt andere Stücke, die ich während des Schreibens viel singe, viel am Klavier umschreibe usw., aber dieser Song kam heraus, als wäre er… Eine Stimme fiel mir ein, die andere Stimme kam dazu, der Bass machte das eine, das Klavier das andere, dann überschneiden sie sich mit der Saxophon-Melodie. All das kam heraus, als wäre es schon fertig, das schwöre ich dir. Und so etwas, wie bereits erwähnt, passiert sehr selten. Glücklicherweise hatte ich in den Tagen, als das geschah, nicht viele Verpflichtungen, so dass ich mich hinsetzen und die Ideen aufschreiben konnte. Ich hatte mit einer Sache angefangen, mir den zweiten Teil und den nächsten Abschnitt ausgedacht, und erst am Ende habe ich ihn fertig geformt. Anschließend habe ich einen Abschnitt eingefügt, eine Art freien Abschnitt. Wie wir am Anfang besprochen haben, war dies nämlich ein Abschnitt, den ich Jahre zuvor geschrieben und aufbewahrt hatte; und irgendwann erinnerte ich mich daran und sagte: Das ist es, was ich genau brauche! Das war der Übergang zum „freien Teil“, der sich dann mit der erneuten Belichtung des A-Teils verbindet. Das ist mir einfach so eingefallen, wie aus dem Nichts. Aber das ganze Stück im Allgemeinen, glaube ich, habe ich in ein paar Tagen geschrieben. Danach habe ich es überarbeitet, aber der Song ist einfach so entstanden, von Anfang bis Ende, einfach so. Jetzt sehe ich, dass es reine Nostalgie war, die sich so präsentierte, als würde sie die Noten empfangen. Es klingt ziemlich prätentiös, aber so war es. Das erinnert mich an etwas, das Julio Cortázar 1977 in einem Interview mit Joaquín Soler Serrano für das spanische Fernsehen (TVE) erwähnte. Er sagte, dass die Erzählungen zu ihm kamen, dass die Geschichten in gewisser Weise schon geschrieben waren und seine Aufgabe nur darin bestand, ihnen einen „Rahmen“ zu geben. In meinem Fall, selbst wenn ich sicherlich nicht so viele Ressourcen wie Cortázar habe … Ich weiß nicht, wie schwer es für ihn war, aber ich habe das Gefühl, dass er, sobald er den Kern einer Erzählung getroffen hatte, eine unendliche Anzahl von Ressourcen hatte, um sie zu gestalten.
Einflüsse in Charnia aufgetreten sind. Wenn sie nicht herausgekommen sind, werden sie es sicher irgendwann tun. Ich habe das Gefühl, dass es einige Dinge gibt, die erschienen sind, die in irgendeiner Weise mit all dem zu tun haben. Einige Aspekte vom Tango sind zweifelsohne in The Uproot, in dem das Weinen sehr präsent ist. Ein Lied, das einzig und allein uns allen gewidmet ist, die wir im Leben entwurzelt sind, musste unbedingt etwas Tango enthalten. Aber das ist etwas, das sich ergeben hat, ohne dass ich es suchte. Dieser Song hat sich ergeben, und es war eines der wenigen Stücke, die herauskamen, als ob sie schon immer da gewesen wären. Zumindest die grundlegende Idee kam sehr fließend heraus. Es gibt andere Stücke, die ich während des Schreibens viel singe, viel am Klavier umschreibe usw., aber dieser Song kam heraus, als wäre er… Eine Stimme fiel mir ein, die andere Stimme kam dazu, der Bass machte das eine, das Klavier das andere, dann überschneiden sie sich mit der Saxophon-Melodie. All das kam heraus, als wäre es schon fertig, das schwöre ich dir. Und so etwas, wie bereits erwähnt, passiert sehr selten. Glücklicherweise hatte ich in den Tagen, als das geschah, nicht viele Verpflichtungen, so dass ich mich hinsetzen und die Ideen aufschreiben konnte. Ich hatte mit einer Sache angefangen, mir den zweiten Teil und den nächsten Abschnitt ausgedacht, und erst am Ende habe ich ihn fertig geformt. Anschließend habe ich einen Abschnitt eingefügt, eine Art freien Abschnitt. Wie wir am Anfang besprochen haben, war dies nämlich ein Abschnitt, den ich Jahre zuvor geschrieben und aufbewahrt hatte; und irgendwann erinnerte ich mich daran und sagte: Das ist es, was ich genau brauche! Das war der Übergang zum „freien Teil“, der sich dann mit der erneuten Belichtung des A-Teils verbindet. Das ist mir einfach so eingefallen, wie aus dem Nichts. Aber das ganze Stück im Allgemeinen, glaube ich, habe ich in ein paar Tagen geschrieben. Danach habe ich es überarbeitet, aber der Song ist einfach so entstanden, von Anfang bis Ende, einfach so. Jetzt sehe ich, dass es reine Nostalgie war, die sich so präsentierte, als würde sie die Noten empfangen. Es klingt ziemlich prätentiös, aber so war es. Das erinnert mich an etwas, das Julio Cortázar 1977 in einem Interview mit Joaquín Soler Serrano für das spanische Fernsehen (TVE) erwähnte. Er sagte, dass die Erzählungen zu ihm kamen, dass die Geschichten in gewisser Weise schon geschrieben waren und seine Aufgabe nur darin bestand, ihnen einen „Rahmen“ zu geben. In meinem Fall, selbst wenn ich sicherlich nicht so viele Ressourcen wie Cortázar habe … Ich weiß nicht, wie schwer es für ihn war, aber ich habe das Gefühl, dass er, sobald er den Kern einer Erzählung getroffen hatte, eine unendliche Anzahl von Ressourcen hatte, um sie zu gestalten.
Sicherlich hatte er in seiner Reifezeit die Mittel, um die Geschichten zu gestalten, aber vielleicht nicht zu Beginn seiner Karriere
Ja, natürlich. Wenn mir eines klar ist, wenn ich Schriftstellern wie Cortázar, anderen Musiker:innen oder anderen Künstler:innen zuhöre, wenn es um das Schaffen geht, dann ist es, dass der Akt der Gestaltung eines Werkes letztlich mit viel Frustration und Arbeit einhergeht. Aber, um die Gedanken, von denen ich sprach, zu Ende zu bringen: All das kam heraus, und ich nehme an, dass es einen Hauch von verschiedener Musik gibt, die ich hörte, verschiedene Aspekte der Musik, die ich hörte, von dieser Playlist, von diesen Untersuchungen. Aber es gibt auch Stücke, die es nicht auf die Playlist geschafft haben und die mich möglicherweise irgendwann einmal bewegt haben oder mir interessant erschienen. Es gibt etwas, das ich doch immer mache: Wenn ich so etwas höre, setze ich mich ans Klavier und finde heraus, was da los ist. Vielleicht schreibe ich es nicht einmal auf, oder ich mache mir nicht viele Gedanken über den analytischen Teil, aber das reicht mir schon. An manchen Stellen reicht es aus, herauszufinden, welche Ressourcen verwendet werden, was vor sich geht. Das wird dann irgendwo in meinem internen Speicher abgelegt.
Wandern ist offensichtlich ein sehr präsentes Thema in deinem Leben. Charnia ist mit den wöchentlichen Fahrten von Valencia nach Barcelona entstanden, was mit deinem Ausbildungsweg zusammenfällt. Du hast doch auch Berlin erwähnt, wo diese Reise weiterging, und jetzt lebst du in Leipzig. Neben der Kluft zwischen der Szene in Spanien und dem musikalischen Leben in Leipzig gibt es auch den unaufhaltsamen Lauf der Zeit, das Reifwerden. Als du nach Leipzig kamst, brachtest du in deinem Koffer deine musikalische Ausbildung, eine Menge Erfahrungen und eine riesige Playlist mit, und nun bist du in einer neuen Stadt mit all dem Gepäck. Wie war die Landung hier? Hast du dich gefragt: Was macht man damit? Was hat dich als erstes inspiriert?
Dazwischen habe ich mit meiner Frau kurz in Portugal und etwas länger in England gelebt. In England sind musikalisch ziemlich wichtige Dinge passiert, zumindest auf persönlicher Ebene – nicht so sehr in Bezug auf Erfolg oder so etwas. Aber auf persönlicher Ebene ist etwas Interessantes passiert, und zwar habe ich, als ich in Bristol lebte, angefangen, mit Jan, einem kolumbianischen Musiker zu spielen, der seine eigenen Songs und eine Band namens Mutant-Toughts hatte. Er schrieb Musik, die einen starken Einfluss von Gruppen wie Radiohead und Komponenten mit Synthesizern hatte. Dazu gab es auch viel Rock aus Lateinamerika… Manchmal sagte er zu mir, ob ich einen X-Song gehört habe. Nun, er wurde von einem Song der Band Soda Stereo inspiriert [Lacht]. Mit den Synthesizern wurde der Song in etwas völlig anderes verwandelt. Mit ihm und Joshua, dem britischen Bassisten in der Band, haben wir all diese Songs, die er mit Synthesizern komponierte, übertragen… Jan hat auch gesungen und die Synthesizer gespielt. Dann hatten wir einen E-Bass, mit Pedalen und so weiter und mein Schlagzeug. Wir haben die Songs in ein eher akustisches Format umgewandelt. Das war das erste Mal, dass ich in einer Band spielte, die zu keinem bestimmten Musikgenre passte. Denn bisher hatte ich in Spanien beispielsweise Jazz und Metal gespielt… also Genres, die sehr etabliert sind und von denen man einen ganz bestimmtes Sound erwartet, in jeder Hinsicht. Es gibt immer sehr klare Einschränkungen oder Richtlinien, was man tun muss, damit es zu dem Genre passt. In dieser Gruppe hingegen gab es keine. Natürlich gab es Einflüsse von Bands, aber es gab keine Vorschriften. Ich hatte ein großartiges Gefühl dabei, diese elektronischen Trommeln in akustische Trommeln zu verwandeln. Ich hatte die Freiheit zu tun, was ich wollte – natürlich mit dem Konsens von Jan und Joshua. Ich begann darüber nachzudenken, warum dieses Gefühl so gut war, und mir wurde klar, dass es genau das war: den Druck loszuwerden, einen bestimmten Stil spielen zu müssen und so oder so zu klingen. Wenn man Jazz spielt und beispielsweise Beepop und Hardbop macht, muss man einen Sound wie Tony Williams, Elvin Jones, Philly Joe Jones oder wer auch immer haben. In dieser Band durfte man das spielen, worauf man Lust hatte, denn das war eine Musik, die es vorher noch nicht gegeben hatte. Ich wusste, dass ich diese Freiheit irgendwie retten und einen Weg finden musste, diese Freiheit zu bewahren, wenn ich meine eigene Musik schrieb. Ich erkannte, dass es nämlich diese Freiheit war, die es mir ermöglichen würde, ehrlich zu mir selbst zu sein, wenn ich etwas schreibe. Ich bin froh, dass du mir diese Frage gestellt hast, denn ich konnte mich nicht mehr an den Ausgangspunkt dieser Gedanken erinnern. Dies war jedenfalls ein sehr wichtiger Punkt für die Entstehung von Charnia. Ich denke, dass ich ohne diesen Schritt nicht weiß, ob ich das Projekt auf dieselbe Weise angegangen wäre. Kurz gesagt: In Bristol durfte ich etwas erleben, das mir die benötigte Freiheit gab, um anschließend etwas Ehrliches machen zu können. Als ich bei der Mutant-Toughts spielte, fand ich all diese Freiheit, und gleichzeitig – und das ist das Kuriose – Jan und Joshua waren Musiker, die über keine tiefen theoretischen Kenntnisse verfügten. Doch das spielte keine Rolle, denn es kam alles auf natürliche Weise heraus. Jan beispielsweise hat die Tugend, seinem Instinkt zu folgen, wenn es darum geht, Songs zu schreiben. Vielleicht hat er seine Einflüsse auf eine sehr intuitive Art und Weise vermischt und umgesetzt, und als Ergebnis schafft er etwas, dass sehr originell und eigen ist. Dann formte er die Skizzen mit anderen Musikern, aber das Rohmaterial für das, was er tat, war zweifelsohne er selbst: Die Art, wie er sang und die Songs aufbaute, alles war sehr von ihm geprägt. Das hat mich einerseits sehr fasziniert, andererseits aber auch ziemlich verblüfft. Denn ich fragte mich, wie er solche Ergebnisse erzielen konnte, wenn er nicht über so viele theoretische Ressourcen verfügte. Im Gespräch mit ihm wurde mir klar, dass er sehr intuitiv ist und vor allem eine sehr starke und einzigartige Persönlichkeit hat. Er ist ein Typ, der in der Lage ist, seinen Intuitionen zu folgen, und ich glaube, dass er sich sehr wenig darum schert, wie die Leute das beurteilen, was er tut. Das ist super wichtig, um ehrliche Musik zu machen.
Um auf den zweiten Teil der Frage zurückzukommen: Du sagtest, du wolltest nach Barcelona, um sich u.a. die Jazztechnik anzueignen, aber der Jazz stellte für dich paradoxerweise nicht die Eroberung der Freiheit dar, wie man vermuten würde, sondern du musstest andere Musik spielen, um den Jazz irgendwie wiederzuentdecken. Warum bist du zum Jazz zurückgekehrt?
Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich versucht, das zu tun. Ich habe ein Nebenprojekt gestartet, das noch nicht erschienen ist, bei dem ich mit virtuellen Instrumenten komponiere – Synthesizer und so weiter. Irgendwann entschloss ich mich, das Vorhaben auf Eis zu legen, um Charnia zum Leben erwecken zu können. Als meine Frau und ich Bristol verließen, fühlte ich mich einsam, und ich hatte das übliche Gefühl, wenn man einen Ort verlässt, an dem man ein Projekt hat, das von anderen Musikern abhängt. Was in solchen Fällen passiert, ist, dass man in dem Moment, in dem man geht, mit nichts dasteht – man muss von vorne anfangen. Das gefiel mir überhaupt nicht und ich sagte mir, dass ich das nicht mehr wollte. Ich wollte doch mein eigenes Projekt haben und meine eigene Musik komponieren. In erster Linie für mich selbst und um zu wissen, wer ich bin; und auch, weil ich meine eigene Musik haben und mitnehmen will, wohin ich gehe. Ich wollte die Möglichkeit haben, meine Musik mitzubringen und die passenden Musiker:innen dazu zu suchen, meine Stücke zu spielen. So ist dieses Bedürfnis entstanden. Ich habe versucht, etwas in der Art von Jan zu machen, aber auf meine eigene Art und Weise, d. h. mit meinen eigenen Einflüssen. Es gibt eine ganze Menge von Songs, die ich abgelegt habe. Damals habe ich viele Dinge gleichzeitig komponiert und dann haben meine Frau und Ich entschlossen, nach Berlin zu ziehen. Zuerst fiel mir sehr schwer, dort meinen Platz zu finden. Bei den Gelegenheiten, bei denen ich Jazz gespielt habe, handelte es sich um etwas sehr konventionelles – was nicht gerade ein Umfeld ist, in dem ich mich gerne aufhalte. Das liegt vor allem daran, dass ich diese Art der ständigen Beurteilung nicht mag – die so genannte „Jazz-Polizei“. Ich war nicht sehr daran interessiert, mich in diesem Umfeld zu bewegen, und ich gehöre nicht zu den Musiker:innen, die sich nur in ein bestimmtes Gebiet vertiefen würden. Ich habe zwar ziemlich viel Jazz gelernt, aber ich mag auch andere Genres. Ich wusste, dass das nicht mein Ding ist. Schließlich fand ich eine Band namens Kelele, die ihre eigenen Songs machte. Damals hatte sie bereits zwei Alben mit Einflüssen aus Afrobeat, Funk, Reggae und vielen anderen Dingen veröffentlicht. Ich betrat also ein Spektrum, in dem die Fusion ziemlich groß war, und obwohl ich einige Parameter zu befolgen hatte, gab es keine Verpflichtung gegenüber einem bestimmten Genre. Das bot mir eine hervorragende Atmosphäre auf persönlicher Ebene: Es waren Musiker aus vielen Orten da, viele Deutsche, aber mit afrikanischem Migrationshintergrund – der Sänger mit Wurzeln in Senegal, andere in Togo. Der kulturelle Aspekt und die musikalischen Wurzeln der Band waren also sehr reichhaltig. Die Band hatte sehr gut zusammengestellte Songs und es hat viel Spaß gemacht und Freude bereitet mitzuspielen. Das gab mir die Gelegenheit zu denken: Wie wäre es, wenn ich ein paar Songs für Kelele mache? Ich begann also zu recherchieren und schrieb ein paar Stücke für die Band. Doch meine Zeit mit Kelele war relativ kurz, über ein Jahr, weil die Pandemie kam… Hier erreichen wir einen wichtigen Zeitpunkt. Während der Zeit mit Kelele schrieb ich zwei Songs für ein neues Album der Band, das aber letztendlich leider nicht zustande kam. Die Band gab mir die Möglichkeit, eigene Kompositionen zu schreiben, und zeigte mir auch, wie gut es ist, Songs zu machen, sie zu anderen Musikern zu bringen, sie spielen zu lassen und wie es sich anfühlt, wenn die Stücke zum Leben erwachen. Dann kam die Pandemie. Auf der einen Seite war es natürlich eine sehr harte Zeit für alle, aber auf der anderen Seite war es toll, dass ich plötzlich nicht arbeiten musste… Ich musste nicht mehr unterrichten. Dank der Privilegien des deutschen Staates waren wir Künstler:innen, abgesichert, so dass wir überleben konnten. Dadurch hatte ich eine Menge Zeit zur Verfügung. Selbst wenn ich familiäre Verpflichtungen hatte, meine Tochter war noch sehr klein, sie war zweieinhalb Jahre alt, und es gab zu Hause eine Menge zu tun, wechselte ich mich mit meiner Frau ab. So hatte ich Zeit, mein Instrument ausgiebig zu studieren und mich der Komposition zu widmen. Schon vor der Pandemie hatte ich Harmonie studiert und die kleinen zeitlichen Lücken genutzt. Zum Beispiel, während ich meine Tochter fütterte. Damals habe ich mich voll und ganz auf das Studium konzentriert. Als die Pandemie ausbrach, nahm ich all das mit und fing an, mehr Stücke zu schreiben. Jeden Tag habe ich eine Menge gemacht. 90 % der Skizzen landeten im Papierkorb oder blieben in Ordnern, aber ich habe jedenfalls eine Menge Ideen aufgeschrieben. Als ich anfing, all das zu tun, ging es mir mehr darum, nicht in einem bestimmten Stil zu komponieren. Im Gegenteil, ich wollte feststellen, inwieweit das, was ich schreibe, meine persönliche Prägung hat. Da das Projekt konkretisiert werden musste, habe ich mir selber eine Frist gesetzt. Das war sehr schwierig, weil wir damals in Brandenburg lebten, wir befanden uns mitten in der Pandemie und man wusste nicht, wann sie zu Ende sein würde. Die Pandemie begann Anfang 2020 und dann dachte ich, dass ich bis zum Ende des Jahres eine X-Anzahl von Stücken geschrieben haben muss.
Bildquellen: [1] Quetzal-Redaktion; [2] Pablo Tarantino