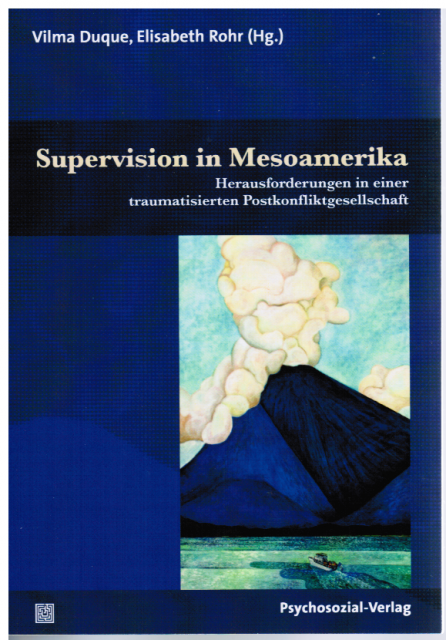Die Herausgeberinnen
Die Herausgeberinnen
Im vorliegenden Sammelband werden die Ergebnisse mehrerer Supervisionsausbildungen in gewaltgeprägten und „traumatisierten“ Gesellschaften reflektiert. Dabei geht es um Guatemala, Mexiko und El Salvador, ein wenig auch um Palästina und Südafrika. Die beiden zuletzt genannten Länder finden sich – vergleichend – in nur einem der insgesamt 14 Beiträge (+ Einleitung). Zu El Salvador gibt es nur einen Beitrag. Herausgeberinnen und zugleich Autorinnen der meisten Aufsätze sind mit Elisabeth Rohr eine Professorin emerita für Interkulturelle Erziehung am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Philipps-Universität Marburg und die promovierte Psychologin der FU Berlin Vilma Duque Arellanos. Zu den weiteren Autor:innen zählen guatemaltekische und mexikanische Psycholog:innen sowie die deutsche Theologin Silvia Kapteina, die das Buch auch kongenial übersetzt hat. Die Rezensentin hingegen, das sei vorab eingeräumt, kennt zwar die im Buch thematisierte Weltregion aus eigener Erfahrung, ja eigener (sozialwissenschaftlicher) Gewaltforschung, ist aber weder Psychologin noch Pädagogin.
Das Projekt vor Ort
Zusammengefasst: Der Band ist hochinteressant und eminent nützlich. Nützlich war gewiss zunächst die praktische Supervision vor Ort, vorgenommen durch die Herausgeberinnen. Schon sie war eine Pionierleistung. So etwas kannte man bis dahin in der genannten Region nur aus dem klinisch-psychotherapeutischen Kontext, aber nicht als psychosozialen Staff Care und Teil von Personalentwicklung (diese Begrifflichkeiten kommen in der Publikation indes nicht vor). Insbesondere die GIZ, aber auch Brot für die Welt, die EKD und die Deutsche Gesellschaft für Supervision unterstützten das Projekt. Durchgeführt wurde es zwischen 2005 und 2020 als Gruppenanalysen, darunter sogenannte „Balint-Gruppen“. Drei „Generationen“ (63 an der Zahl) psychosozial qualifizierter Supervisor:innen hat es hervorgebracht. Zuvor bereits als Supervisor:innen tätig, wurden die Projekt-Teilnehmer:innen wieder zu Supervisand:innen, um schließlich als höher qualifizierte Supervisor:innen wieder hinauszugehen: Nun sollten sie nicht nur zu Self Care und Selbstfürsorge fähig sein, sondern auch, den in ihren Institutionen nötigen Staff Care zu befördern. Eine solche „zweigliedrige“ Fürsorge von Self und Staff Care ist zwar für Institutionen generell angesagt, erhält aber im Kontext von durch Gewalt „traumatisierten“ Gesellschaften eine besondere Bedeutung. Die Rezensentin, einst in demselben Gewaltkontext unterwegs, gibt zu, dass sie auch selbst gern eine solche psychosoziale Begleitung erfahren hätte. Für Gewaltforscher:innen ist das aber leider noch nicht üblich.
Psychosoziale Supervision mit unterschiedlicher Konnotation
Während in westlich-demokratischen Gesellschaften psychotherapeutische und -soziale Supervision längst positiv-hilfreich konnotiert ist, hatten die Supervisorinnen im Projekt negative Vorannahmen zu überwinden: Ihr Ursprung findet sich in den Legaten autoritär regierter Staaten, wie es Guatemala und El Salvador, aber auch Mexiko (letzteres als Autoritarismus sui generis) über Jahrzehnte waren: Supervision wird dort jedoch noch immer vornehmlich als „Kontrolle“ verstanden und macht vor allem Angst. Im Projekt indes wurde sie als Beratungsverfahren angeboten, das die Brücke zwischen 1) psycho-therapeutischer bzw. -analysierender Praxis (dem äußeren Eindruck nach eine Kombination von Tiefen- und Verhaltenstherapie), 2) Psycho-Hygiene und 3) Sozialarbeit schlägt. Selbst keine Therapie, ist sie „Schutzraum“ und ermöglicht „sekundäre therapeutische Effekte“, die vor allem burn-out-Syndrome verhindern können. Es geht ihr darum, jenen zu helfen, die selbst helfen.
Die Beiträge
Die Beiträge des Sammelbandes verfolgen verschiedene Anliegen: Einige der Aufsätze (insbesondere die von Elisabeth Rohr, Vilma Duque und Gerardo Espinoza Santos) verstehen sich als theoriegeleitet und nutzen Fallbeispiele als Empirie, andere (die von Silke Kapteina, Yolanda Mariayín Quevedo Castillo, Mónica Esmeralda Pinzón González, Perla Guerra Ramos und Ana Elena Barrios mit Liliana Souza sowie Patricia Zamudio) sind eher beschreibende Erfahrungsberichte. Den Schluss bildet ein Evaluationsbericht (von José Herbert Bolan͂os Valenzuela). Faktologisch besonders spannend sind die Überlegungen zur interkulturellen Supervision bei verschiedenen Maya-Ethnien von Pinzón González, zur Situation in den Schulen in der Mara-geprägten Gesellschaft El Salvadors und der Beitrag von Perla Guerra Ramos zur Polizei in Mexiko. In allen Artikeln sind die empirischen Fälle essenziell, ob als Ausgangspunkt, Zentrum oder Leitfaden. Anders als in Geistes- und vielen Sozialwissenschaften ist das in psychotherapeutischen und -sozialen Supervisionen so üblich: Fälle zu beschreiben, daraus blinde Flecken herauszugreifen und auf das Unterbewusste hin zu analysieren.
Letztlich beschreiben alle Beiträge, verschieden nuanciert, dass und wie im konkreten Projekt Supervision zunächst skeptisch, ja als bedrohlich, angesehen wurde, um am Ende als (mehr oder weniger) hilfreich betrachtet zu werden. Das Anthropolog:innen, aber auch anderen Gewaltforscher:innen bekannte Problem, dass in gewalt- und autoritär-geprägten Kontexten Konflikte vorzugsweise verschwiegen werden und es, beispielsweise auch in Arbeitsbezügen, vermieden wird, sie auszutragen, wird nicht nur eindrucksvoll dokumentiert, sondern zum Schluss auch als durch die Supervision überwunden berichtet. Chapeau. Überhaupt ist das Buch faszinierend ehrlich und verschweigt auch gravierende Probleme nicht oder redet sie klein, bis zu dem Punkt, dass die Supervisorin Elisabeth Rohr ihre zeitweise „Ohnmacht“ beim „containing“ eingesteht.
Im Weiteren seien ein paar reflexive zustimmend-zuspitzende, danach aber auch geringfügige kritische Bemerkungen gestattet.
Zustimmende und weiterreichende Reflexionen
Für psychosoziale Begleitung wirft der Band das Problem auf, ob sich diese besser mit den Opfern identifizieren, ja mit ihnen solidarisch oder nicht doch lieber neutral sein sollte, um die Ressource „Distanz“ nutzen zu können (vgl. S. 66 f.). Sollte der Therapeut also lieber klassisch, wie es Freud vorgemacht hat, „kühl“ hinter dem Kopf des Patienten sitzen, nichts von sich preisgeben und bestenfalls Deutungen bzw. Interpretationsmöglichkeiten in den Raum stellen, oder ihm nicht, ähnlich einem Irvin Yalom, vielmehr von Angesicht zu Angesicht gegenübersitzen, eine empathische Beziehung aufbauen, ja eigene psychische Erfahrung in das Gespräch „hineingeben“? Das Buch folgt letzterem Ansatz.
Die Autor:innen sind so mutig, darauf hinzuweisen, dass Opfer physischer Gewalt oft auch Täter sind oder später werden, was ja die Theorie der Übertragung von selbst erfahrener Aggressivität schon lange nahelegt. Mutig ist das Buch dennoch, weil bei Wahrheitskommissionen und Transitional-Justice-Ansätzen das Selbstverständliche häufig unter den Tisch fällt: Kommissionen wie Ansätze kranken in der Regel daran, dass sie Täter und Opfer – zu – klar voneinander trennen, die Realität aber, gerade in Lateinamerika, sehr oft nicht so war und ist. Dankenswerter Weise nennt das von Rohr und Duque herausgegebene Buch Beispiele für die „Vermischung“ von Opfer- und von Täter-Persönlichkeiten – zu „Opfer-Tätern“. Auch Gewalt-Opfer-Täter, ja Täter benötigen psychosoziale Behandlung. (Dann würde es mit der Empathie natürlich schwierig.) Doch anders als psychatrische Behandlungen von Täter-Psychosen sind psychosoziale Therapien von Tätern bzw. Opfer-Tätern in Lateinamerika immer noch eher selten (in westlichen Ländern hingegen üblich). Das Problem angedeutet zu haben, ist Verdienst des Bandes.
Während Sozialwissenschaften, wenn auch nicht immer, die Psyche ignorieren, erkennt die Psychotherapie, zumindest wenn sie kontextualisiert, an, dass psychische Probleme gesellschaftliche Ursachen haben können (vgl. S. 166 ff., dort insbesondere der Verweis auf den Trauma-Forscher Volkan und dann Figley). Gleichfalls erkennt sie an, dass es „sekundäre Traumatisierung“ durch gesellschaftliche Verhältnisse geben kann. Doch bei ihren Handlungsempfehlungen erkennt man immer, dass sie diesen von ihr selbst postulierten Zusammenhang ignorieren, beispielsweise wenn sie fordert: „Grenze dich ab!“ Allein, zum großen Teil handelte es sich bei den Supervisand:innen im Projekt um Aktivist:innen, die gegen Diktatur und Autoritarismus kämpften, noch immer politisch hochsensibel und aktiv gegenüber Ungerechtigkeit und Repression sind und alles tun, dagegen anzugehen. Doch die gängige psychotherapeutische Linie würde auch für sie lauten: „Du musst an dich denken, damit du mit den Strukturen zurechtkommst“, was letztlich nichts anderes heißt: „Du musst dich anpassen!“ Etwas vorsichtiger formuliert: „Gesellschaftliche Strukturen sind nicht oder nur sehr schwer zu ändern und da (bzw. solange) du das nicht kannst, musst Du an dich selbst denken und dafür sorgen, dass du mit ihnen zurechtkommst!“ Der/die Betroffene, gerade in Lateinamerika, kann das aber als Dilemma sehen. Zumindest mag er/sie sich fragen, wie er/sie das denn im täglichen Leben praktisch handhaben soll: Eine Zeit lang mit gesellschaftlicher Aktivität aufhören, bis er/sie psychisch wieder resilient ist? Oder gar ganz damit aufhören, weil man Strukturen ohnehin nicht ändern könne bzw. immer nur ein bisschen, aber nie so, dass die Gefahr „sekundärer Traumatisierung“ ausbleibt? Für die Supervisand:innen von Rohr und Duque hätte Selbstfürsorge anstelle von Mitwirkung an gesellschaftlicher Transformation bedeutet, ihrem ursprünglichen Lebensentwurf untreu zu werden.
Elisabeth Rohr löst das Dilemma nicht auf, führt aber ein Beispiel an (S. 105 ff.), wie es gehen könnte. Sie beschreibt, wie Supervisand:innen, gestärkt durch die Supervision, in einer Konfliktsituation einen Brief an den Vorgesetzten schreiben und also ihr Schicksal am Arbeitsplatz selbst in die Hand nehmen, sich folglich nicht anpassen! Allerdings beschränkt sich Rohr hier auf den Arbeitsplatz und erweitert das nicht auf gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Gleichwohl, dass sie das Problem, überdies für einen lebensbedrohlichen Kontext wie Guatemala, aufwirft, ist bemerkenswert. In unserer Gesellschaft wäre das ja noch um ein Vielfaches einfacher. Aber selbst hier, bei uns, neigen Psychotherapeuten dazu, ihren Patienten zu raten: „Denken Sie an sich. Die Strukturen können Sie sowieso nicht ändern!“
Auch an anderer Stelle ist Elisabeth Rohrs „Mut zur Unverkrampftheit“ hervorzuheben: In einem ihrer Beiträge erzählt sie von einer weißen südafrikanischen Sozialarbeiterin, die als Supervisorin in einem schwarzen township tätig ist. Als Supervisandin in Rohrs Gruppe bricht sie in Tränen aus und berichtet, dass sie in den Sitzungen, die sie selbst als Supervisorin leitet, stets von einem dunkelhäutigen Mann angestarrt wird. Das irritiert sie zutiefst. Rohr erkennt, das könnte daran liegen, dass es diesem Mann nach dem Ende der Apartheid erstmals möglich ist, einer Weißen längere Zeit ins Gesicht zu schauen. Keine Frage, dass dies die Nachwehen früherer Apartheid sind. Das Problem aber war nun, dass man in Südafrika heute (und, so meint die Rezensentin, nicht nur dort!) dazu erzogen wird, Rassentrennung oberflächlich dadurch zu überwinden, dass man sie einfach verschweigt: Man kann oder will sie nicht beim Namen nennen, weil man nicht weiß, ob und wie man korrekterweise darüber reden „darf“, das heißt was im politisch-korrekten Diskurs überhaupt „sagbar“ ist. Das jedoch führt zu Verdrängung. Natürlich sind Rassen nur Konstruktionen, aber als solche sind sie eben „da“. Sie zu verschweigen, ist kontraproduktiv, ja gefährlich. Das ist ein wichtiger Fingerzeig von Elisabeth Rohr. Eine heutzutage wieder populäre Variante des postkolonialistischen Diskurses, über Schwarze und deren Probleme dürften Weiße nicht reden, weil sie ja davon nicht betroffen seien, stellt Rohr damit überzeugend infrage.
Das Problem: Kultur zwischen Essenzialismus und Hermeneutik – Für und Wider die Fremdheit
Interessant, aber zum Teil auch widersprüchlich, ist, wie die Autor:innen des Bandes mit „Kultur“ umgehen. Hier wird zwischen essenzialistischen und (tiefen)hermeneutischen Kulturzuschreibungen changiert. Einerseits, so etwa Vilma Duque, ist ihnen die Gefahr von Essenzialismus bewusst, und der (nicht ganz so überzeugende) Ausweg wird in der Bezeichnung „Tendenz“ (S. 53) gesucht. Andererseits werden aber essenzialistische Kriterien aufgenommen, ja konkret auf die Bewohner eines Landes, hier auf Guatemala, bezogen. Damit wird dem von Supervisand:innen vorgetragenen Argument „so sind wir“ oder „so ist unsere Kultur“ (S. 56) aber nicht effektiv begegnet. Ob kulturelle Spezifik als grundsätzliche nationale Kultur oder als von den Spaniern importiert oder als durch autoritäre oder bürgerkriegsähnliche Legate erworben aufgefasst wird, wird im Buch zudem nicht ganz klar. Einerseits wird in den Aufsätzen, etwa von Rohr, betont, dass man als westlich sozialisierte Supervisorin die „andere“ Kultur respektieren muss. Andererseits, so bei fehlender Pünktlichkeit, stört sie aber ungemein, und die Betreffenden werden nun von der Supervisorin aufgefordert, ihre „Kultur“ zu unterlassen. Denn, wenn viele Supervisand:innen in vielen Sitzungen gleichzeitig extrem unpünktlich sind oder unentschuldigt fehlen, scheitern sie. Damit hätte auch das – in Deutschland durch Steuergelder finanzierte – Projekt scheitern können. Aber was ist die Message? Die andere Kultur respektieren oder lieber doch nicht? Hier ja, da nicht?
Dies nun führt zu der alten, aber immer wieder neuen Frage, ob westliche Intervention in der „anderen“, hier „südlichen“, Gesellschaft überhaupt willkommen und hilfreich ist oder, im Gegenteil, als Bevormundung aufgefasst wird. Die Rezensentin hat es in ihrer Gewaltforschung immer einmal wieder gehört: „Was hast denn du als Fremde, die du diese Gewalt selbst nie erlebt hast, überhaupt dazu zu sagen?“ Der Verweis darauf, dass Fremde besonders viel bzw. besonders scharf sehen (S. 279 ff.) bzw. dass es sogar „der Fremdheit bedarf, um Fremdes zu erkennen und zu erforschen“ (S. 281) „rettet“ nun die/den Fremde(n) womöglich vor Gewissensbissen. Völlig zu Recht formuliert Elisabeth Rohr aber auch das contra: „Wenn man fremd ist, kann der Andere auch ungestraft Märchen erzählen“. Die Vermittlung zwischen beidem sucht sie in der Unterscheidung zwischen „Übertragung“ und „Gegenübertragung“. In ihrem Projekt, so der Eindruck, war die Supervisorin aus Deutschland weder Freundin noch fremd, auch nicht ein(e) „fremde(r) Freund:in“, sondern eher eine „freundschaftlich gesinnte Fremde“.
Ausgesprochen dankbar für all diese Denkanstöße, hat die Rezensentin aber auch kleinere Kritiken:
Kleinere Kritiken aus sozialwissenschaftlicher Sicht
Der Titel des Bandes irritiert zweifach:
Erstens: Der Terminus „Mesoamerika“ wird allgemeinhin für indigene Kultur-Areale als Synonym für Altmexiko verwandt. Darum geht es im Buch aber nicht, sondern um moderne Gesellschaften, die historisch wie aktuell immenser physischer Gewalt ausgesetzt waren und sind. Aber da in der Publikation neben zwei zentralamerikanischen Staaten gerade Mexiko eine prominente Rolle spielt, das Zentralamerika einst nur zu einem kleinen Teil und heute nicht mehr zugeordnet werden kann, musste wohl auch dieses im Buchtitel „untergebracht“ werden, wozu der Begriff „Mesoamerika“ wohl geeignet schien. Besser wäre vielleicht gewesen: „… in Zentralamerika und Mexiko“.
Zweitens: „Postkonfliktgesellschaft“ im Titel passt logisch nicht zum Inhalt des Buches. Denn dieses thematisiert ja psychosoziale Probleme, darunter Traumata, die aus Gewalt resultieren. Gewalt aber ist eine Form von Konfliktaustrag. Dann jedoch kann es sich nicht um „Postkonfliktgesellschaften“ handeln.
Mehrere Aufsätze gründen auf Begriff und Konzept der „strukturellen Gewalt“. Dieser in den 1970er Jahren durch Galtung eingeführte und durch Senghaas in Deutschland etablierte Terminus meint Not jeder Art, ob Hunger, Armut, Repression oder Unterdrückung. Diese rufen aber nicht notwendig physische Gewalt hervor. Sie können es, müssen es aber nicht. Wenn allerdings „alles“ strukturell Problematische bereits Gewalt ist, wird die konkrete physische Gewalt verdeckt. Im Buch und Supervision geht es aber um physische Gewalt. Insofern ist die Kategorie „strukturelle Gewalt“ für sein Anliegen nicht zielführend.
Die „Schüler:innen“ der von Rohr und Duque angebotenen Supervision waren in erster Linie Menschenrechtsaktivisten (vgl. Selbsteinschätzung auf S. 66) und Vertreter von NGOs, in zweiter Linie Vertreter:innen von staatlichen Institutionen wie beispielsweise Polizei oder Schulen. Es ist zu spüren, dass die beiden Supervisorinnen und Herausgeberinnen politisch eine eher „linke“ Position vertreten. Die Zeitschrift „Quetzal“ ist nun die letzte, die gerade das kritisieren würde, wohl aber, dass die im Buch genutzten Quellen zu den politischen Situationen in den Ländern nicht einschlägig sind, weil sie fast ausschließlich auf NGOs zurückgehen. Damit wird, nur in dieser Frage, Einiges an Wissenschaftlichkeit verschenkt, weil vereinfacht.
Zwei Beispiele:
-
Anders als im Buch beklagt, ist die in der wissenschaftlichen Literatur einschlägige Bezeichnung der in Guatemala bis zum Friedensabkommen 1996 reichenden militärischen politischen Auseinandersetzung als „Konflikt“ in keiner Weise „beschönigend“. Im Unterschied zum klassischen Bürgerkrieg in El Salvador war sie eben kein – definitorisch immer bipolarer – Bürgerkrieg, weil vielpolig.
-
Befremdlich ist die Charakterisierung des Friedensabkommens in Guatemala als bloße „Absichtserklärung“: Zu ignorieren, dass die Absicht auch in vielerlei Hinsicht umgesetzt wurde, da politische (nicht die kriminellen) Gewalt-Konflikte im Wesentlichen beendet, autoritäre Regime weitgehend abgelöst, die Armee als Prärogative abgeschafft, einige demokratische Fortschritte (darunter Neukonstituierung der Polizei) erreicht und (in Guatemala) das Genozid an den indígenas beendet worden sind, mutet unlauter an. Dass es in Guatemala „auch nach dem Krieg weder zu einem gesellschaftlichen, geschweige denn politischen Wandel“ (S. 170) gekommen sei, ist folglich selbst bei erwünscht kritischer Sicht auf die Dinge überzogen. Doch wenn man überzieht, verdeckt man die tatsächlich vorhandenen Probleme: wie z.B. kriminelle Gewalt von und in Maras, in Frauenmorden und Lynchjustiz. Sie werden so in ihrer Bedeutung (wenn auch nicht willentlich) geringgeschätzt. Wenn aber schon Verändertes nicht registriert wird, dann kann es auch nicht von noch zu Veränderndem abgegrenzt werden. Das ist auch und gerade psychosozial relevant.
Editorisches
Zum Schluss seien noch kleinere editorische Probleme erwähnt:
-
Wenn von vierzehn Beiträgen fünf, wiewohl die besten, von einer einzigen Autorin (Elisabeth Rohr) stammen, ist das für das Anliegen eines Sammelbandes, der ja immer die Breite verschiedener Positionen zeigen soll, problematisch. Und dass die Artikel zum Teil schon zuvor in einschlägigen Journals erschienen waren, findet die Rezensentin unüblich.
-
Als besonders störend stellt sich heraus, dass sich (fast) jeder Artikel gebetsmühlenartig wiederholend zu den Parametern der Supervision (Leitung, Teilnehmer, Ort, Dauer, Sponsor) äußert. So hat entsteht der Eindruck, dass die Herausgeber:innen gar nicht damit rechneten, dass ihre Leser:innen tatsächlich alle Aufsätze lesen. Hier hätte gekürzt werden müssen.
-
Dass bei allen Quellenangaben auf Seitenzahlen verzichtet wird, entspricht nicht den wissenschaftlichen Standards.
Wärmste Empfehlung
Diese lediglich kleineren Kritiken sollen keinesfalls den überaus großen Wert des Buches schmälern. Es ist eine wichtige Lektüre nicht nur für psychosoziale Supervisor:innen, sondern auch für Vertreter:innen von Organisationssoziologie, Psychotherapie, Anthropologie, Erziehungswissenschaft und Gewaltforschung (jeglicher fachlicher Provenienz). Der Sammelband eröffnet Einsichten, die anderswo so nicht zu finden sind, besticht durch Ehrlichkeit, Mut, Offenheit für ungelöste Probleme und (im eigenen Metier) fachliche Fundiertheit. Er sei hier auch über die genanntem Spezialist:innen hinaus wärmstens all denen empfohlen, die sich für Lateinamerika und/oder Gewalt sowie die Wege interessieren, sie zu überwinden.
Vilma Duque/Elisabeth Rohr (eds.)
Supervision in Mesoamerika. Herausforderungen in einer traumatisierten Postkonfliktgesellschaft
Psychosozial-Verlag: 2020
343 Seiten
(Übersetzung der spanischsprachigen in Guatemala 2018 erschienen Originalausgabe
„Cómo montar un caballo muerto. Retos de la Supervisión en Mesoamérica“)