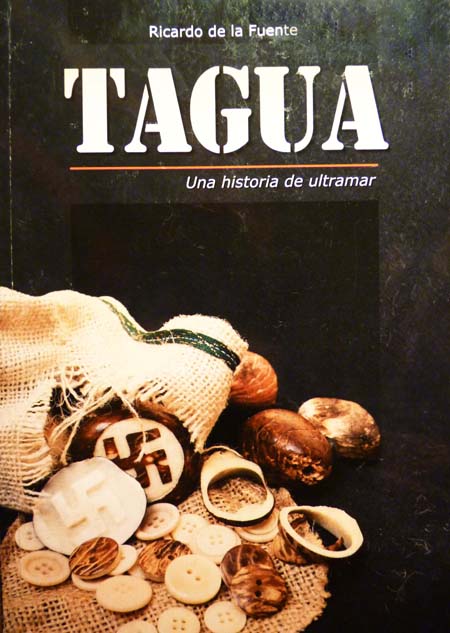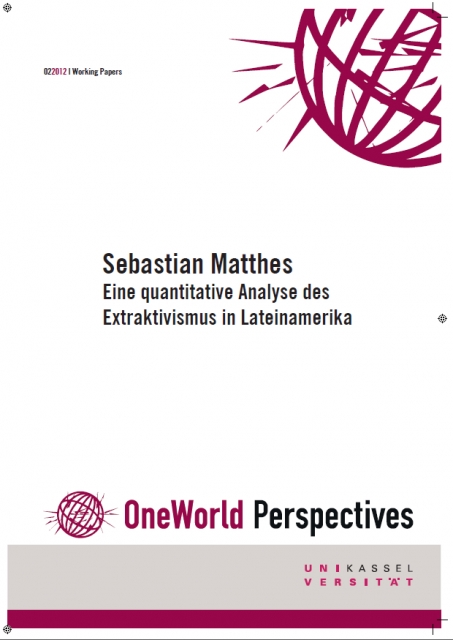Die Geschichte der Linken in Lateinamerika als Geschichte des Scheiterns
Keynesianismus verzweifelt gesucht
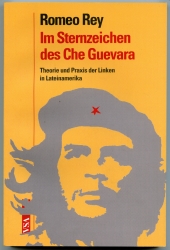 Lateinamerika ist immer schon eine der wichtigsten Projektionsflächen der europäischen Linken gewesen. Hier ging, was in Europa scheiterte. Hier siegte die Revolution in Kuba, entfacht von einer kleinen radikalen Minderheit. Hier ergriffen die Sandinisten durch geschickte Basisarbeit flankiert von einer Guerilla-Armee die Macht in Nicaragua. Hier versuchte Salvador Allende gestützt auf eine Volksfront-Regierung drei Jahre lang, die Gesellschaft solidarisch-sozialistisch umzugestalten. Und hier versuchen seit einigen Jahren die Regierungen von Venezuela, Bolivien und Ecuador auf jeweils spezifische Art und Weise einen „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ aufzubauen.
Lateinamerika ist immer schon eine der wichtigsten Projektionsflächen der europäischen Linken gewesen. Hier ging, was in Europa scheiterte. Hier siegte die Revolution in Kuba, entfacht von einer kleinen radikalen Minderheit. Hier ergriffen die Sandinisten durch geschickte Basisarbeit flankiert von einer Guerilla-Armee die Macht in Nicaragua. Hier versuchte Salvador Allende gestützt auf eine Volksfront-Regierung drei Jahre lang, die Gesellschaft solidarisch-sozialistisch umzugestalten. Und hier versuchen seit einigen Jahren die Regierungen von Venezuela, Bolivien und Ecuador auf jeweils spezifische Art und Weise einen „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ aufzubauen.
Auch heute ist Lateinamerika also wieder ein Kontinent der Hoffnung. So sieht es auch Romeo Rey. Das Buch des ehemaligen Lateinamerika-Korrespondenten der Frankfurter Rundschau und des Schweizer Tages-Anzeigers über die Geschichte der Linken in Lateinamerika widmet er „all denjenigen, welche die Hoffnung nicht verlieren“ und führt aus: „Lateinamerikas Linke verfügt über eine Vielfalt an eigenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Erfahrungen, über einen Schatz, der mittlerweile ein beträchtliches Volumen angenommen hat. Es ist an der Zeit, ihn auszuloten, alle Mängel, Fehler und Schwächen zu analysieren, Lehren daraus zu ziehen und diese Erkenntnisse in Prinzipien umzugießen, die den Kampf für eine freie, demokratische und solidarische Gesellschaft in diesem jungen Erdteil für eine klare Volksmehrheit einleuchtend und notwendig erscheinen lassen.“
Das wäre sicher ein gutes Programm für ein Buch über Lateinamerikas Linke gewesen. Allein, diese Worte beenden Reys Text. Er liefert vielmehr einen Überblick über die verschiedenen linken Strömungen, Parteien, Guerilleros und Regierungen ob in Kuba, Chile oder Nicaragua. Dabei beginnt Rey seine Darstellung bei der Mexikanischen Revolution unter Zapata zum Anfang des vorigen Jahrhunderts und verfolgt die verschiedenen bewaffneten und unbewaffneten Bewegungen und linken Regierungen bis heute. In dieser Zusammenschau liegt die Stärke des Buchs. Sie wird aber nur begrenzt wirksam. Das hat mehrere Gründe. Einer davon liegt in der Ignoranz gegenüber der Politik der Vereinigten Staaten. Deren ständiger Einfluss – und der ihrer Lakaien – auf die Bewegungen gehört zu den Konstanten der linken Geschichte des 20. Jahrhunderts zumindest für Lateinamerika. Rey arbeitet zwar die einzelnen Etappen der linken Geschichte des Kontinentes heraus, bei einer der wichtigsten Gemeinsamkeiten vieler hoffnungsvoller Aufbrüche, dem Scheitern durch Intervention der USA, bleibt er auf der phänomenologischen Ebene.
Sicher, die Supermacht kommt fast in jedem Kapitel vor, greift hier ein und zerstört dort die Politik der Revolutionäre. Ihr konterrevolutionäres Wesen fördert der Autor nicht zu Tage. Die Interventionen erscheinen so ohne Zusammenhang. Und so kommt Rey dazu, den USA gegenüber Kuba ein „kurzsichtiges, ausschließlich repressiv orientiertes Verhalten“ vorzuwerfen. Hat das denn keine Methode? Hat die gegen den Internationalismus gerichtete Politik der Vereinigten Staaten kein System? Natürlich hat sie eine solche. Es muss benannt werden. Dass Rey dies nicht tut, ist eines der Versäumnisse dieses Buches. Vermutlich ist das aber auch damit zu erklären, dass bei Rey die Bedeutung des Internationalismus fast gänzlich unter den Tisch fällt. Im Prinzip stellt er die revolutionären Entwicklungen in den einzelnen Ländern als singuläre Phänomene dar, ohne näheren Bezug zueinander. War das so, agierten die Revolutionäre wirklich für sich, wäre genau das aber ein Ansatzpunkt für Kritik und die Analyse des Scheiterns. So weit geht der Autor aber auch nicht.
Dass Rey den Internationalismus nicht übersieht sondern vermutlich bewusst ignoriert, zeigt sich bei seiner Darstellung Che Guevaras, der immerhin den Namensgeber des Buches abgibt – vermutlich aus Marketing-Gründen. Denn in Reys Augen ist „der Che“ mit seiner Politik komplett gescheitert. Ganz für sich allein. Das aber geht fehl. War doch der Versuch, durch Guerilla-Aktionen in Lateinamerika die Basis der kubanischen Revolution zu verbreitern, vom Bewusstsein getragen, dass die Revolution international sein müsse. Und so ist Guevara auch an der Schwäche der Revolutionäre in den Metropolen gescheitert. Rey aber scheint es bei seiner Darstellung von Politik und Theorie Guevaras vor allem darum zu gehen, an seinem Beispiel jeglichen Versuch der fundamentalen Veränderung der Gesellschaft als unmöglich zu geißeln.
Der neue Mensch, der für Guevara notwendige Voraussetzung für eine wirklich andere Gesellschaft war, erfordert die Selbstveränderung der Revolutionäre. Diese ist für Rey müßig. Für ihn ist das Ausdruck einer „Gleichmacherei“, die der menschlichen Natur zuwiderlaufe. Verschiedene soziale Schichtungen seien in einer Gesellschaft notwendig, die frei sein wolle. Dass ein solcher Begriff von Freiheit abstrakt bleibt, muss nicht weiter ausgeführt werden. Reys politischer Vorschlag, der sich aus seiner Zusammenfassung herauslesen lässt ohne explizit genannt zu werden, ist deswegen nicht mehr als ein Aufwärmen des in Europa gescheiterten keynesianischen Staatsinterventionismus. Unter diesen Voraussetzungen kann keine zukunftsweisende Analyse der linken Geschichte geleistet werden.
Keine Frage, es ist ein Verdienst, dass Rey sich der Geschichte der Linken einmal als Ganzes angenommen hat. Man sollte das Buch aber gegen den Strich lesen. Dann kommt man zur Erkenntnis, dass Hugo Chávez und die anderen Vertreter der „Neuen Linken“ Lateinamerikas aus der Geschichte einiges gelernt haben. Der praktische Internationalismus der „Bolivarischen Alternative für Lateinamerika“ ALBA wäre ebenso zu nennen wie die strikte Einhaltung des Realitätsprinzips. Ideologische, ultralinke Politik hat noch jeder Revolution geschadet, das zeigen die Beispiele Chiles und Nicaraguas auf ihre Weise.
Rey selber nutzt seine Auseinandersetzung mit der bolivarianischen Revolution hingegen dafür, seine Abneigung gegen Chávez zu pflegen. Während er immer wieder betont, wie wichtig die Verankerung einer politischen Bewegung im Volk sei, analysiert er diese im Fall Venezuelas nicht. Eher attestiert er Chávez anlässlich des 2007 gescheiterten Referendums zur Verfassungsänderung einen „Machthunger, der die eigenen Fähigkeiten überschätzt und letztlich Verachtung für demokratische Prinzipien bedeutet.“ Dass diese harten Worte der Realität nicht entsprechen, weiß jeder, der sich ernsthaft und ohne ideologische Scheuklappen mit der Entwicklung Venezuelas beschäftigt. Das bedeutet nicht, dass in Venezuela alles ohne Probleme laufe. Beileibe nicht. Aber wer den Fehler macht, die Denunziationen des Gegners für bare Münze zu nehmen und für Bestätigung dafür zu suchen, der wird die Realität nicht erfassen. Und dass diese in Venezuela weiter geht, als die Neokeynesianer es gerne hätten, ist offensichtlich. So ist schließlich auch die Ablehnung der Politik von Chávez durch Rey zu erklären. Nur leider ermöglicht dies keinen offenen Blick auf die Geschichte der Linken in Lateinamerika. Schade.
Romeo Rey: Im Sternzeichen des Che Guevara – Theorie und Praxis der Linken in Lateinamerika. Hamburg, VSA-Verlag, 978-3-89965-319-9, 246 Seiten, 18,80 Euro.
Dieser Rezension liegen zwei Beiträge für den Deutschlandfunk und die Lateinamerikanachrichten zu Grunde.
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/andruck/853807/
http://lateinamerikanachrichten.de/?/artikel/3031.html