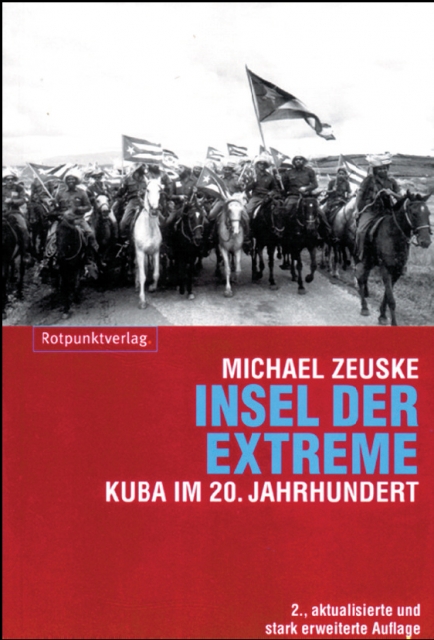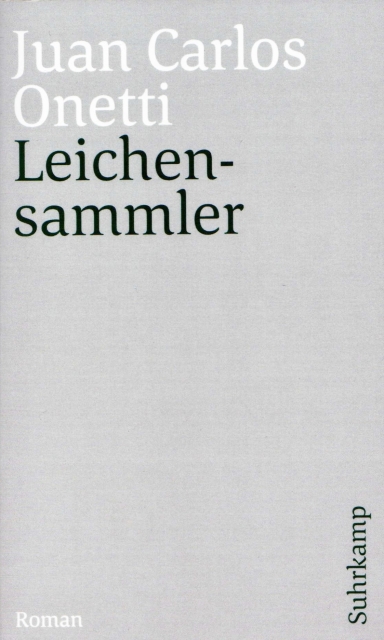Was bleibt, ist die Vielfalt der Menschenschicksale
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten – nein, das war ein Anderes. Aber beim Buch des Garcia Marquez mit der Aura des Exotisch-Alltäglichen geht es mir wie mit dieser Zeile: Mir fällt sie oft ein, wenn diese Stimmung einfällt. In solchen Situationen (wo man am liebsten nicht von dieser Welt, der abendländischen nämlich, wäre), muß ich einfach abhauen. Fliehen. In die Welt eines Gabriel Garcia Marquez. Ich war noch nie da. Und trotzdem glaube ich, sie zu kennen, ja sogar, mich in ihr auszukeimen.
Warum fällt mir dieses Gedicht von Heine ein, wenn ich das Buch „Von der Liebe und anderen Dämonen“ in die Hand nehme, mir das Mädchen mit den ellenlangen Haaren, die nie geschnitten wurden, weil das so vorherbestimmt war, auf dem Cover ansehe und dann dazu die Widmung „Für eine in Tränen aufgelöste Carmen Balcells“ lese und danach den seltsam sachlichen Epilog von GGM zu diesem Buch?
Vielleicht, nein, ganz sicher, weil ich die zu einem Sinn aufgereihten Buchstaben „Hundert Jahre Einsamkeit“ stets erinnere in manchen Gemütslagen. Es ist irgendwie eine Ästhetik der schmerzlichen Erkenntnisse. Und das, während man individuell als durchaus glücklich empfundene Lebensabschnitte in Ein-, Zwei- und Dreisamkeit schätzen lernt.
Was ist dran an den Namen von Namen, Sehnsucht danach: Diesmal sind es Sierva Maria de Todos los Angelos, einzige und nie die Wahrheit sagende jungfräuliche Tochter des ständig halbherzig lebenden Marques de Casaldueros, der eine normal Verrückte liebt, dann Pater Cayetano Delauro, rechte Hand des Bischofs und mit der Heilung der angeblichen Tollwut der Sierva Maria betraut, was allerdings zu einer unsäglichen Liebe führt, die so schön ist, wie sie unerfüllt bleibt und strafbar wäre im Abendland und auch verdammt ist im Marquez-Land…aus anderen Gründen.
Was bleibt ist die Vielfalt der glaubhaften, wenn auch staunend zur Kenntnis genommenen Menschenschicksale, wie das von Bernarda Cabrera, der vor sich hin faulenden, dennoch sich an ihr Leben erinnernden Mutter der Sierva Maria, oder von Dominga de Adviento, der schwarzen Sklavin des Hauses, die Sierva Maria all den schwarzen Magie-Unsinn beibrachte, der einen weiteren unfaßbaren Reiz des Buches ausmacht (die wirklich hilfreichen Halsketten der 12jähri-gen, oh die vielen Halsketten, die alle etwas zu bedeuten haben, auf jeden Fall die Autonomie der Sierva Maria von den Teufelsaustreiberlnnen), von der alten Indianerin Sagunta, die Geheimnisse zur Heilung hoffnungslos Kranker kennt; oder das Schicksal von Abrenuncio, dem bekanntesten und umstrittensten Arzt der Stadt, der dem sogenannten gesunden Menschenverstand frönt, der allemal die Menschen in arge Konflikte mit sich und ihren Gesellschaftsformen treibt.
Es gibt weitere menschliche Menschen in diesem Buch, den Bischof, der eigentlich genug eigene Sehnsüchte hat, als sich um seine Ideologie zu kümmern, die vielen einfältigen, aber machtausübenden Nonnen und – ach, selbst lesen macht Fantasie!
Zu bewundern ist, wie der Garcia Marquez es sich traut, nach wie vor die Verabredung Kunst einzuhalten, und das nach „100 Jahren Einsamkeit“. Er traut sich und hält ein. Alle seine Werke sind Varianten davon, wie profane und eben deshalb auch uns Deutschen im kühlen, aber leidenschaftslosen Winter vertraute Geschichten um Liebe, Sterben, Haß, Ausgrenzung, Intoleranz und Verblödung zu Visionen über das, was die Welt wohl im Innersten zusammenhält, führen.
Allem, was zwischen Geburt und Tod passieren kann an bedeutenden Bedeutungslosigkeiten, ahnst du nach den ersten drei Seiten Lektüre wiederzubegegnen. Du riechst es, du hörst es, du fühlst es, du bist einfach wieder mittendrin -allerdings namenlos.
Diese „Tollwut“ ist eine Art des Andersseins, das in GGM einen schreibend handelnden Lobbyisten hat, durch den selbst die lächerlichste Lebensäußerung zur komprimierten menschlichen Tätigkeit wird. Und meine Seele lächelt und schaukelt heftig in der dialektischen Vermittlung von Objekt und Subjekt.
So habe ich die Veranstaltung Gabriel Garcia Marquez gewählt, bin hineingegangen, weiß also nicht, was es bedeuten soll, und möchte mich auf diesem Wege auch ganz herzlich bei Dagmar Ploetz bedanken, die mit ihrer Leistung dem häufigsten Übersetzer der Marquez’sehen Werke (Curt Meyer-Clason) ganz bestimmt den Wein reichen kann.
Gabriel Garcia Marquez: Von der Liebe und anderen Dämonen. Kiepenheuer & Witsch, 1994