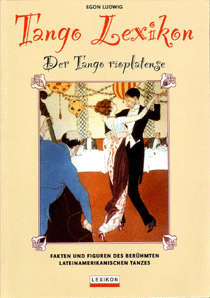Er stieg aus einem Erste-Klasse-Wagen, blieb – die Ledertasche zu seinen Füßen – einen Moment auf dem Bahnsteig stehen und sah zum Bahnhofsausgang hinüber. Dann ergriff er die Tasche und überquerte die Gleise, die Schwellen und das Schotterbett, aus dessen grauer Verschmutzung es golden hervorblinkte. Während der Zug, mit dem er gekommen war, unter einer aschgrauen Rauchwolke, die sich im adretten Blau des Himmels auflöste, immer kleiner wurde und schließlich ganz verschwand, erreichte der Fremde Bahnsteig Eins.
Hier richtete er seinen Blick auf das zwischen zwei Akazien hängende, stark verrußte Ortsschild, wie um sich der Richtigkeit seines Reiseziels zu vergewissern. Hinter dem Ladentisch des Bahnhofskiosks, in dem es Zeitungen, Zeitschriften und Bonbons zu kaufen gab, saß eine Frau und strickte. Ganz so als sei er selber der Kunde, hatte der Schuhputzer vor seinem Schuhputzkasten Platz genommen.
Der Fremde war um die fünfunddreißig. Ein mehrere Tage alter Bart umschattete sein Kinn. Er hatte tiefblaue, fast violette Augen. Seine Kleidung und der Hut waren schwarz.
Nachdem er die Halle durchschritten hatte und bevor er die Bahnhofstreppe hinunterging, blieb er stehen und betrachtete die Jakarandabäume auf dem Pasco de las Delicias. Im Schatten der Morgenländischen Platanen, in der Benommenheit der Siesta warteten drei oder vier Droschken auf Fahrgäste. Die Kutscher auf ihren Böcken dösten mit hängenden Köpfen. Entlang der Straße liefen zwei Wasserrinnen, deren Ränder mit Gras bewachsen waren, damit betraut, den in Reih und Glied stehenden Bäumen Wasser zu spenden. Vorbei an den Fassaden schäbiger Hotels, Kneipen und Pensionen setzte der Fremde seinen Weg fort. Den Dorfbewohnern war der schwarzgekleidete, große, kräftige und mürrische Mann unbekannt. Allenfalls bei den Ältesten hätte er Erinnerungen an eine auffallend ähnliche Erscheinung wachrufen können, die vor vielen Jahren diese Straße entlanggeschritten war. Die hatte die gleichen tiefblauen Augen gehabt, aber statt einer Tasche einen Koffer und nicht schwarze, sondern weiße Kleidung getragen, nämlich Drillich und einen Strohhut.
Der Fremde blieb vor dem Frisiersalon „La Moderna“ stehen, als ob ihm plötzlich etwas eingefallen sei und trat ein. Er brauchte erst gar nicht in den auf einem Tischchen ausgelegten Illustrierten zu blättern, um Wartezeit zu überbrücken. Der Friseur war allein. Als er im Spiegel den Fremden hatte eintreten sehen, hatte er seine Zeitungslektüre unterbrochen und sich von dem Drehstuhl erhoben.
„Guten Tag.“
„Guten Tag. Ich hätte gerne eine Rasur.“
„Bitte nehmen Sie Platz.“
Nachdem der Fremde es sich auf dem Frisierstuhl bequem gemacht hatte, legte der Friseur ihm den weißen Frisiermantel um, den er ihm im Nacken verknotete. Als Nächstes schlug er mit einem großen Pinsel in einer Seifenschale den Rasierschaum. Behutsam seifte er dem Fremden die Wangen und das Kinn ein. Dann wetzte er sein Rasiermesser an dem Streichriemen und warf kurze Blicke auf seinen Kunden, als wolle er berechnen, wie er ihm die Kehle am besten durchschneiden könnte. Währenddessen betrachtete der Fremde sich im Spiegel.
„Heiß, nicht wahr“, sagte der Friseur. „Der Sommer will mal wieder kein Ende nehmen.“
Der Unbekannte würdigte die Beständigkeit des Sommers keines Kommentars. Stattdessen fragte er: „Wie viele Hotels hat Cabildo?“
„Zwei“, antwortete der Friseur. „Das Zentralhotel und das Bahnhofshotel. Alle anderen kann man nur als üble Absteigen bezeichnen.“
„Und welches würden Sie mir empfehlen?“
„Um ehrlich zu sein, Señor, kann ich Ihnen über die Qualität der hiesigen Hotels eigentlich nichts sagen. Als Einheimischer mache ich von ihnen natürlich keinen Gebrauch. Das Zentralhotel führen zwei italienische Brüder, die noch keine fünf Jahre im Ort sind. Das Bahnhofshotel hat es bereits vor meiner Zeit gegeben und ich bin nun schon mehr als fünfundzwanzig Jahre hier.“
Der Fremde sah ihn im Spiegel an.
„Sie haben einen ziemlich kräftigen Bart“, stellte der Friseur fest.
Er nahm das Rasiermesser vom Gesicht des Kunden und reinigte es von Seife und Haaren auf einem Stück Toilettenpapier, das er anschließend in einen Mülleimer warf.
„Ich bin ja kein Hiesiger, Señor. Ich stamme ursprünglich aus Freirina. Bei meiner Ankunft existierte dieser Salon schon viele Jahre. Es ist der älteste im Dorf, Señor, auch wenn er ,La Moderna‘ heißt. Sein erster Eigentümer hat ihn so getauft. Angefangen habe ich als sein Geselle und als er sich fürs Geschäft zu alt fühlte und sich zurückziehen wollte, kaufte ich ihm den Laden ab. Den Namen habe ich aber beibehalten. Alteingeführte Namen, an die die Kunden sich gewöhnt haben, ändert man besser nicht mehr, nicht wahr, Señor? Als der Firmengründer seinen Salon ,La Moderna‘ nannte, traf die Bezeichnung sicherlich zu, aber inzwischen ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen und so lange hält sich keine Modernität. Die Namen stimmen eben nicht immer. Eine Ortschaft hier in der Nähe heißt Johannisbrotwäldchen, aber Sie werden weit und breit keinen einzigen Johannisbrotbaum finden – da können Sie so viel suchen, wie Sie wollen!“
Er lächelte den Fremden an. Der aber blieb ernst und sagte: „Scheint ein ziemlich ruhiges Dorf zu sein.“
„Zu ruhig, wenn man den jungen Leuten glauben darf. Deshalb wandern sie auch alle ab.
Nach Santiago und Valparaiso, in die großen und schnelllebigen Städte. Wo man studieren kann oder arbeiten und Karriere machen: Hier haben sie keine große Zukunft. Früher gab es Minen, aber die wurden geschlossen. Bleibt nur die Landwirtschaft: das Vieh – Rinder und Ziegen – oder der Wein. Bei uns wird der beste Sherry des Kleinen Nordens hergestellt, nach traditionellen Methoden, die vom Vater an den Sohn vererbt werden … Aber die Jugend findet ja keinen Geschmack mehr an solchen Berufen. Und so gehen sie fort. Uns Alten hingegen sagt das gemächliche Leben zu!“
„War aber nicht immer so beschaulich, nach dem was man so hört! Überfälle auf die Landgüter der Umgebung waren doch wohl an der Tagesordnung – und Viehdiebe, die das Land verwüsteten, nicht wahr? Ist nicht auch Alma Negra von hier, aus Cabildo?“
„Die ,Schwarze Seele“? Ja, früher! Heute hat er sich zur Ruhe gesetzt. Zu seiner Zeit war er allerdings ziemlich gefährlich – ein richtiger Teufel! Aber dann wurde er alt und konnte keiner Fliege mehr etwas zu Leide tun. Die Jahre haben ihm die Klauen abgefeilt. Seitdem lebt er allein, in der Nähe von Tarnbo, am Ortsende von Cabildo auf dem Weg nach Canelo.
Bewirtschaftet eine kleine Klitsche. Leidet an Rheumatismus. Kommt nur zwei- oder dreimal im Monat zum Einkaufen ins Dorf. Ganz zerlumpt und schmutzig. Im vergangenen Jahr wurde er auf der Polizeiwache von Bajo vorstellig, um den Diebstahl von drei Tieren anzuzeigen! Es war, als hätte man dem Adler die Eier aus dem Horst gestohlen! – Ein ziemlich alter Adler! Die Polizisten haben sich fast totgelacht. ,Sich mal einer an! Wie gemein! Das hat dem Herrn also nicht gefallen!‘ Na ja, womit jemand sündigt, damit wird er auch bestraft. Das ist der Lauf der Dinge! Vor fünfundzwanzig Jahren war im Kleinen Norden zwischen Sonnenuntergang und Morgengrauen kein Stück Vieh davor gefeit, nicht im Besitz der Bande von Alma Negra zu landen. Aber erwischen ließ er sich nie. Dafür war er zu gerieben und aalglatt… Und dann waren da noch seine Helfershelfer bei Gericht. Wäre er mal verhaftet worden, hätten sie ihn eiligst wieder auf freien Fuß gesetzt. Einige hohe Tiere hielten ihre schützenden Hände über ihn, benötigten sie ihn doch als Schläger bei ihren Wahlkämpfen. Direkt hier, in Cabildo, Señor, unmittelbar vor dem Postamt, prügelten die Männer von Alma Negra eines Nachts während eines Parlamentskampfes den Doktor Alcayaga zu Tode. Jeder im Dorf kannte die Täter, aber gegen sie als Zeuge aufzutreten, traute sich keiner. Viele haben dem Morden hinter Fensterläden und Gardinen zugeschaut und auch die Hilferufe vernommen, aber niemand ging hinaus und tat etwas! Später hieß es, die Schläger hätten nicht den Auftrag gehabt, den Arzt zu töten. Sie sollten ihm lediglich Angst einjagen und ihn dazu bringen, seine Kandidatur zurückzuziehen. Weil er sich aber zur Wehr setzte und um Hilfe schrie und so möglicherweise viele Leute hätte aufwecken können, verloren die Schläger die Nerven und wollten ihn zum Schweigen bringen. Da haben sie wohl etwas zu hart zugeschlagen. Sterbend ließen sie ihn auf der Straße zurück und machten sich davon. Und keiner kam heraus, um ihm Hilfe zu leisten. Ebenso wenig brachte jemand den Mut auf, gegen die Mörder auszusagen und so wurden sie niemals identifiziert. Wie ich schon sagte, viele schauten dem Morden durchs Fenster zu, aber später wollte dann keiner etwas gesehen haben.“
Der Friseur meinte im Blick des Fremden, der seinem im Spiegel begegnete, einen geheimen Vorwurf zu spüren.
„Ich war damals noch nicht im Dorf. Ich kam erst zwei Jahre später. Alles, was ich Ihnen erzähle, weiß ich nur vom Hörensagen. Diese Affäre war seinerzeit im Kleinen Norden in aller Munde. Obwohl das ganze Dorf dem Doktor Dank schuldete, war, als es darauf ankam, keiner für ihn da. Bedürftige hatte er kostenlos behandelt, den Ärmsten der Armen sogar die Medikamente geschenkt. Später wurde bekannt, wer die Tracht Prügel mit tödlichem Ausgang in Auftrag gegeben hatte. Denn Alma Negra und seine Männer hatten den Arzt nicht auf eigene Rechnung und Gefahr überfallen, sondern auf Geheiß eines sehr mächtigen hiesigen Gutsbesitzers: Don Pancho Necochea. In dem Wahlkampf jener Tage konkurrierte er mit dem Doktor Alcayaga um einen Abgeordnetensitz im Senat, der sonst immer an die Konservativen, also an Don Panchos Partei, gegangen war. Aber nun war er zum ersten Mal in Gefahr. Für die Bauern war es so selbstverständlich, den ,Herrn‘ zu wählen oder den Kandidaten des Herrn, dass Don Pancho sie bisweilen gegen ihren Willen zwingen musste, dem Mann der Opposition die Stimme zu geben, bloß um das Ganze wie eine demokratische Wahl aussehen zu lassen. Aber jetzt schien es ernsthaft auf einen demokratischen Urnengang hinauszulaufen. Der Doktor Alcayaga von der Liberalen Partei erfreute sich beim einfachen Volk größter Beliebtheit und man wusste, dass viele gegen die Konservativen stimmen würden, aber diesmal nicht vorgetäuscht und von Don Pancho dazu verpflichtet, sondern aus freien Stücken. Der Gutsbesitzer wurde entsprechend unruhig. Selbstverständlich hatte er nicht den Auftrag erteilt, seinen Gegner zu töten. Dem Doktor sollte doch nichts anderes als ein wenig Angst gemacht werden.“
„Und was wurde aus Don Pancho Necochea?“
„Er starb, Señor. Schon vor vielen Jahren. Vor dem großen Beben.“
„Blieben nur seine Söhne, wahre Taugenichtse und Verschwender, die das ererbte Vermögen mit vollen Händen aus dein Fenster warfen. Dafür hatte der Alte also das viele Geld angehäuft, dass seine Brut es bei Gelagen mit anderen Hallodris auf den Kopf haute. Letztendlich weiß man eben nie, für wen man sich abrackert! Sie verschleuderten die ganze Hinterlassenschaft für Weiber und Glücksspiel, vernachlässigten das Vieh und die Ernte und verjubelten selbst die Hazienda in Peralillo, die immer der ganze Stolz von Don Pancho gewesen war. Am Ende verloren sie auch noch das letzte bisschen Verstand. Wenn sie betrunken waren, drehten sie vollends durch. Mit ihren Saufkumpanen galoppierten sie plötzlich ins Dorf und schössen auf dem Paseo de las Delicias wild in die Luft, wie um zu sagen: Die Gebrüder Necochea und ihre Freunde sind da und wollen sich jetzt amüsieren. Dann ritten sie einfach auf ihren Pferden ins Bahnhofshotel. Unter der Weinlaube saßen sie ab. Im Schankraum meinten sie ein paar Schießübungen machen zu müssen, wobei ihnen die Flaschen als Zielscheiben dienten. Die Stammgäste waren untröstlich ob derartiger Alkoholverschwendung. Seht ihr diese Flasche Anis del Mono? Den hässlichen Affen werden wir gleich abknallen! Die Sherryflasche? Schau nur, wie ich es ihr besorge! In der Wirtschaft hinterließen sie ein Meer von Glasscherben und einen Gestank, der einen schon beim bloßen Einatmen umhaute. Die Polizisten unternahmen erst gar nicht den Versuch, sich mit ihnen anzulegen. Im Anschluss haben die Necocheas ja auch immer alles bezahlt. Am Tag darauf kam nämlich der Gutsverwalter von Peralillo, um die vom Hotelbesitzer bereits aufgestellte Rechnung für die Zerstörung zu begleichen. Bei ihren zahlreichen Streifzügen durch die Gegend nahmen die Brüder jede junge und hübsche Unschuld vom Lande, die ihnen über den Weg lief, zu einem Meinen Ritt mit – ob sie wollte oder nicht. Wurden die Mädchen schwanger, entledigten sie sich ihrer und schließlich liefen überall ihre unehelichen Kinder herum. Einmal haben sie es dann aber doch zu weit getrieben! An einem Prozessionssonntag hatten die Gläubigen Unsere Liebe Frau von der Wundertätigen Medaille auf einem Traggestell ins Freie gebracht. Der Zug bewegte sich gerade durch die Calle del Comercio, als die nach einer durchzechten Nacht immer noch betrunkenen Brüder heranpreschten. Um sich einen Spaß zu machen, fing Raul, der älteste und verrückteste von ihnen, die Muttergottes mit dem Lasso und schrie: ,Diese schöne Jungfrau hat mir in meiner Sammlung noch gefehlt!‘ Und er riss sie aus der Tragevorrichtung und schleifte sie im Galopp einige Viertelmeilen hinter sich her. Viele der Bittgänger waren berittene Landarbeiter, die die Verfolgung der Übeltäter aufnahmen und sie lynchen wollten. Die Teufelsbrüder, wie man sie nannte, konnten sich von diesem Tag an in Cabildo nicht mehr blicken lassen. Hier hatte man über sie gerichtet. Mit diesen Dingen scherzt man nicht, Señor. Sie waren wirklich des Teufels. Unserer Lieben Frau von der Wundertätigen Medaille bereiteten die Gläubigen eine Entsühnungsfeier, zu der sogar der Bischof von La Serena anreiste. Nun mussten die diabolischen Brüder endgültig fort von hier. Es hielt sie ja auch sonst nichts in diesem Landstrich. Wie es heißt, leben sie heute in Santiago. Alt, gebrechlich und bankrott.“
„Wie Alma Negra, alt, gebrechlich …“
„Wenn Sie sehen würden, wie er haust, Señor. In einem Schweinestall voller Ungeziefer, im Schmutz. Die Spinnen und Wanzen haben wahrscheinlich nur aus Angst, sich zu vergiften, darauf verzichtet, ihn zu beißen …“
* * * * *
Der Fremde verließ den Frisiersalon und schlenderte zur Plaza hinüber. An der Ecke, wo der Pasco de las Delicias und die Calle del Comercio zusammentreffen, bog er ab. Vor dem Postgebäude war er einen Augenblick lang stehen geblieben und hatte sich nachdenklich umgeschaut. Dann nahm er den Weg wieder auf, vorbei an den Verkaufsbuden der Araber, den Lebensmittelgeschäften der Italiener, den Bäckereien der Spanier und den Obst- und Gemüsehandlungen der Kreolen. Einige kleine Jungen besprengten den Bürgersteig mit Wasser, das sie mit Blechbüchsen aus den Rinnen zogen. Dabei wirbelten sie erneut Staub auf. Über allem lag der Geruch von feuchter Erde und duftender Minze. Der Fremde ging schnurstracks auf das Zentralhotel zu, dessen Name über der Eingangstür auf einem Schild tanzte.
Sein Schatten unter dem Giebelfenster schien hinter der Rezeption einen dicken und kahlköpfigen Mann geweckt zu haben. Dieser ließ den Gast im Fremdenbuch Name, Beruf und Adresse eintragen und unterschreiben, bevor er ihn durch einen Flur zu seinem Zimmer geleitete. Die tapezierten Wände schmückten zwei Bilder von Schlössern, die aus den Wassern von Seen aufzutauchen schienen. Vor einem Spiegel, auf der Kommode, eine Waschschüssel aus Porzellan, mit einem Sprung, dazu ein weißer Krug, ebenfalls lädiert. Der Fremde, nun allein, hing seine Anzugsjacke auf einen Kleiderbügel. Anschließend ließ er sich auf die Pritsche fallen, was diese mit einem Knarren beantwortete. Seufzend streckte er seine Beine aus und schloss die Augen. Von weitem drang das hitzige Girren der Turteltauben an sein Ohr und die Schreie der Bronzekiebitze verrieten den nahen Fluss.
Als er sich wieder erhob, hatte die Hitze bereits etwas nachgelassen. Aus dem Krug goss er Wasser in die Waschschüssel und wusch sieh den entblößten Oberkörper und das Gesicht. Er fuhr sich mit dem Kamm durchs Haar. Seinem Gepäck, das auf einem Tischchen stand, entnahm er ein sauberes Hemd und zog es an. Ebenfalls holte er einen Revolver hervor, den er in die Gesäßtasche seiner Hose steckte…
Er ging auf die Straße hinaus. Nach kurzem Zögern hatte er einen Entschluss gefasst. Er legte drei Viertelmeilen zurück und betrat das Kasino des Centro Español. Nachdem er sich im Saal umgesehen hatte, wählte er einen Tisch nahe der Tür. Ein dunkelhaariger Mann mit Weste prüfte hinter der Theke Rechnungen. Von den Dielen stieg saurer Weingeruch auf. Die klebrig glänzenden Fliegenfänger hingen voller Insekten. Pin-up-Kalender und Plakate von längst vergangenen Stierkämpfen in spanischen Städten zierten die Wände. Ein Kellner, eine weiße Serviette über dem Unterarm, eilte herbei. Der Fremde bestellte Bier und einen Teller mit Oliven und Käse.
Er trat aus dem Kasino – das Bier hatte er getrunken, die Oliven und den Käse aber fast unberührt gelassen – und ließ auf einer Straße, aus der schließlich ein Feldweg wurde, das Dorf hinter sich. Sein Weg führte ihn unter Orangenbäumen vorbei an eintönigen, Aachen Lehmbehausungen und abbröckelnden Mauern von Landhäusern, über die die Wipfel von Walnuss- und Avocadobäumen ragten. Um die Zäune rankten sich feurig erblühte Bougainvileen, die eine besondere Anziehungskraft auf die Kolibris ausübten. Der Wohlgeruch von Jasmin und Geißblatt erfüllte die Luft. Zuweilen erstrahlte das glänzende Laub eines Granatapfelbaums.
Der silberfarbene und von duftendem Greiskraut, Brombeeren, Weiden und Sand gesäumte Fluss verlor sich zwischen grauen Steinen. An seinen seichten Stellen schimmerten weiß die Reiher hervor.
Der Fremde spürte den Wind im Gesicht. Da war die Brücke. Er überquerte sie ohne Hast, blieb in der Mitte stehen und sah zu, wie der Fluss mit der untergehenden Sonne verschwand. Er nahm den Weg wieder auf. Hinter einer Biegung ließ er seinen Blick schweifen und entdeckte an einem von Fenchel und Feigenbäumen gesäumten Pfad die Hütte. Genauso hatte der Friseur sie ihm beschrieben.
Ein paar Hunde schlugen an. Ein alter und zerlumpter Mann lugte hervor, nachdem er am Eingang seiner Behausung eine Art von sackleinener Gardine zurückgeschoben hatte. Er war klein und dunkelhaarig. Der Bart spärlich. Das Haar grau. Ein erbärmlicher Anblick. Er schien einem plattrealistischen Kitschgemälde entsprungen zu sein.
Den Fremden überfiel die schmerzhafte Erkenntnis, dass jenes nicht mehr der Mann von früher war. Aber er war es gewesen! Er war es gewesen!…Und wird es auch für alle Zeit bleiben!
„Was wollen Sie?“, fragte der Alte und blickte ihn voller Misstrauen an.
„Ich wollte dich kennen lernen.“
Die Hunde blafften den Fremden weiter an. Er zog seinen Revolver.
„Erschießen Sie sie nicht“, bat der Alte.
Der Fremde gab zwei Schüsse in die Luft ab. Die Hunde liefen davon, blieben aber in Reichweite, im Schutz eines Gestrüpps.
„Scheren Sie sich fort“, brüllte der Alte wütend.
Der Fremde verpasste ihm einen Kinnhaken. Er schlug ihn zu Boden. Wutschnaubend traktierte er ihn mit Fußtritten. Er war außer sich. Dann ließ er von ihm ab: „Du sollst wissen, wer ich bin. Alter.“
„Ich weiß, wer Sie sind“, erwiderte dieser. Sein Gesicht blutete.
„Wenn Sie mich töten, machen sie ihn nicht wieder lebendig.“
„Es geschieht nicht um seinetwillen, Alter. Ich tue es für mich“, sagte der Fremde. „Aber ich werde dich nicht töten. Leb dein verfluchtes Leben zu Ende!“
Das Gekläff der Hunde folgte ihm noch bis hinter die Wegbiegung.