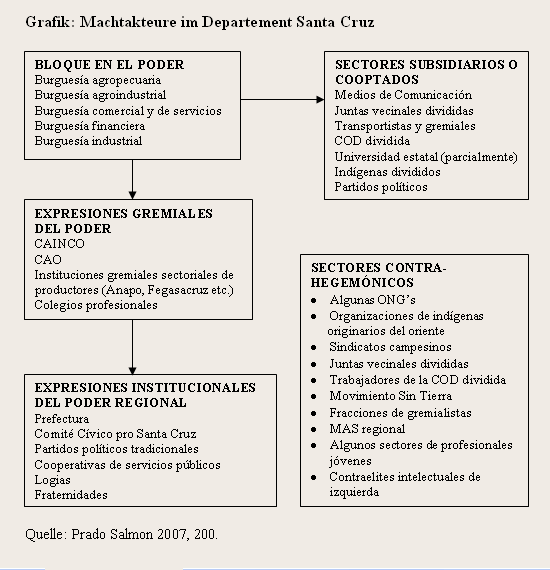Guatemala ist das einzige Land Zentralamerikas, in dem die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen linker Guerrilla und Armee noch nicht beendet sind. Seit 35 Jahre tobt nun schon ein Bürgerkrieg, in dem 150.000 – 200.000 Guatemalteken ermordet wurden oder spurlos verschwanden. Dabei ging der geringste Teil auf das Konto direkter Kampfhandlungen. Seit 1954 überzogen staatliche und paramilitärische Repression in drei großen Terrorwellen das Land und forderten das Leben von Kommunisten und Christen, Gewerkschaftern und cooperativistas, Studenten und Bauern, indígenas und Ladinos. Blutiger Höhepunkt war 1981 -83 das Genozid an der indianischen Bevölkerungsmehrheit. Im Zuge der Politik der verbrannten Erde wurden damals 440 Dörfer von der Landkarte gelöscht, hunderttausende Kinder zu Waisen gemacht und eine Million Menschen zur Flucht gezwungen. Obwohl Gewalt nicht nur in Zentralamerika lange und blutige Traditionen hat, stellen Dauer und Intensität des guatemaltekischen Dramas ähnliche Konflikte in den Schatten. Die Wurzeln reichen weit in die Vergangenheit zurück.[1]
Das Erbe der capitanía general
Vor Erlangung der Unabhängigkeit war alles Land von Chiapas bis Costa Rica dem Reino de Guatemala zugeteilt. Guatemala gab diesem Teil des spanischen Kolonialimperiums nicht nur seinen Namen, es war zugleich Kernland der kolonialen capitanía general. Und das in einem sehr widersprüchlichen Sinne: Nicht allein, dass es politisches, ökonomisches und demographisches Zentrum war, hier waren auch Basis wie Spitze der sozialen Pyramide – indianische Landbevölkerung und Kolonialaristokratie – besonders stark konzentriert. Die einen wie die anderen zeichneten sich durch ein erstaunliches Beharrungsvermögen aus, was der guatemaltekischen Gesellschaft bis heute ihr unverwechselbares Gepräge gibt und sie vom Rest der einstigen capitanía general deutlich unterscheidet. Es liegt auf der Hand, dass staatlicher Zentralismus und Bürokratie hier tiefer verwurzelt und stärker präsent sind als in der übrigen Region. Besonders ins Gewicht fallen aber die ethnischen, strukturellen und sozialpsychologischen Kontinuitätslinien, die sich von der kolonialen Vergangenheit bis ins heutige Guatemala ziehen und die – weil sie nicht gekappt, sondern höchstens modernisiert wurden – zu Fallstricken für seine Zukunft werden können.
Indianische Bevölkerungsmehrheit und Rassismus: Während im übrigen Zentralamerika die indígenas fast völlig ausgerottet sind oder als marginalisierte Minderheit existieren, sind 60% der guatemaltekischen Bevölkerung Maya. Von der spanischen Eroberung bis heute rekrutiert sich aus ihnen die Masse der Arbeitskräfte. Durch die liberale reforma von 1871 gewaltsam in die Agrarexportproduktion (Kaffee) für den Weltmarkt integriert, bilden sie die am meisten unterdrückte und ausgebeutete Gruppe der Bevölkerung. Erst 1944 wurde die Zwangsarbeit für die „Indios“ aufgehoben. Vielen Ladinos gilt der „Indio“ als hinterhältig, verräterisch, faul und dumm. Der teils unterschwellig wirkende, teils offen vertretene Rassismus soll einerseits die Diskriminierung der Maya-Bevölkerung legitimieren, andererseits wird damit nach dem traditionellen Motto „teile und herrsche“ verfahren. Die indígenas sind auf vielfältige Weise benachteiligt: beim Landbesitz, bei der Bildung, beim Einkommen, bei der Wahrung ihrer traditionellen Kultur. Während sie in der Kolonialzeit unter dem Schutz der Krone ihre Lebensweise größtenteils bewahren konnten, waren sie die großen Verlierer der liberalen Ära, ohne jedoch in ihrer Existenz und Identität grundsätzlich gefährdet zu sein. Der Kapitalismus in Guatemala war und ist ganz einfach zu schwach und unterentwickelt, um diese Assimilationsleistung – selbst unter Gewaltanwendung – vollbringen zu können.
Fragmentierung und Polarisierung: Die guatemaltekische Gesellschaft ist fragmentiert. Ähnlich wie in der kolonialen Vergangenheit sind die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen fast wie Kasten voneinander geschieden. Was im Verhältnis zwischen indígenas und ladinos offensichtlich ist, gilt auch für die sozialen Beziehungen: jede Schicht oder Gruppe lebt in ihrer eigenen Welt. Hinzu kommt die extrem hohe Polarisierung zwischen unten und oben, arm und reich. Eine ausgleichende Mitte fehlt (siehe Randtext).
Reaktionär gefärbter Konservatismus und soziale Abgeschlossenheit [2]: Diese Eigenschaften kennzeichnen in besonderem Maße die guatemaltekische Oberschicht und prägen deren oligarchischen Charakter. Die ökonomische Macht ist in den Händen einer – auch im zentralamerikanischen Vergleich – extrem kleinen Gruppe monopolisiert. Sie pflegt nicht nur den rassischen und sozialen Hochmut der hauptstädtischen Kolonialaristokratie der capitanía general, mit der sie über alle Veränderungen und Umschichtungen hinweg familiär verbunden blieb. Trotz häufigen Aufenthalts in Miami suchen sich die neuen alten Aristokraten der Wirtschaft und Banken vom internationalen Wettbewerb abzuschotten und lassen kaum Newcomer von außen, geschweige denn von unten, in ihre auserwählte Runde ein. Gegenüber der noch jungen indianischen Bourgeoisie praktizieren sie erfolgreich eine Art ökonomischer Apartheid. Mittels einer ausgeklügelten Heiratspolitik bleibt die Oligarchie ungeachtet aller Diversifizierung unter sich und kann so auch die Wirtschaft uneingeschränkt kontrollieren. In ihrer sozialen Abgeschlossenheit und fast autistischen Selbstgenügsamkeit nimmt sie die Probleme von Land und Leuten kaum zur Kenntnis. Fremd im eigenen Land, hält sie an einer schematischen Weltsicht fest, die nur Schwarz und Weiß kennt. Versuche, außerhalb Zentralamerikas wirtschaftlich Fuß zu fassen, endeten bislang als Desaster. Selbst die eigenen Intellektuellen finden kein Gehör und ernsthafte Modernisierungsabsichten werden höchstens individuell und informell geäußert. Bei der guatemaltekischen Oligarchie verbinden sich extreme Machtkonzentration, soziale Abgeschlossenheit und schematische Weltsicht zu einem Gemenge, das selbst systemstabilisierenden Reformversuchen kaum eine Chance lässt. Unfähig, auch nur kleinste Zugeständnisse zu machen, sucht sie den Status quo in Beton zu gießen und treibt so das Land mit seinen gärenden Konflikten in die soziale Explosion.
Modernisierungsversuche im Hinterhof
Alle Versuche, die Guatemala den Anschluss an eine moderne Entwicklung sichern und das Land revolutionieren sollten, scheiterten entweder an ihrer Halbherzigkeit oder, wenn ernst gemeint, am Widerstand von Oligarchie und Dollarimperialismus. Konservative Independencia 1821 [3], liberale Reforma 1871 und nationalreformistische Revolución de Octubre 1944 konnten alle ihr Modernisierungsversprechen nicht einlösen. Während die Unabhängigkeitsbewegung und die Reforma (siehe Randtext) vor allem am Fehlen einer Massenbasis und ihrer elitären Selbstbegrenzung scheiterten, bot die Revolution von 1944 erstmals die Chance, dass kapitalistische Modernisierung auch der Bevölkerung zugute kam.
Am 20. Oktober jenes Jahres begann ein 10 Jahre währender „demokratischer Frühling“. Die Guatemalteken genossen Freiheiten, die ihnen bislang verwehrt gewesen waren: freie und geheime Wahlen, Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Gewerkschaften und später auch Bauernorganisationen entstanden und erhielten massenhaften Zulauf. Neue Parteien unter Führung junger Intellektueller strebten unter dem Banner der guatemaltekischen „Oktoberrevolution“ nach Einfluss und Regierungsmacht. Mit der Agrarreform von 1952 gewann die Revolution an politischer Brisanz und sozialem Gehalt. Erstmals in der guatemaltekischen Geschichte wurde nicht-bewirtschaftetes Latifundio-Land in großem Umfang an Bauern und peones verteilt. Selbst der United Fruit, dem übermächtigen Bananenkonzern mit Sitz in Boston, ging es an die unbestellten Flächen. Für die einheimische Oligarchie und die USA war es Grund genug, der Revolutionsregierung unter Arbenz, die „nur“ dem guatemaltekischen Kapitalismus endlich eigene Grundlagen (Binnenmarkt), verschaffen wollte, den Krieg zu erklären.
1954 fand der „demokratische Frühling“ im Zusammenspiel von CIA, United Fruit, Armeeführung und Oligarchie sein Ende. Der Hoffnung folgte das Trauma, der Agrarreform folgte die triumphierende Konterrevolution, der Demokratie folgte die Diktatur der „Befreier“, dem Versuch einer Entwicklung durch Reformen folgte das Entwicklungsmodell einer ökonomischen Modernisierung ohne Reformen. Das fortwirkende Erbe der Vergangenheit und das fortgesetzte Scheitern aller ernsthaften Modernisierungsversuche führten Guatemala in einen langen Winter der Gewalt. Ohne staatliche Gewalt waren der gewollte Verzicht auf Reformen und die dauerhafte Beschränkung der Modernsierung auf die Wirtschaft nicht durchzuhalten. Auf den erwachenden Widerstand (Militärrevolte 1960, Aufstände in den Städten 1961 und erste Guerrilla-Aktivitäten 1962) reagierte der Staat prompt: er lenkte den begrenzten Modernisierungsimpuls auf das blutige Feld der Repression. Mit der traditionellen Diktatur, wie sie unter Castillo Armas (1954-57) und General Ydigoras (1958-63) noch einmal versucht worden war, ließ sich der neue Modernisierungskurs politisch nicht absichern. Angesichts der Gefahr der Wiederwahl des ersten Präsidenten der Revolutionszeit, J. J. Arévalo (1945-51), ergriff die Armee präventiv die Initiative und putschte sich 1963 an die Macht. Unter der Regierung von Oberst Peralta Azurdia wird Guatemala neben Vietnam zum bevorzugten Experimentierfeld der USA für die Erprobung und Perfektionierung der Aufstandsbekämpfung (span.: Contrainsurgencia). Seitdem hält die Institution Armee – und nicht nur ein diktatorischer General – die Staatsmacht in Händen. Die vier Jahre Zivilregierung (1966-70) ändern daran nichts. Sie dienten vielmehr als legitimatorisches Feigenblatt der Counterinsurgency. Die Zivilbevölkerung im Osten des Landes hatte in dieser Zeit einen hohen Blutzoll zu entrichten: 4-6000 wurden von der Armee. massakriert, um der Guerrilla ihre soziale Basis zu nehmen. Eigene Fehler und die politischen wie militärischen Erfolge der Contrainsurgencia besiegelten Ende der 60er Jahre vorerst das Schicksal der Guerrilla in Guatemala.
Das Fazit seit 1954: Ökonomische Modernisierung bleibt auf Diversifizierung begrenzt. Beschleunigtes Wachstum soll Reformen ersetzen und überflüssig machen. Erreicht wurde aber das Gegenteil. Die nur partielle Modernisierung glich bestehende Widersprüche und Unterschiede nicht aus, sondern vertiefte sie noch. Der antireformerische Imperativ des neue Entwicklungsmodells ließ nur einen „Ausweg“ zu: technische Perfektionierung und institutionelle Modernisierung der staatlichen Repression sowie Abschottung des politischen Systems nach links.
Nach Jahrzehnten diktatorischer Herrschaft hat Guatemala nun seit 1986 wieder zivile Präsidenten. Demokratisches Procedere und demokratische Institutionen haben seitdem Einzug ins politische Leben des Landes gehalten. Ist dieser erzwungene und längst überfällige Modernisierungsschritt aber schon ausreichend, mit der jahrzehntealten Logik der partiellen, repressiven und polarisierenden Modernisierung zu brechen oder eröffnet er nur einen neuen Reigen im alten Spiel?
Neun Paradoxien der Transition[4]
Die Transition in Guatemala sieht sich in einen historischen Kontext eingebettet, in dem sich härteste Repression und versuchte Demokratisierung gegenüberstehen. Nicht nur im zentralamerikanischen Rahmen kann Guatemala – bei aller Konkurrenz – als Rekordhalter in Sachen Staatsterror angesehen werden. In keinem anderen Land Lateinamerikas hat er mehr Menschenleben gefordert als dort. Andererseits können die zehn Jahre, zwischen 1944 und 1954 für sich in Anspruch nehmen, am hohen Demokratiestandard Costa Ricas gemessen zu werden. Mit einem – allerdings wesentlichen – Unterschied: Während im südlichen Nachbarland die Armee im Ergebnis des Bürgerkriegs 1948 abgeschafft wurde, galt die guatemaltekische Armee bis zum Juni 1954 als Garant des „demokratischen Frühlings“ der Revolutionszeit. Eine Illusion, die gemeinsam mit der Reformdemokratie von 1944 im Verrat der Armee endete. Durch das Scheitern der Oktoberrevolution radikalisierte sich der Gegensatz von traditionellem Autoritarismus und neuer Demokratie zum Entweder-Oder von Konterrevolution und Revolution. Im Gegeneinander von restaurativer wie präventiver Konterrevolution und Sozialrevolutionär orientierter Guerrilla sollte nun ein Übergang zur Demokratie beginnen?! In den polarisierenden Gegensatz von Revolution und Konterrevolution gestellt, zeigt die Transition Paradoxien, die zu sehen und klären unabdingbar ist, will man Aufschluss über Ursprünge, Akteure, Verlauf und Perspektiven des Übergangs zur Demokratie erlangen.
Erste Paradoxie
Beide Seiten – contrainsurgencia und revolutionäre Bewegung – können den Transitionsprozess für sich reklamieren. „Das guatemaltekische demokratische System ist ein Kind der contrainsurgencia.“[5] Noch deutlicher die Aussage des Verteidigungsministers der ersten Zivilregierung: „Die Transition in Guatemala – die Leute wollen das nicht akzeptieren, sie wissen es, erkennen es aber nicht an – ist ein militärisches Projekt.“[6] Oder andersherum: „Diese Demokratie ist das unerwünschte Kind der revolutionären Bewegung.“[7] Das Paradoxe ist, beide Seiten haben Recht. Ohne den Druck von Guerrilla und verbündeter Volksbewegung, die die herrschende Klasse und den guatemaltekischen Staat mit dem Übergang in die 80er Jahre in die schwerste politische Krise seit 1954 stürzten, wäre es wohl auf absehbare Zeit beim Alten geblieben. So aber sah sich – und das ist die zweite Seite der Medaille – die Armeeführung (!) veranlasst, die Transition 1982 mit dem Sturz des korrupten Generalspräsidenten Lucas Garcia in Gang zu setzen. Und dies mit dem Ziel, die Auf Standsbewegung politisch schachmatt zu setzen: „In Guatemala ist die Transition die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln.“[8]
Zweite Paradoxie
Am Beginn der Transition stand 1982/83 das Genozid an der indianischen Bevölkerung im Westen des Landes. Dies war für die Militärjunta unter General Rios Montt eine wesentliche Voraussetzung für den Beginn des Übergangs zu einer Zivilregierung. Damit sollte der Guerrilla die soziale Basis entzogen werden, um sie dann militärisch besiegen zu können. Dem gingen 1980/81 die Zerschlagung der Volksbewegung und der Infrastruktur der Guerrilla in der Hauptstadt voraus. Die guatemaltekische Transition wurde mit dem Kainsmal des Massenmords geboren. Mit Völkermord und Repression musste ihr erst der Boden bereitet werden.
Dritte Paradoxie
Die guatemaltekische Guerrilla ist die am längsten agierende und zugleich die schwächste unter den in Zentralamerika beheimateten Sozialrevolutionären Bewegungen. Sie entstand Anfang der 60er Jahre aus dem Zusammengehen von nationalistischen Militärs, die 1960 erfolglos den Aufstand geprobt hatten, Studentenbewegung und Kommunistischer Partei (PGT). In den 60er Jahren konnte sie für sich in Anspruch nehmen, die wichtigste und für das „ancien régime“ gefährlichste Bewegung in der Region zu sein. Nach bitteren Niederlagen und dem schwierigen Neubeginn Anfang der 70er Jahre fanden die aus den historischen FAR[9] entstandenen Organisationen im revolutionären Aufschwung Ende des Jahrzehnts wieder Anschluss an den allgemeinen Aufwärtstrend der zentralamerikanischen Guerrilla. Auf dem Höhepunkt ihres Einflusses 1982/83 wurde die guatemaltekische Guerrilla, die sich im Februar 1982 zur URNG[10] zusammengeschlossen hatte, von der brutalen Gegenoffensive der Armee derart überrascht, dass sie ihre militärische Schlagkraft dank Rückzug zwar erhalten konnte, aber ihrer ursprünglichen Massenbasis unter der indianischen Bevölkerung im Westen des Landes verlustig ging. Diese Niederlage zeitigte ihrerseits paradoxe Folgen: die geographisch wie politisch an den Rand gedrückte, militärisch aber nicht zu vernichtende Guerrilla blieb insoweit ein wichtiger und unverzichtbarer Akteur der Transition, als dass erstens der von ihr repräsentierte Raum auf der linken Seite des politischen Spektrums von keiner anderen Kraft ausgefüllt wurde, und zweitens der auf Esquipulas II zurückgehende Mechanismus der regionalen und internen Konfliktlösung ihr den Platz eines gleichberechtigten Partners am Verhandlungstisch zuwies. Ihre Schwäche im Inneren konnte sie durch den von außen erzeugten Druck weitgehend kompensieren. Im Zuge der Beilegung des letzten internen Konflikts im einst revolutionär gefährdeten Zentralamerika bewirkte das Ende des „realen Sozialismus“ paradoxerweise die relative Stärkung des linken Parts als Akteur des verhandelten Übergangs zu Frieden und mehr Demokratie in Guatemala.
Vierte Paradoxie
Die guatemaltekische Armee – in Sachen Aufstandsbekämpfung die erfahrenste, erfolgreichste und repressivste in Zentralamerika – ist zugleich modernste Kraft im herrschenden Block an der Macht und Hegemon des Transitionsprozesses. So wie die Konterrevolution von 1954 den Ausgangspunkt für die Unterwerfung der Gesellschaft unter die Allmacht des Staates bildete, begann mit dem Putsch von 1963 die Institution Armee, den Staat zu kontrollieren und zu beherrschen. Im Unterschied zu allen anderen vergleichbaren Armeen Zentralamerikas büßte die guatemaltekische Armee schon 1960 ihren national – reformerischen Flügel ein, der nach der gescheiterten Militärrevolte ins Exil gehen musste und sich dann größtenteils an der Formierung der Guerrilla beteiligte. Die ersten und bedeutendsten Führer der Guerrilla der 60er Jahre, Turcios Lima und Yon Sosa, waren zuvor Leutnants der Anti-Guerrilla-Einheiten. Ab 1970 entwickelte sich die Armeeführung auch in ökonomischer Hinsicht zur eigenständigen Fraktion, ohne jedoch der guatemaltekischen Oligarchie in diesem Sektor den Rang streitig machen zu können. Innerhalb des Blocks an der Macht bewahrte sie sich ein hohes Maß an Autonomie – in dieser Hinsicht in Zentralamerika nur mit ihren honduranischen Kollegen vergleichbar. Die umfassende Militarisierung von Staat und Gesellschaft verweist auf zweierlei: zum einen auf die Tiefe der Systemkrise und zum zweiten auf den Mangel an politischer Kompetenz außerhalb der Institution Armee, oft auch Resultat der gewaltsamen Ausschaltung alternativer Ansätze (Reformismus) durch Armee und Todesschwadronen. Gegenüber einer dezimierten, strangulierten und intellektuell verarmten politischen Klasse sowie einer intransigenten und bornierten Oligarchie erwies sich die Armee als einzige organisierte Kraft in der Lage, ein politisches Projekt vorzulegen und zu realisieren, das mittelfristig eine Modernisierung des Staates innerhalb der Systemgrenzen gestattete.
Fünfte Paradoxie
Die guatemaltekische Oligarchie ist die im zentralamerikanischen Vergleich mächtigste und zugleich die politisch am wenigsten moderne „upper class“. Ihre Stärke resultiert aus einem Mix verschiedener Faktoren: sie verfügt über die größten ökonomischen Ressourcen. Auf ökonomischem Gebiet hielt sie mit dem zentralamerikanischen Modernisierungsprozess Schritt und profitierte – wie auch El Salvador – am meisten vom MCCA (Gemeinsamer Mittelamerikanischer Markt). Ihr Antimodernismus auf politischen Gebiet wurzelt zum einen in ihren Traditionen (capitanía general) und ihrer Stärke (geringer Anpassungszwang, kein ernsthafter Widerpart im Inneren und zu wenig Druck von außen), zum anderen in den Herausforderungen und Risiken, denen sie sich im Falle einer ernsthaften politischen und ökonomischen Modernisierung gegenübersähe und vor denen sie deshalb zurückschreckt. Von der scheinbar sicheren Bank unangefochtener Prädominanz und im Vertrauen an die vorhaltende Wirkung politischer Gewalt glaubt sie, mit einem Minimum an Zugeständnissen über die Runden zu kommen. Ihre Rolle im Transitionsprozess beschränkt sich auf Machtsicherung und Wahrnehmung unmittelbarer Interessen (Privatisierung), die zu ihrer Selbstmarginalisierung im Friedensprozess geführt haben. Bei den großen Reform-Themen betätigt sich CACIF, der Unternehmerverband, als stereotyper Nein-Sager.
Sechste Paradoxie
Die guatemalekische Zivilgesellschaft, jenes bunte Gemisch aus NGOs, Dachverbänden und Basisorganisationen jenseits der traditionellen Parteienlandschaft, teilt in dramatischer Weise das Schicksal der gesamten guatemaltekischen Gesellschaft: sie ist schwach und fragmentiert. Dennoch besitzt sie vergleichsweise große Gestaltungsspielräume und einen – durch den Friedensprozess erzwungen – hohen Grad an Koordination und Kommunikation. Nach Jahren der Repression noch im Neubeginn begriffen, schlug ihre große Stunde bei der Abwehr des Autogolpe von Präsident Serrano Ende Mai/ Anfang Juni 1993. Nach der Wiederaufnahme der Friedens-“ Verhandlungen durch den neuen Präsidenten de León Carpio wurde auf dessen Vorschlag hin eine Asamblea de Sociedad Civil als beratendes und vorschlagsberechtigtes Organ der Zivilgesellschaft für die Verhandlungen ins Leben gerufen. Die neuen Aufgaben wirkten stimulierend und disziplinierend zugleich. Ihre Vorschläge auf der Basis des Konsens aller Sektoren der Asamblea fanden über die URNG-Delegation fast wortgetreu Eingang in den Verhandlungsprozess. Seitdem hat die Asamblea oft Mühe, den errungenen politischen Spielraum auch immer adäquat ausfüllen zu können.
Siebente Paradoxie
Von allen Ländern der Region zeichnet sich Guatemalas Verhältnis zu den USA durch die größte Ambivalenz aus. Von den Ländern im nordamerikanisch dominierten Zentralamerika ist Guatemala in den letzten Jahrzehnten am meisten auf Eigenständigkeit bedacht (ähnlich wie Panama) gewesen. Gleichzeitig besitzt es aufgrund seiner natürlichen Ressourcen, geographischen Lage und des traditionellen Einflusses der USA eine herausragende Bedeutung für Washington bei der Wahrung von Ordnung und Sicherheit im Hinterhof. Wie schwer die oft unsichtbare Hand der USA auf dem kleinen Land lastet und wie sensibel alle Akteure auf jeden Hinweis ihres Wirkens reagieren, zeigen die jüngst offengelegten Verwicklungen der CIA in Mordfälle (darunter auch an US-Bürgern), in die hohe Offiziere der guatemaltekischen Streitkräfte involviert sind. Auch wenn die Vereinigten Staaten bei weitem nicht jenen direkten Einfluss insbesondere auf die Streitkräfte ausüben können, wie er im Nachbarland El Salvador für jeden offenkundig war, so geschieht doch kaum etwas ohne Kenntnis der nordamerikanischen Botschaft. Inwiefern das komplexe Geschehen für die Nordamerikaner immer steuerbar ist, mag offen bleiben. Die Außenabhängigkeit des Landes lässt ihnen jedoch genug Möglichkeiten der langfristigen Einflussnahme, wie es gerade wieder die direkten Verhandlungen zwischen Regierung und Guerrilla zur Beilegung der bewaffneten Auseinandersetzungen belegen. Gegenwärtig scheint Washington seinen Einfluss nutzen zu wollen, um durch Druck auf die Armee den Friedensprozess voranzubringen.
Achte Paradoxie
Der als „proyecto militar“ konzipierte und folgerichtig der Hegemonie der Armeeführung unterworfene Transitionsprozess ist nicht nur in sich extrem widersprüchlich, sondern produziert auch ein politisches Regime, dessen beiden Gesichter – Demokratie und Contrainsurgencia – scheinbar überhaupt nicht zusammenpassen wollen. Mit dem Ziel der Aufstandsbekämpfung Demokratie einführen zu wollen, bedeutet von vornherein, dass diese nach Maßgabe der Architekten des Projekts formal, eng begrenzt und gefährdet ist.
Ausschluss nach links, Dominanz der Armee, der zentralen Achse des autoritären Regimes, und fortgesetzte Polarisierung sind ihre bestimmenden Kennzeichen. Verlauf (proyecto militar) wie Ergebnis (democracia contrainsurgente) werfen die Frage auf, wie diese Paradoxie – Demokratisierung im Dienste der Kriegsführung – aufgelöst und Demokratie vom Mittel der Aufstandsbekämpfung zum bestimmenden Ziel der Transition werden kann? Der Demokratisierungsprozess kann nur dann das würgende Korsett der Contrainsurgencia sprengen, wenn es eine Transition in der Transition, einen zweiten Regimewechsel gibt. Der Schlüssel dafür liegt bei den Akteuren. Gelingt es ihnen, aus dem negativen Gleichgewicht des Bürgerkriegs – keine Seite kann die andere militärisch besiegen – heraus einen beiderseitigen Lern- und Annährungsprozess einzuleiten, der im Zuge der Friedensverhandlungen zu einer neuen Demokratie führt? Eine Demokratie, die nicht nur mit dem Krieg Schluss macht, sondern in der Menschenrechte respektiert werden, die Linke nicht mehr ausgeschlossen ist, das Militär demokratisch kontrolliert wird und die Raum für Strukturreformen lässt.
Neunte Paradoxie
Der am wenigsten vorangeschrittene und auf den schwächsten Voraussetzungen aufbauende Transitionsprozess Zentralamerikas steht vor Aufgaben, die weit über das zentralamerikanische Normalmaß hinausreichen. Infolge des jahrzehntelangen Reformstaus fallen Transitionen auf vier verschiedenen Ebenen zeitlich und inhaltlich zusammen: 1. Klärung der Hegemoniefrage im Transitionsprozess (Alternative zur militärischen Hegemonie); 2. Übergang vom Krieg zum Frieden; 3. Beseitigung von Grundlagen des alten Autoritarismus durch Strukturreformen (Entmilitarisierung, Agrarreform) und 4. Vollendung des nation building (Lösung der national-ethnischen Frage). Bei den Friedensverhandlungen zwischen Regierung und Guerrilla geht es nicht allein um die politische Demokratisierung, sondern zugleich – wie von beiden Seiten im Themenkatalog anerkannt – um die brennende soziale Ungleichheit. Im Zentrum der Auseinandersetzungen steht die Frage, ob das ursprüngliche Konzept „Demokratie statt Strukturreformen“ bestätigt wird oder sich ein neues durchzusetzen vermag, das Demokratisierung mit Struktur- und Staatsreformen zu verbinden sucht. Obwohl Guatemala immer für jähe Wendungen gut ist, legt der bisherige Verlauf der Verhandlungen nahe, dass sich beide Seiten schon 1996 auf ein Friedensabkommen einigen könnten, in dem zumindest die notwendigsten Reformen festgeschrieben sind. Was sich für den zügigen Friedensabschluss paradoxerweise günstig auswirkt – die relative Schwäche beider Verhandlungspartner – kann sich bei der Realisierung als folgenschweres Defizit erweisen. Ungünstige Voraussetzungen, schwache Partner, Zeitdruck, hohe Erwartungen und Gleichzeitigkeit der Veränderungen scheinen für wirkliche Reformschritte wenig Hoffnung zu lassen. Andererseits wächst in Gestalt der indígena-Bewegung eine Kraft heran, die das altbekannte Gesellschaftsgefüge des Landes in Frage stellt. Nach fast 500 Jahre capitanía general und ladino-Republik, in denen die indígenas aus der Politik ausgeschlossen waren und sich nur immer wieder durch Aufstände Luft machen konnten, steht nun erstmals im Rahmen der Friedensverhandlungen die politische Partizipation der indianischen Bevölkerungsmehrheit auf demokratischer Grundlage auf der Tagesordnung. Wurde in der Oktoberrevolution das Problem noch in paternalistischer Weise mittels Ladinisierung zu lösen gesucht, treten die indígenas nunmehr aktiv und selbständig auf. Ein erster Meilenstein war das strategisches Bündnis mit der Guerrilla. Einmal zu politischem Selbstbewusstsein erwacht, kann diese Bewegung nun nicht mehr rückgängig gemacht werden. An ihr wird sich das künftige Schicksal der guatemaltekischen Demokratie entscheiden. Aus dem traditionellen Teil der guatemaltekischen Gesellschaft erwächst jetzt der stärkste Impuls zur Modernisierung des Landes. Die letzte Paradoxie?
__________________________
[1] Der auch im zentralamerikanischen Vergleich extreme soziale und ökonomische Polarisierungsgrad der guatemaltekischen Gesellschaft spiegelt sich besonders im Agrarsektor, nach wie vor zentrale Achse der Wirtschaft, wider. Typisch für Guatemala ist, dass Minifundien und Latifundien räumlich voneinander getrennt sind und sich der Klein- und Kleinstbesitz im indianisch besiedelten Altiplano konzentriert. Der Anteil der fincas bis 7 ha an der Gesamtzahl der Landwirtschaftsbetriebe ist mit fast 90% der höchste in Zentralamerika (noch höher als im dichtbesiedelten Nachbarland El Salvador) und kontrastiert extrem mit dem niedrigen Flächenanteil dieser Kategorie. Es verwundert deshalb nicht, dass bei der durchschnittlichen Größe der Kleinbetriebe Guatemala – mit El Salvador – am unteren Ende der zentralamerikanischen Skala zu finden ist. Andererseits liegt das durchschnittliche Einkommen der großen Grundeigentümer in Guatemala weit über dem aller anderen zentralamerikanischen Länder (Angaben in zentralamerikanischen Pesos): Guatemala = 40.000 El Salvador= 26.000 Costa Rica =20.000. Vgl. Baloyra, E.: Reactionary Despotism in Central America, in: Journal of Latin American Studies, 15 (1983) 2, S. 302-03.
[2] folgende Ausführungen basieren auf einem Interview des Verfassers mit dem guatemaltekischen Sozialwissenschaftler E. Gutierrez am 18.4.95
[3] Der Independencia ohne Unterstützung durch eine Volksbewegung fehlten sowohl Basis als auch Führung, um mehr als die Trennung vom revolutionär infizierten Mutterland zu bewirken. Mit der Flucht in die Unabhängigkeit wollte die kreolische Aristokratie vielmehr – das mexikanische Beispiel warnend vor Augen – dem Aufstand von unten zuvorkommen. Guatemalas Absetzbewegung in eine konservative Diktatur (1839-71) ließ auch die zentralamerikanische Föderation (1823-38) endgültig auseinanderbrechen. Damit scheiterte auch der Versuch, im Verbund der fünf Republiken die kolonial ererbten Strukturen zu ändern.
Ein zweiter Anlauf zur Modernisierung Guatemalas wurde dann unter Führung der Liberalen mit der sog. Reforma 1871 unternommen. Diese kann im zentralamerikanischen Kontext sowohl bezüglich des Erreichten wie des Nichterreichten als klassisch bezeichnet werden. Sie brachte dem Land mit dem Anschluss an den Weltmarkt Kapitalismus und Abhängigkeit zugleich. Wie siamesische Zwillinge verbanden sie sich zu einem deformierten Ganzen. Die „modernidad cafetalera“ (Mio Pinto) war in ihren Modernisierungseffekten ausgesprochen ambivalent: Mit der Agrarexportproduktion, bis heute Basis der guatemaltekischen Entwicklung, kamen Kapital und Technik ins Land. Die Bananenenklave bescherte dem Land seine ersten Lohnarbeiter nebst den dazugehörigen Gewerkschaften. Zugleich waren expandierender Großgrundbesitz, Schuldknechtschaft und Zwangsarbeit die Begleitmusik im Marsch zum Fortschritt. Die althergebrachten Verhältnisse wurden nicht beseitigt, sondern nur umgemodelt. Die Träger und Nutznießer der neuen Ära, die liberalen cafetaleros, hatten, wie die Entwicklung insgesamt, ein doppeltes Gesicht: eine Seite war vorwärtsgewandt und wies schon kapitalistische Züge auf, die andere schaute rückwärts und zeigte die Maske oligarchischer Erstarrung. Folgerichtig brachte dieser oligarchische Weg zum Kapitalismus dem Land eine 70jährige Diktatur und erst 1944 den Eintritt ins moderne 20. Jahrhundert.
[4] Unter Transition wird hier das Intervall zwischen zwei verschiedenen Regimes verstanden. In Guatemala war die entscheidende Zäsur der Putsch von Rios Montt von 1982, der den Weg für spätere Wahlen und den Antritt der ersten Zivilregierung ebnete. Vgl. auch Quetzal Nr. 3/93 S. 34 (Lexikon)
[5]G. Berganza in Crónica vom 15.4.94, S. 27
[6] Ex-Verteidigungsminister 1987-90, General Héctor Gramajo in einem Interview mit dem Verfasser vom 30.3.95
[7] G. Porras in Crónica vom 29. 7. 94
[8] Dies wurde von General Gramajo auf eine entsprechende Frage hin bejaht; vgl. Anm. 4.
[9] FAR – Fuerzas Armadas Rebeldes (Aufständische Streitkräfte): 1964 aus dem Zusammenschluss bewaffneter Gruppen von aufständischen Offizieren, Studenten und Anhängern der Kommunistischen Partei gegründete Guerrillaorganisation, die sich nach ihrer militärischen Niederlage Anfang der 70er Jahre in verschieden Organisationen aufspaltete (siehe URNG)
[10] URNG – Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Guatemaltekische Nationale Revolutionäre Einheit) -Zusammenschluss aus EGP (Guerrillaheer der Armen), FAR, ORPA (Organisation des Volkes in Waffen) und PGT; die drei erstgenannnten Organisationen gingen aus den historischen FAR hervor.