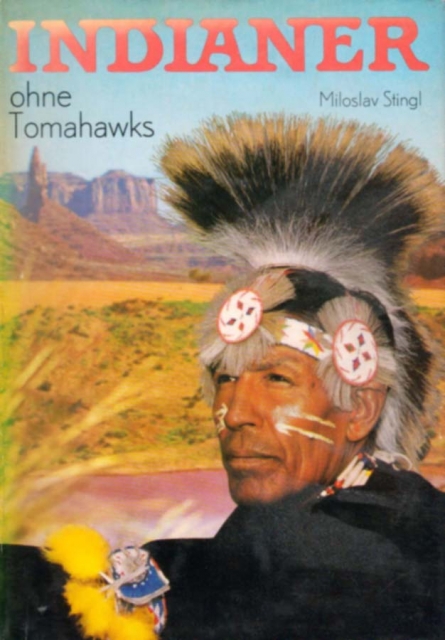Die Erforschung der Geschichte Perus bringt immer wieder Überraschungen hervor. Ganz langsam hebt sich der Nebel, der sich über eine mehr als 5000jährige Entwicklung gelegt hat. Und viele der Entdeckungen sind so bedeutsam, dass sie sich inzwischen auf der UNESCO Weltkulturerbeliste wiederfinden: die Heilige Stadt von Caral-Supe (4600 v. Chr.)[i], Chavín de Huantár (850 v. Chr.), die Linien von Nasca (800 v. Chr.), der astronomische Komplex von Chanquillo (300 v. Chr.), Chan Chan (1300 AD) – und natürlich die berühmten Inka-Stätten Cusco und Machu Picchu (15. Jh.).
Doch die Archäologie hängt den Grabräubern um Jahrhunderte hinterher. Selbst zu den Inkas gibt es mehr Fragen als Antworten. Zwar wird inzwischen in Choquequirao[ii] und im Cañón de Colca gegraben[iii], zwar werden DNA-Analysen und linguistische Studien durchgeführt[iv], zwar wird mit Hilfe eines 3D-Druckers das Gesicht einer Mumie des Opferrituals Capacocha rekonstruiert[v], doch es bleibt Stückwerk bei der immensen Größe des Untersuchungsgebiets. Vieles an der Geschichte der Inkas ist weiterhin unbekannt. Unzählige Inka-Ruinen sind noch nicht erforscht und geraten wohl in Vergessenheit, wenn sie von der Natur zurückerobert werden: So wie einst die Ruinen von Machu Picchu, und so wie nun die Reste von Muyu Muyu, Huánuca Pampa und Huaycaya im Distrikt Sayla.
Hiram Bingham ist falsch abgebogen
Der Ort Sayla liegt versteckt in den Anden. Die Distanzen nach Lima (800 Kilometer) und nach Arequipa (450 Kilometer) sind riesig. Doch es ist vor allem die Lage, die den Zugang so beschwerlich macht. Denn um dahin zu kommen, müssen zunächst die Pampas (Hochebenen) der schneebedeckten Vulkane Coropuna (6377 m), Solimana (6093 m) oder Sara Sara (5505 m) überwunden werden. Von etwa 4800 Meter Höhe geht es dann hinein in die tiefsten Canyons der Welt. Im Südosten ist es der Cañón de Cotahuasi, der vom Fluss bis zu den Berggipfeln offiziell einen Höhenunterschied von 3535 m aufweist, auf der nordwestlichen Seite ist es der inoffiziell genau so tiefe Cañón de Marán, der den Talkessel von Sayla begrenzt. Hinter dem Dorf, in seinem Rücken sozusagen, bildet wiederum die knapp 5000 Meter hohe Hochebene um den Cerro Anchacatta und den Puca Urqu die dritte Seite des Dreiecks, das schützend eine natürliche Barriere um Sayla errichtet. Die meisten Reisenden lassen Sayla also links liegen.
So war es auch bei Hiram Bingham. Als er im Jahr 1911, vom Cañón de Cotahuasi kommend, die Passhöhe erreichte, wandte er sich mit seinen beiden Maultiertreibern nicht nach links, hinauf zum Cerro Anchacatta und Puca Urqu, sondern folgte dem Pfad geradeaus nach Colta[vi]. Wäre er links abgebogen, dann hätte er vielleicht die Ruinen von Muyu Muyu bei Sayla entdeckt – und nicht Machu Picchu.
Doch das ist Spekulation. Denn die Bauern in Sayla waren sicherlich genauso misstrauisch und abweisend gegenüber Reisenden im Allgemeinen und reisenden Wissenschaftlern im Besonderen wie die in Lampa, wo Bingham nicht mal einen Unterschlupf fand. Er schrieb damals: „Wenn man in Peru nicht gerade mit einem leicht verständlichen Grund reist, wie z.B. der Erkundung von Minen oder in Repräsentation eines der großen Import- und Kommissionshäuser oder als Hausierer, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn man den natürlichen Verdacht der Leute weckt, für die die Reise auf einem Mula zur reinen Freude unvorstellbar ist, und eine wissenschaftliche Entdeckungstour um ihrer selbst willen ist für sie vollständig unverständlich.
Natürlich, wenn die Entdecker von einem Polizisten begleitet werden, dann ist es offensichtlich, dass das Unternehmen die Zustimmung und möglicherweise sogar die finanzielle Unterstützung der Regierung hat.“[vii] Aber Bingham hatte zu dem Zeitpunkt keinen Gendarmen als Begleiter. Wahrscheinlich hätte er also auch in Sayla schnell die Weiterreise antreten müssen, ohne einen Blick auf Muyu Muyu gelenkt zu haben. Ohnehin hätten ihn die lokalen Bauern auf den Ruinenkomplex erst einmal hinweisen müssen, wie sie es bei Machu Picchu taten, so dass er ihn überhaupt hätte „entdecken“, das heißt, für die westliche Welt erschließen können. Denn während die Landwirte der Region um diese Ruinen über die ganzen Jahrhunderte hinweg wussten, tappte der „Entdecker“ praktisch im Dunkeln.
114 Jahre später schlug ich jedenfalls auf der Passhöhe, vom Cañón de Cotahuasi kommend, den Weg nach links ein. Von 4900 Meter über NN ging es wieder hinab auf 3500 Meter. Und da lag und liegt Sayla und etwas weiter der anexo (Weiler) Yanaya. Die paar Hütten und die verfallende Kirche haben ihr Aussehen seit Binghams Zeiten kaum geändert, wohl aber die Landschaft. Denn wo es früher tausende bestellte Terrassenfelder gab, wuchern heute Unkräuter und Büsche. Laut Zensus von 2017 leben noch 314 Menschen in diesem riesigen Seitental des Cañón de Marán, wahrscheinlich inzwischen sogar weniger. Die gesamte quebrada (Schlucht) ist verlassen. Schaut man sich die erkennbaren Strukturen an, dann müssen hier zu Inka-Zeiten, d.h. im 15./16. Jh., noch etwa 8.000 bis 10.000 Menschen gelebt haben. Das Tal war also sehr bedeutend. Als Bingham durch die Berge streifte, muss es jedoch bereits in der Bedeutungslosigkeit versunken sein. Anders ist es nicht zu erklären, dass er strikt den Weg geradeaus wählte – und nicht nach links abbog.
Hätte er jedoch die Landwirte der Region gefragt, wie ich es 114 Jahre später tat, dann hätte er eine ganze Hand voll an Ruinen entdecken können. Die Bauern der Region kennen sie alle: Muyu Muyu, Lawachi, Tauria, Huánuca Pampa, Huaycaya, Piclla, Sayla, den Qhapac Ñan (Inka-Pfad) von Saina (Sayana Pampa) nach Quepac am Marán-Fluss und dort dann die Inka-Ruinen von Tiwanay. Sie sind „unentdeckt“ geblieben genauso wie viele der Tunnel, Wasserleitungen und Höhlen der Vorfahren. Bis heute schlafen sie ihren Dornröschenschlaf. Es gibt darüber keine Publikationen in archäologischen Fachzeitschriften, keine Konferenzen oder wissenschaftliche Untersuchungen. Nur die verbliebenen Landwirte und ihre Tiere wissen und kümmern sich um sie.
Der Komplex von Muyu Muyu im Distrikt Sayla
Als ich einen Bauern fragte, wo denn die Ruinen von Mayu Mayu seien, schaute er mich mit fragendem Gesicht an. Das Internet hatte mir Mayu Mayu genannt, da besteht kein Zweifel. Nur sprach der junge Heimatforscher auf YouTube kein Quechua und kannte sich scheinbar wenig in seiner Heimat aus, als dass er den Namen richtig hätte benennen können. Statt einer Antwort gab es bei dem Bauern also zunächst nur Fragezeichen. Doch ein paar Lautverschiebungen brachten die Erleuchtung: „Meinst Du Muyu Muyu? Das ist oben auf dem Berg. Da, wo die Straße nach Tauria einen Bogen beschreibt, kurz vor dem gesprengten Tor, da geht links ein Pfad den Berg hoch. Da ist es.“ „Wie ist es da? Warst Du dort?“, wage ich zu fragen. „Wegen der paar Ruinen gehe ich doch nicht den Berg rauf“, lautete die Antwort. „Ich war da noch nie. Aber ich weiß, dass da manchmal ein paar Bauern ihr Vieh hochtreiben.“
Die Antwort war authentisch. An ihr erkennt man noch immer die Denkweise der Bergbauern wie zu Binghams Zeiten. Warum sollte jemand ohne ersichtlichen Grund den Berg hinauf zu den Ruinen wandern? Es gibt schließlich genug zu tun mit dem Vieh und den Feldern und den Hütten. Und in Muyu Muyu sind nur Ruinen zu sehen. Deshalb „entdecken“ diese Ruinen auch nie einheimische Bauern, sondern immer fern zugereiste Wissenschaftler.
Muyu Muyu ist Quechua und heißt so viel wie „Herum herum“ oder „Kreis Kreis“. Wahrscheinlich bezieht es sich entweder auf den Zugang zu der Festung, die früher nur auf einem Weg um den Berg herum zugänglich war. Oder es war ein Komplex aus Kreisen. Interessanterweise gibt es (wenigstens) zwei weitere bekannte Ruinenkomplexe mit dem gleichen Namen Muyu Muyu: einen im Distrikt Uranmarca (Department Apurímac), der dem Volk der Chanca zugerechnet wird, und einem am Vulkan Solimana im Distrikt Chichas (Department Arequipa). Die Ruinen von Muyu Muyu im Distrikt Sayla finden sich unter diesen Koordinaten: 15°20’22″S 73°13’31″W.
Der Komplex enthält sehr viele Ruinen von einst runden (sic!) Häusern, die allesamt mit Gestrüpp überwuchert sind. Sie finden sich ausschließlich auf der westlichen Seite. Am östlichen Abhang dagegen ziehen sich endlos Terrassenfelder hin. Ohne technische Hilfsmittel lässt sich nicht ermitteln, ob es 50 oder 80 Gebäude oder sogar mehr waren. Die Anlage besteht aus mehreren Sektoren. Vermutlich Wachhäuser standen direkt am Pfad, eher am Hang finden sich dann Wohngebäude und Speicher. Oben wurde der Berg zu zwei Plattformen („Kreisen“?) begradigt, so dass möglicherweise heilige Rituale auf diesen Plätzen abgehalten wurden. Auf der obersten Plattform reckt sich schließlich ein Inti Watana gen Himmel, ein Stein, an den die Inkas die Sonne anbinden konnten. Er ist zu den heiligen Apus, den Berggottheiten, der Region ausgerichtet. Gegenüber, auf der anderen Seite des Cañón de Marán, ist es der weibliche Schutzgeist des schneebedeckten Vulkans Sara Sara. Im Rücken wacht hingegen der männliche Apu des Llomachocca über den Komplex.
Von diesem ersten Teil der Anlage durch eine kleine Schlucht abgegrenzt, gibt es oberhalb noch einen zweiten Sektor. Auch der ist komplett überwuchert. Hier scheinen jedoch die Inkas eine noch viel größere Fläche begradigt zu haben. Zu welchem Zweck ist nicht ersichtlich. Auf seiner westlichen Seite finden sich zwei Monolithen, in die geometrische Reliefs (und Landschaften?) eingeschlagen sind. Noch weiter oben gibt es einen dritten Sektor. Wieder ist das Gelände eingeebnet. Deutlich sind Ruinen erkennbar. Möglicherweise geht die Anlage auf dem nun schmalen Bergkamm noch weiter. Aber nun dominieren auf beiden Berghängen tausende von Terrassenfeldern. Sie sind nun größtenteils überwuchert und werden nicht mehr genutzt. Die Menge an Lebensmitteln, die hier einst erzeugt werden konnte, überstieg sicherlich die Zahl der Bewohner bei weitem. Sehr wahrscheinlich wurde ein großer Teil an den Sitz der Inka-Herrscher in Cusco geliefert.
Vielleicht hätte Bingham, wäre er damals nach links abgebogen, doch ein zweites Machu Picchu oder ein ebenso bedeutendes Muyu Muyu entdeckt. Dann würden heute wahrscheinlich Millionen von Touristen in das abgeschirmte Dreieck zwischen zwei der tiefsten Canyons weltweit pilgern statt ins Urubambatal.
Die Ruinen von Lawachi
Die Region hat aber noch mehr zu bieten als die Inka-Ruinen von Muyu Muyu. Nicht weit von Tauria haben wohl die Vorgänger der Inkas, vielleicht die Chancas, vielleicht ein anderes Volk, ihre Spuren hinterlassen. Im Komplex Lawachi (15.36644° S, 73.22473° W) stehen hunderte von Ruinen. Die Mehrheit der Häuser ist rund, ein paar wenige auch rechteckig. Zwischen den Häusern verlaufen enge, verwinkelte Gassen. Im Gegensatz zu Muyu Muyu ist der Komplex jedoch nicht auf einem Bergrücken angelegt. Auch finden sich der zentrale Platz und die wichtigsten Gebäude nicht auf einem Sporn oder auf der Hügelspitze, sondern in der „Dorf“-Mitte.
Aus strategischer Sicht betrachtet ähnelte diese Ansammlung von Häusern und Speichern eher einer altertümlichen agrarischen Struktur, während die Inkas eindeutig auch militärische Überlegungen in die Standortwahl von Muyu Muyu fließen ließen. Zu frisch waren sicherlich die Erinnerungen an den Krieg mit den Chancas, die plötzlich 1424 (oder 1438, da streiten sich die Historiker, auch weil die Chronisten unterschiedliche Versionen erzählen) vor den Toren der Hauptstadt in Cusco standen. 1440 hatten die Inkas dann allerdings die Entscheidungsschlacht bei Ichupampa, etwa 180 km Luftlinie von Lawachi entfernt, gewonnen.
Dass dann die Inkas den Flecken Lawachi in Ruinen verwandelten, darf bezweifelt werden. In der Regel wurde die Vorherrschaft der Inka durch die unterworfenen Völker anerkannt. Und die Inka verschonten die Infrastruktur und Bevölkerung, die nun dennoch für den Inka arbeitete. In dem Zusammenhang wurden sicherlich viele Gebäude in Lawachi als Speicher für die reichhaltigen Ernteprodukte genutzt, zumal es auch rund um diesen Komplex unzählige Terrassenfelder gibt. Scheinbar sind diese Terrassen jedoch wesentlich älter als die in Muyu Muyu, denn sie sind am Berghang oft nur noch schwer zu erkennen. Die Ruinen sind wahrscheinlich 800 Jahre alt. Nachdem das Wari-Reich zusammengebrochen war, etablierten sich möglicherweise die Chancas in der Epoche der Regionalen Staaten und Stammesorganisationen, wie es in der Geschichtsforschung heißt, als neue regionale Macht. Ganz klar ist das nicht, denn das Chanca-Reich erstreckte sich über die heutigen Departments Ayacucho, Apurímac und Huancavelica. Vielleicht bildete Lawachi einen Außenposten oder eine Außengrenze. Vielleicht siedelten hier auch (unbekannte) Stämme aus der Küstengegend.
Unbekannte Geschichte
Vieles in der Region ist schlicht unbekannt. Die wenigen verbliebenen Landwirte, deren Wissen über Generationen hinweg mündlich weitergetragen wurde, nehmen die letzten Geheimnisse mit ins Grab. Die jungen Menschen sind aus dem Talkessel schon lange verschwunden, suchen ihr Glück in Cotahuasi, Pausa oder Arequipa, viele in den Goldminen. Weder ausländische Touristen noch sonstige Fremde – und noch weniger Wissenschaftler – verirren sich in diesen versteckten Winkel. Und der peruanische Staat hat schlicht kein Geld (und kein Interesse), mit großem finanziellen Aufwand archäologische Studien in der Region durchzuführen, um Licht in die Dunkelheit der Geschichte zu bringen.
Deswegen stehen die Ruinen einfach da: Es gibt keinen Wachdienst, keinen Zaun, nicht mal ein Hinweisschild. Die verbliebenen alten Bauern halten die Überreste vom Unkraut und Gestrüpp frei, indem sie ihr Vieh in die Komplexe treiben, das dann im Gegenzug müffelnde Ausscheidungen dalässt. Muyu Muyu und Lawachi werden daher wohl weiter links liegen bleiben, mit der Zeit von der Natur zurückerobert und irgendwann reisende Forscher zu einem „Heureka“ hinreißen, wenn sie dann „entdeckt“ werden.
[i] Schaller, Sven (2013): Explosive Stimmung in Caral, in: Quetzal. Politik und Kultur in Lateinamerika, www.quetzal-leipzig.de/lateinamerika/peru/peru-archaeologie-caral-bergbau-ruth-shady
[ii] Schaller, Sven (2011): Der choque der Zivilisationen in Choquequirao, in: Quetzal. Politik und Kultur in Lateinamerika, www.quetzal-leipzig.de/lateinamerika/peru/der-choque-der-zivilisationen-in-choquequirao
[iii] Denevan, William M (1987): Terrace abandonment in the Colca Valley, Peru, in: ders. et al. (Hrsg.) (1987): Pre-hispanic agricultural fields, Oxford; Doutriaux, Miriam Agnes (2004): Imperial conquest in a multiethic setting. The Inka occupation of the Colca-Valley, Peru, PhD-Dissertation, University of Berkeley, California
[iv] Heggarty, Paul (2015): La riqueza idiomática de los Andes, in: Investigacion y Ciencia (Januar), S. 36-41; Pearce, Adrian J.; Beresford-Jones, David G.; Heggarty, Paul (Hrsg.) (2020): Rethinking the Andes-Amazonia Divide. A cross-disciplinary exploration, UCL Press, London
[v] Blakemore, Erin (2023): Menschenopfer der Inka. Die Jungfrau aus dem Eis bekommt ein Gesicht, in: National Geographic, www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2023/11/menschenopfer-der-inka-die-jungfrau-aus-dem-eis-bekommt-ein-gesicht/
[vi] Bingham, Hiram (1922): Inca Land. Explorations in the Highlands of Peru, S. 65-66
[vii] Ebd., S. 67 (Übers. ssc.)