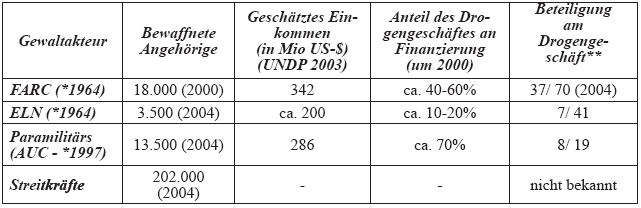Lateinamerika galt während des 20. Jahrhunderts als ein Kontinent, in dem Staatstreiche und Militärdiktaturen die Regel waren. Die Ursachen dafür liegen in der Geschichte des Kontinents begründet und sind struktureller Natur. Als Spanisch-Amerika (mit Ausnahme der karibischen Kolonien) im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts seine Unabhängigkeit erkämpft hatte, sahen sich die neuen Staaten nicht nur gewaltigen Herausforderungen gegenüber, sondern trugen auch schwer am Erbe der Kolonialzeit. Im Kampf gegen Spanien erwies sich die Armee als entscheidende Institution der nationalen Staatsbildung. Zugleich ließ die neue kreolische Elite die sozioökonomischen Strukturen der Kolonialzeit weitgehend unangetastet. Das Ausbleiben einer sozialen Revolution und die zahlreichen Bürgerkriege stärkten nicht nur die Rolle der militärischen Anführer (Caudillos), sondern zementierten zugleich die Kluft zwischen der herrschenden Oligarchie und der marginalisierten Masse der Bevölkerung. Der kolonial ererbte Rassismus ließ sich zwar einerseits im Sinne der Herrschaftssicherung nutzen, blockierte aber andererseits die Herausbildung einer Nation. Im Rahmen der Pax Britannica und vorangetrieben durch die industrielle Revolution intensivierte sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Einbindung Lateinamerikas in den Weltmarkt. Seine Länder dienten Europa und später auch den USA als Lieferant von Rohstoffen und Agrarerzeugnissen wie auch als Anlagesphäre zur Erschließung neuer Märkte.
Traditionelle Funktionen der Armee
Die 1929 ausgebrochene Weltwirtschaftskrise erschütterte die bestehende Ordnung bis in die Grundfesten und beendete das „goldene Zeitalter“ der weltmarktabhängigen Oligarchie (1870-1930). In dieser Ära wurde die Armee als Herrschaftsinstrument vor allem auf drei Feldern eingesetzt:
Erstens in zwischenstaatlichen Konflikten und Kriegen: Größere Kriege zwischen lateinamerikanischen Ländern waren vergleichsweise selten. Der Krieg der Triple-Allianz (Brasilien, Argentinien, Uruguay) gegen Paraguay (1864-1870) endete mit einer bitteren Niederlage des südamerikanischen Binnenstaates, der nicht nur seinen Wohlstand und die Hälfte seines Territoriums, sondern auch 80 Prozent seiner männlichen Bevölkerung einbüßte. Im Pazifikkrieg (1879-1884), den Chile gegen Bolivien und Peru führte und gewann, ging es vor allem um die Kontrolle über die Salpeter-Lagerstätten in der Atacamawüste. Während Chile sein Territorium im Norden vergrößern konnte, musste Bolivien auf seinen Zugang zum Pazifik verzichten. Im Chacokrieg (1932-1935) zwischen Bolivien und Paraguay kämpften die Kontrahenten um ein Gebiet, in dem Erdöl vermutet wurde. Nach harten und verlustreichen Kämpfen musste sich Bolivien erneut geschlagen geben und Territorium an seinen Nachbar abtreten. Der erste große Krieg zwischen einem lateinamerikanischen Land und den USA (1846-1848) kostete Mexiko die Hälfte seines Territoriums. Im Zentralamerika kam es nach dem Zerfall der Föderation 1838 kam es unter den fünf Nachfolgestaaten immer wieder zu militärischen Konflikten. Der Krieg in Nicaragua, den die übrigen zentralamerikanischen Republiken 1855-1857 gegen den US-amerikanischen Abenteurer William Walker führten, hatte den Charakter eines nationalen Befreiungskrieges. Abgesehen vom Chacokrieg gab es im 20. Jahrhundert in Lateinamerika keine größeren Kriege.
Zweitens bei der Eroberung von Siedlungs- und Rückzugsgebieten indigener Völker: In Mexiko kam es nach der Unabhängigkeit langwierigen Kriegen gegen die Maya-Bevölkerung Yucatáns (Guerra de Castas) und das indigene Volk der Yaqui im Bundestaat Sonora. In beiden Fällen mussten sich die indigene Bevölkerung nach opferreichen Kämpfen der Gewalt des Staates beugen. Die frontera in Chile und Argentinien bildete den zweiten Kriegsschauplatz im Kampf gegen die indigenen Völker Lateinamerikas. Chile, dass die Unabhängigkeit der Mapuche 1825 zunächst bestätigt hatte, gliederte 1861 das von ihnen bewohnte Gebiet gewaltsam an. In Argentinien fand erste „Kampagne“ gegen die indigenen Völker der Pamparegion in den 1830ern statt. Besonders gewaltsam verlief die Conquista del Desierto (1878-1880), mit der Julio A. Roca die Unterwerfung der indigenen Völker im Süden vollendete. Beide Kriegszüge dienten der Ausweitung des Großgrundbesitzes der herrschenden Oligarchie. Im Gran Chaco, wo vor allem die Völker der Guaycurú und Apiones anhaltenden Widerstand leisteten, fand die Eroberung indigener Gebiete in den 1880er Jahren auch im Norden weitgehend ihren Abschluss. In Brasilien bildete sich die Siedlungsgrenze im eigentlichen Sinn des Wortes erst spät heraus. Lange Zeit wurde ihr Verlauf durch die Zuckerrohrplantagen- und Bergbaugebiete bestimmt. Erst mit dem Kaffeeanbau im 19. Jahrhundert entstand so etwas wie eine fronteira, in deren Folge es zum organisierten Vorgehen gegen die lokalen indigenen Völker kam, denen bis 1910 nicht einmal der „Schutz“ durch Reservate gewährt wurde.
Drittens zur Unterdrückung und Disziplinierung der marginalisierten Bevölkerung: In allen Ländern Lateinamerikas hatte die Armee die Aufgabe, die bestehende Ordnung nach innen zu sichern. Immer wenn Arme, Bauern und Arbeiter gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Elend aufbegehrten, wurden neben der Polizei und anderen Sicherheitskräften meist auch die Streitkräfte eingesetzt. Bis zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise waren die ländlichen Gebiete Zentren der Auseinandersetzungen zwischen den staatlichen Repressivorganen und der Bevölkerung. In Brasilien erlangte der Aufstand der Jaguncos (1896-1897), auch bekannt als „Krieg von Canudos“, literarischen Rang. Ab 1893 war im Sertão, einer kargen Region im Nordosten Brasiliens, im Dorf Canudos eine religiösen Sozialbewegung entstanden, die sich eine eigene wirtschaftliche Basis aufgebaut hatte und dem Staat Zölle und Steuerabgaben verweigerte. Viermal versuchte die Armee, das Dorf, dessen Einwohnerschaft inzwischen auf 25.000 angewachsen war, zu erobern. Als dies am 5. Oktober 1897 schließlich geschah, fiel die gesamte Bevölkerung dem anschließenden Gemetzel zu Opfer. Ebenfalls in Brasilien, in den südlichen Gebieten Santa Catarina und Paraná, entwickelte sich 1912-1916 aus dem Kampf um Land ein Guerillakrieg (Guerra do Contestado), dem sich auch entlassene Eisenbahnarbeiter anschlossen. Mit äußerster Brutalität, die 20.000 Menschen das Leben kostete, gelang es der Armee schließlich, den Aufstand niederzuschlagen. Zu ähnlichen Rebellionen kam es in Argentinien. Der Aufstand kleiner und mittlerer Pächter gegen die Großagrarier der Pampa (Grito de Alcorta 1912) und die Landarbeiteraufstände in Patagonien von 1921 sollen an dieser Stelle als Beispiele genügen. Zwischen 1928 und 1930 wurde auch Bolivien von einer Welle großer Bauernaufstände erschüttert.
Neue Aufgaben für die Armee
Im Ergebnis des Zusammenbruchs der traditionellen Agrarexportwirtschaft kristallisierten sich im Zusammenspiel von Oligarchie, Armee und USA neue Reaktionsmuster heraus. Dabei lassen sich drei Ländergruppen unterscheiden. Die ökonomisch starken Länder Argentinien, Brasilien und Mexiko hatten bereits nach dem Ersten Weltkrieg erste Versuche unternommen, ihre Wirtschaft stärker zu diversifizieren. Unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise mündete dies in den 1930er Jahren in der Entwicklungsstrategie der Importsubstituierenden Industrialisierung (ISI). Auf dieser Grundlage entwickelte sich in Gestalt des Populismus eine neue Form der Machtausübung. Die politische Mobilisierung der nun entstehenden Arbeiterklasse wurde durch eine staatliche Sozialpolitik abgesichert. Die Massenmobilisierung diente als Druckmittel gegen die traditionelle Oligarchie sowie als Massenbasis des neuen Entwicklungsmodells. Führungsfiguren des lateinamerikanischen Populismus waren Getulio Vargas in Brasilien, Juan Perón in Argentinien und Lázaro Cárdenas in Mexiko. Vargas, der selbst kein Militär war, aber durch einen Putsch der Armee 1930 das Präsidentenamt übernehmen konnte, errichtete später den Estado Novo (1937-1945). 1950 wurde er erneut zum Präsidenten gewählt. 1954 nahm er sich wegen eines politischen Skandals das Leben. Péron, der eine militärische Laufbahn eingeschlagen hatte, war bereits 1930 und 1943 führend an der Durchführung von Putschen beteiligt. 1946-1955 stand er als Präsident an der Spitze Argentiniens. Auch Cárdenas, der Mexiko 1934-1940 regierte, war ein hoher Militär. In seiner Amtszeit radikalisierte sich der Reformkurs, der seinen Ursprung in der mexikanischen Revolution von 1910-1920 hatte. Unter Cárdenas wurde die Agrarreform endlich landesweit vorangetrieben. 1938 nationalisierte er die Erdölindustrie, die sich bis dahin in britischem und US-amerikanischem Besitz befunden hatte.
Ein zweites Muster zeigte sich im Andenraum, wo die Armee zwar mehrfach politisch intervenierte, aber keine Stabilisierung erreichen konnte. In Ecuador lösten sich zwischen 1925 und 1948 nicht weniger als 27 Regierungen ab. Auch Peru erlebte ab 1930 eine Phase politischer Machtkämpfe, in denen das Militär eine entscheidende Rolle spielte. In Bolivien stürzte der verlorene Chacokrieg (1932-1935) das Land in eine tiefe Krise, die nach verschiedenen Militärregierungen in die Revolution von 1952 einmündete. 1941 brach zwischen Peru und Ecuador ebenfalls ein Grenzkrieg aus, in dessen Ergebnis Ecuador fast 40 Prozent seines Territoriums abtreten musste. In Chile kam es 1931 nach einem Putsch linker Militärs kurzzeitig zur Ausrufung einer „Sozialistischen Republik“. Nach immer neuen Koalitionsregierungen, denen nur eine kurze Lebensdauer beschieden war, übernahmen 1938-1946 Regierungen die Amtsgeschäfte, die sich auf eine Volksfront stützen konnten, welche hauptsächlich auf Initiative der Kommunistischen Partei zustande gekommen war. Venezuela konnte sich dank seines Erdölbooms über die Weltwirtschaftskrise retten und blieb trotz des Todes von Juan Vicente Gómez 1935, der das Land seit 1908 diktatorische regiert hatte, relativ stabil. In Kolumbien, dass durch die politische Rivalität zwischen Konservativen und Liberalen geprägt war, kamen letztere im Gefolge der Weltwirtschaftskrise an die Regierung. Der Versuch der Liberalen, Reformen durchzusetzen, die auf eine ISI zielten, mündete 1948 in einen blutigen Bürgerkrieg.
In den kleinen Ländern Zentralamerikas, die vom Weltmarkt und von den USA weitaus stärker abhängig waren als die Länder Südamerikas, setzte sich ein drittes Muster durch. Hier – wie auch in Kuba und der Dominikanischen Republik – fiel der Armee eine neue Aufgabe zu: Sie sollte zur Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung im Sinne einer Arbeitsteilung mit der diskreditierten und angeschlagenen Oligarchie die Regierungsverantwortung für längere Zeit selbst übernehmen. Unter Führung militärischer Caudillos wurden personalistischer Diktaturen errichtet, wobei sich die eigentlich herrschenden Kräfte (Oligarchie und USA) im Hintergrund hielten. Beispiele sind die Ubico-Diktatur (1931-1944) in Guatemala, die Diktatur von Hernández Martínez (1932-1944) in El Salvador, die Somoza-Diktatur (1934-1979) in Nicaragua, die Carías-Diktatur (1933-1949), in Honduras, die Trujillo-Diktatur (1930-1961) in der Dominikanischen Republik und – in modifizierter Form – die Batista-Diktatur (1940-1944; 1952-1959) auf Kuba.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Beginn des Kalten Krieges begann in Lateinamerika eine neue Etappe. Welche Konsequenzen dies für die Institution Armee hatte, soll im nächsten Abschnitt beleuchtet werden.
Kalter Krieg und kubanische Revolution
Die Systemauseinandersetzung zwischen USA und Sowjetunion, die zu einer bipolaren Weltordnung führte und in Form eines globalen Kalten Krieges (1947-1989) ausgetragen wurde, schloss Lateinamerika auf spezifische Weise ein. Der Platz, den die einzelnen Weltregionen in der Grand Strategy Washingtons einnahmen, war geopolitisch klar definiert. In Europa und Asien stießen die beiden Blöcke direkt aufeinander. Da die beiden Führungsmächte über Nuklearwaffen verfügten, mit denen sie sich gegenseitig und damit auch die Menschheit vernichten konnten, mussten die Auseinandersetzungen unterhalb der Schwelle eines Atomkrieges ausgetragen werden. In Europa führte dies zur Teilung des Kontinents, ohne dass es zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen beiden Blöcken kam. Asien hingegen erlebte während des Kalten Krieges zwei „heiße“ Kriege, in die die USA direkt involviert waren: Den Koreakrieg (1950-1953) und den zweiten Indochina-Krieg (1964-1975). Der Nahe Osten bildete die Südflanke des US-amerikanischen Containment-Gürtels. An der Nahtstelle dreier Kontinente (Europa, Asien und Afrika) gelegen, war er von enormer geopolitischer Bedeutung. Hinzu kam sein zentraler geoökonomischer Stellenwert aufgrund seiner Erdöl- und Erdgasressourcen. Afrika wurde im Zuge der Dekolonialisierung zum Schauplatz von Stellvertreterkonflikten, hinter denen die USA bzw. die Sowjetunion standen.
Lateinamerika hatte wegen seiner geographischen Lage keine direkte Funktion im Rahmen der US-amerikanischen Containment-Strategie. Es liegt in der westlichen Hemisphäre und ist von der eurasischen „Weltinsel“ durch zwei Ozeane getrennt. Aus Sicht der USA bildeten die Länder südlich der eigenen Grenze einen exklusiven „Hinterhof“, den es stabil und ruhig zu halten galt. Versuche einer unabhängigen Entwicklung ließen sich scheinbar problemlos blockieren bzw. kanalisieren.
Dass dem nicht so war, zeigt der Fall Guatemala. Nach dem Sturz der Diktatur von Jorge Ubico und seines Nachfolgers Juan Ponce im Oktober 1944, bei dem progressive Militärs unter Führung von Jacobo Arbenz eine zentrale Rolle spielten, begann ein Reformprozess, der das kleine zentralamerikanische Land durch die Schaffung moderner kapitalistischer Verhältnisse von den USA unabhängig machen sollte. Als Arbenz, der 1951 das Präsidentenamt übernommen hatte, mit diesem Vorhaben Ernst machte und 1952 eine konsequente Agrarreform begann, die auch das Eigentum des US-amerikanischen Bananenkonzern UFCO betraf, sah Washington rot. Unter dem Vorwand, eine drohende „kommunistischen Gefahr“ abwenden zu müssen, wurde Arbenz im Juni 1954 durch eine CIA-gesteuerte Söldnerinvasion und den Verrat der Armeeführung gestürzt. Das Signal an die Länder Lateinamerikas war klar: Selbst der Versuch pro-kapitalistischer Reformen wurde von den USA hart geahndet, wenn er ihren Interessen zuwider lief. Der Vorwurf einer „kommunistischen Einmischung“ lieferte dafür den propagandistischen Vorwand.
 Der Sieg der Konterrevolution 1954 in Guatemala hatte zwei gravierende Folgen: Für das Land selbst läutete er den Beginn blutiger Unterdrückung ein, die 1960 in einen Bürgerkrieg mündete, der erst 1996 beendet werden konnte. Die Armee entwickelte sich dabei zum Architekten eines konterrevolutionären Staates, dessen Terror mehr als 300.000 Menschen das Leben kostete. Die zweite Folge war indirekter Natur. Ernesto Che Guevara, der die Reformpolitik von Arbenz und die Invasion von 1954 selbst erlebt hatte, zog aus der Niederlage der guatemaltekischen Revolution Lehren, die die kommende Revolution in Kuba maßgeblich prägen sollten. Zum einen musste sie sich militärisch verteidigen können. Dazu waren eine Volksbewaffnung und die Schaffung einer neuen, revolutionären Armee notwendig. Zum anderen bedurfte es einer Agrarreform, die darauf zielte, der Oligarchie und den US-Unternehmen die ökonomische Machtbasis zu entziehen. Dazu wiederum bedurfte es einer breiten Massenbewegung, die bereit und fähig war, die revolutionären Errungenschaften zu verteidigen.
Der Sieg der Konterrevolution 1954 in Guatemala hatte zwei gravierende Folgen: Für das Land selbst läutete er den Beginn blutiger Unterdrückung ein, die 1960 in einen Bürgerkrieg mündete, der erst 1996 beendet werden konnte. Die Armee entwickelte sich dabei zum Architekten eines konterrevolutionären Staates, dessen Terror mehr als 300.000 Menschen das Leben kostete. Die zweite Folge war indirekter Natur. Ernesto Che Guevara, der die Reformpolitik von Arbenz und die Invasion von 1954 selbst erlebt hatte, zog aus der Niederlage der guatemaltekischen Revolution Lehren, die die kommende Revolution in Kuba maßgeblich prägen sollten. Zum einen musste sie sich militärisch verteidigen können. Dazu waren eine Volksbewaffnung und die Schaffung einer neuen, revolutionären Armee notwendig. Zum anderen bedurfte es einer Agrarreform, die darauf zielte, der Oligarchie und den US-Unternehmen die ökonomische Machtbasis zu entziehen. Dazu wiederum bedurfte es einer breiten Massenbewegung, die bereit und fähig war, die revolutionären Errungenschaften zu verteidigen.
Der Sieg der kubanischen Revolutionäre unter Führung von Fidel Castro und Ernesto Che Guevara 1959 hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Strategie Washingtons und den Charakter des Kalten Krieges in Lateinamerika. Das zentrale Ziel der USA bestand zunächst darin, die kubanische Revolution zu Fall zu bringen. Bei der Planung einer Söldnerinvasion, die im April 1961 erfolgte, bildete Guatemala 1954 die Blaupause. Ihr Scheitern bewies, dass die kubanischen Revolutionäre die richtigen Lehren gezogen hatten. In Reaktion auf die Attacken Washingtons hatte Fidel Castro am 16. April 1961, einen Tag vor der Invasion in der Schweinebucht, den sozialistischen Charakter der Revolution proklamiert. Die Auseinandersetzungen zwischen Revolution und Konterrevolution gipfelten im Oktober 1962 in der sogenannten Raketenkrise, die die Gefahr eines Atomkrieges heraufbeschwor. Vor dem Abzug der sowjetischen Raketen aus Kuba hatte sich US-Präsident John F. Kennedy mit dem sowjetischen Generalsekretär Nikita Chruschtschow darauf geeinigt, dass die USA Kuba militärisch nicht angreifen würden.
Diktaturen neuen Typs
Parallel zur Isolierung Kubas verfolgte Washington das Ziel, ein „zweites Kuba“ zu verhindern. Die entscheidende Probe aufs Exempel lieferte Washington mit seiner Invasion 1965 in der Dominikanischen Republik. Nachdem die von John F. Kennedy 1961 initiierte „Allianz für den Fortschritt“ nach dessen Ermordung 1963 auf Eis gelegt worden war, entwickelten die USA die „Doktrin der Nationalen Sicherheit“. Mit ihr begründeten die lateinamerikanischen Militärs ihren Anspruch auf eine zentrale Rolle in Staat und Gesellschaft. Legitimiert wurde dies mit dem Konstrukt eines „inneren Feindes“, der zur Verteidigung der „nationalen Interessen“ physisch vernichtet und zu dessen Bekämpfung die Bevölkerung kontrolliert werden musste. Auf dieser Grundlage entstanden Militärdiktaturen „neuen Typs“, die sich gegenüber ihren Vorgängern dadurch auszeichneten, dass die Armee als Institution für längere Zeit die Macht übernahm, um einem „zweiten Kuba“ dauerhaft den Boden zu entziehen. In den so etablierten Militärregimes standen Repression und Reform in einem spannungsgeladenen Verhältnis, das sich von Land zu Land unterschied.
Der Zyklus der neuen Militärdiktaturen wurde am 31. März 1964 in Brasilien mit dem Putsch gegen Präsident João Goulart eröffnet. Er richtete sich gegen die erstarkende Bauernbewegung und diente zur Verhinderung einer Agrarreform. Die Ausschaltung der Opposition wurde durch eine technokratische Entwicklungsstrategie begleitet, die von ihren Nutznießern in den Rang eines Wirtschaftswunders gehoben wurde. Als die Institution Armee wegen wachsender politischer Kosten immer mehr unter Verschleißerscheinungen zu leiden begann, wurde per Elitepakt 1985 der Übergang zu einem demokratischen Regime vollzogen. Die repressiven Diktaturen in Bolivien (1964-1969), Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1990) und Argentinien (1976-1983) sind weitere Fälle im 1964 begonnenen Zyklus. Die Militärdiktaturen in Peru (1968-1975) und Bolivien (1969-1971) haben hingegen einen inklusiven Charakter. Mit ihrer anti-oligarchischen und anti-imperialistische Stoßrichtung weichen sie von der Regel der konterrevolutionären Diktaturen ab.
In einem von den USA orchestrierten „schmutzigen Krieg“ wurden alle, die sich für soziale Veränderungen einsetzten, bis hin zur physischen Vernichtung verfolgt. Diese Entwicklung gipfelte ab 1976 in der „Operation Condor“. Sie basierte auf streng geheimen Vereinbarungen zwischen den Geheimdiensten Argentiniens, Chiles, Paraguays, Uruguays, Boliviens und Brasiliens. Mit Unterstützung der USA wurde die Unterdrückung, Verfolgung und Ermordung politischer Gegner koordiniert. Dem Staatsterror der südamerikanischen Militärdiktaturen fielen mehrere hunderttausend Menschen zum Opfer. Schätzungen gehen von mindestens 50.000 Toten, 30.000 Verschwundenen und 400.000 Inhaftierten aus.
Die Pinochet-Diktatur in Chile verweist auf einen weiteren Faktor, der einer unabhängigen Entwicklung Lateinamerikas diametral widerspricht: die neoliberale Globalisierung. Es ist geradezu paradigmatisch, dass der Siegeszug des Neoliberalismus in einem Land begann, das 17 Jahre von einer konterrevolutionären Militärdiktatur beherrscht wurde. In den 1990er Jahren wurde – mit Ausnahme Kubas – ganz Lateinamerika zum Experimentierfeld neoliberaler Politik.
Wir nehmen den 60. Jahrestag des Putsches, mit dem die Streitkräfte am 31. März 1964 in Brasilien die Macht ergriffen, zum Anlass, um ein Dossier mit Beiträgen zu erstellen, in dem die Diktaturen, die zwischen 1964 und 1990 die Entwicklung in Lateinamerika geprägt haben, ausführlicher analysiert werden. Der heute veröffentlichte Beitrag versteht sich als Einführung in das Thema und bildet damit den Startpunkt für das Dossier. Im Verlauf der kommenden Wochen werden wir es nach und nach vervollständigen. Den Schwerpunkt bilden neu verfasste Artikel und Übersichten, die durch Arbeiten ergänzt werden, die bereits beim QUETZAL erschienen und für das Thema des Dossiers in besonderem Maße relevant sind. Wir hoffen, dass die kommenden Beiträge euer Interesse finden werden.
Bildquellen: Quetzal-Redaktion [1]_soleb; [2, 4]_pg; [3]_gustavo d’assoro