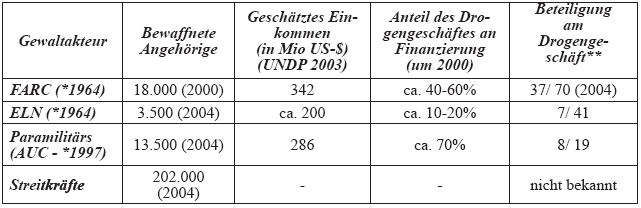Er ist noch jung, vielleicht achtzehn oder neunzehn Jahre alt. Trotzdem hat er beschlossen, heute Schluß zu machen. Es ist acht Uhr morgens. Er nimmt den Aufzug und fährt bis zum zehnten Stock des Hochhauses in der Stadtmitte. Niemand hält ihn auf. Er steigt durch ein Fenster und bleibt auf dem Sims stehen. Langsam rückt er einen Schritt nach dem anderen vor, mit dem Gesicht zur Straße, vor sich die Leere. Er spürt Schwindel und läßt die einzige Sekunde Entscheidungsfreiheit ungenutzt vorübergehen.
Unten beginnen die ersten Passanten auf ihn aufmerksam zu werden. In wenigen Sekunden sind viele Augen auf den möglichen Selbstmörder gerichtet. Der Verkehr stockt. Die Zeit zieht sich hin. Es erscheinen die Polizei, die Feuerwehr, das Rote Kreuz und natürlich die allgegenwärtigen Straßenverkäufer, die anfangen, ihre Waren auszurufen: Süßigkeiten, Zigaretten, Sprudel, Eis… Eine unverhoffte Gelegenheit.
Mit dem Verstreichen der Zeit kommt Ungeduld auf. Nach etwas mehr als einer Stunde hört man den ersten Zuruf. „Nun springen Sie schon, wir haben es eilig“, schreit ein Witzbold dem unentschlossenen Lebensmüden zu.
Von dem Augenblick an ist die Stimmung wie auf einem Volksfest. Der Morgen vergeht unter Reden, Lachen und den Rufen der Straßenverkäufer. Als es endlich einem Psychologen gelingt, den verhinderten Selbstmörder aufs Festland zurückzuholen, sind viele enttäuscht. Sie haben vier Stunden mit unnützem Warten vertan. Nur die Straßenverkäufer freuen sich: Sie haben so viel verkauft wie sonst an einem Sonntag im Fußballstadion.
Diese Gelegenheitsunternehmer haben eine besondere Nase für Menschenansammlungen, sie sind immer da, wo etwas los ist. Wie Ameisen auf einem Stück Kuchen. Die „Ambulanten“ oder „Informellen der Straße“ sind aus der Geschichte der Städte der Dritten Welt nicht wegzudenken. In Lateinamerika scheinen sie schon immer dagewesen zu sein. Die Chronisten erzählen, der Inka-Kaiser Tupac Yupanqui habe in seinem Reich ausrufen lassen, „jeder, der ein Handelsmann sein wolle, könne frei und unbehelligt durch das ganze Land ziehen“. [1]
Auch heute noch scheint dieses Dekret bei den Nachfahren der Inkas Gültigkeit zu haben. Die Otavalenos aus Ekuador und die Inganos, die an der Grenze zu Kolumbien leben, sind in ganz Lateinamerika als große Kaufleute bekannt. Man kann sie in den Parks vieler lateinamerikanischer und manchmal sogar europäischer Städte finden, wo sie in ihrer typischen Tracht, begleitet von Pauken, Flöten und kleinen fünfseitigen Gitarren, den Charangos, ihre Waren und ihre Musik verkaufen.
Verbieten unmöglich
Seit der Kolonialzeit gehören informelle Arbeit und Armut zusammen. Als die Vizekönige die Indios und Mestizen von den Straßen ihrer Städte vertrieben, ließen sie es zu, daß verarmte Spanier als „fliegende Händler“ die Arbeit der eingeborenen Wanderhändler übernahmen.
Diese historische Tradition des ambulanten Verkaufs, in manchen Reiseprospekten als besonders typisch angepriesen, wurde durch viele Neueinwanderer verstärkt. Im karibischen Raum brachten es die Araber, die mit ihrem unverwechselbaren Akzent ihre Waren hauptsächlich an den Küstenstreifen ausriefen, zu großer Popularität. Der brasilianische Schriftsteller Jörge Amado beschreibt in seinen Romanen, wie sie durch die Regenwälder von einer Kakaoplantage zur anderen zogen. „Turcos“ (Türken) oder „Majitos“ nannten die Leute diese geschickten arabischen Händler, die oft schnell reich wurden und von Straßen- oder Über-Land-Verkäufern zu Eigentümern der ersten Kaufhäuser in den aufstrebenden Städten der Neuen Welt avancierten.
Der Straßenhandel war fast zu allen Zeiten verboten, aber bis heute konnte ihm noch kein Gesetz beikommen. Die Gelegenheitsverkäufer überschwemmen die Städte, verstopfen die Bürgersteige und stören den Verkehr. Sie sind wie Verdammte, von allen gehaßt: von den Fußgängern, die über sie stolpern, von den Autofahrern, die sie für das Verkehrschaos verantwortlich machen, und natürlich von den Ladenbesitzern, die sie als die unlautersten Wettbewerbsteilnehmer der Welt ansehen, da sie weder Steuern noch Standgeld bezahlen. Und die Stadtverschönerer rümpfen die Nase über sie und sehen sie als schmutzverbreitendes Schandmal an.
Sie sind verdammt, aber sie sind auch gesegnet. Sie verhökern ihre Waren zu den unglaublichsten Preisen. Schallplatten, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Obst, Werkzeug, Devotionalien, das meiste aus zweiter Hand, dazu Radioapparate, Plattenspieler, Elektrogeräte und alles, was der Schmuggel ihnen sonst noch in die Hand spielt. Nur ihnen ist es zu verdanken, daß die ärmsten Schichten zu Produkten kommen, die sie nie in einem normalen Geschäft kaufen könnten.
Stadtbesetzer
Die große Mehrheit dieser Gelegenheitsverkäufer lebt in den Elendsgürteln rings um die großen Städte Lateinamerikas, in den Favelas, Ranchos, Chabolas oder wie die Armenviertel im jeweiligen Land heißen. Und fast alle diese Menschen haben die gleiche Geschichte: Sie sind auf dem Land aufgewachsen und flohen vor dem Hunger oder vor der Gewalt, manchmal auch vor beidem. In vielen Ländern des Kontinents waren die Städte in relativ kurzer Zeit übervölkert. In Kolumbien zum Beispiel haben die wichtigsten Städte heute sechsmal mehr Einwohner als zur Zeit der in den fünfziger Jahren herrschenden – und Gewalt verbreitenden – Zweiparteienpolitik. Lima ist in den letzten vierzig Jahren um l .200 Prozent gewachsen, und auch die Städte El Salvadors, Guatemalas und Nikaraguas verzeichneten als Folge der Bürgerkriege ein unverhältnismäßig starkes Wachstum.
Diese Zuwanderer – oder internen Flüchtlinge -überschwemmten große Bezirke an den Rändern der Städte. Berghänge, Hügel, Steppen oder Sumpfgebiete, die man nie für bebaubar gehalten hatte, verwandelten sich durch den zähen Widerstand ihrer Besetzer zuerst in Vororte und wuchsen dann mit der Stadt zusammen. Zur Verteidigung ihrer armen Behausungen hißten die Leute die Nationalfahne, um damit auszudrücken, daß sie ein legitimes Bürgerrecht ausübten; sie gaben ihren Vierteln die Namen von Präsidenten oder Präsidentengattinnen, mit der Absicht, so deren Herzen zu rühren; und sie verteidigten sich gegen die Knüppel der Polizei, um das Abreißen der Hütten zu verhindern. Dann bauten sie in Gemeinschaftsarbeit Straßen, Schulen und Gesundheitszentren, legten Rohre und Kabel und hatten so Trinkwasser und Strom, alles schwarz.
Vom sozialen und politischen Standpunkt aus sind diese inoffiziellen Vorstädte das Territorium der Ausgestoßenen der Gesellschaft. Die kolumbianische Soziologin Maria Teresa Uribe schreibt:“… es sind die Gettos, in die die Gesellschaft alle diejenigen verbannt, die nicht in die engen Strukturen des Produktionsprozesses hineinpassen und die deshalb mit Gelegenheitsarbeiten um den sozialen Raum kämpfen, den wir ihnen verweigern, wobei sie sich einem Regierungsapparat gegenübersehen, von dem sie nur die autoritäre und repressive Seite kennen. Ein sich selbst überlassenes menschliches Konglomerat, das so gut es geht zu überleben versucht, in einer Umwelt, in welcher der Tod, der eigene oder der der anderen, nur eines von den vielen Risiken ist, die das Abenteuer Leben nun einmal mit sich bringt.“ [2]
Die Regierungen konnten die Lawine nicht auffangen und verhielten sich abwartend. Die politischen Parteien zogen aus, die neuen Städter für sich zi‘ gewinnen, hielten volksnahe Reden und eroberten ihre Stimmen, aber ihre Versprechen hielten sie nicht. Die Neuankömmlinge, völlig auf sich selbst gestellt, schufen – wie Gott im ersten Buch Mose – eine neue Welt, ihre Welt. Sie erfanden tausend Gewerbe, gaben sich selbst Gesetze, bewahrten ihre bäuerlichen Traditionen und wurden zu einer riesigen Parallel-Gesellschaft außerhalb der Garantien – aber auch der Nachteile der Legalität.
Hernando de Soto beschrieb 1986 das Ausmaß, das in Peru im besonderen und in Lateinamerika im allgemeinen die sogenannte „informelle Ökonomie“ einnimmt. [3] In Lima sind fünfzig Prozent der Arbeitsplätze und der Wohnungen informell; dieser Sektor trägt fast vierzig Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. In Argentinien erwirtschaftet der informelle Sektor jährlich über 50 Milliarden Dollar. In Kolumbien werden in den zehn größten Städten 35 Prozent der Arbeitsplätze von der nicht-offiziellen Wirtschaft gestellt.
Das Problem ist der Staat
Aber Hernando de Soto drehte auch die Perspektiven seiner Analyse um: „Die informellen Sektoren sind nicht das Problem, sondern die Lösung.“ Von seinem Standpunkt aus stimmen die üblichen Behauptungen über diese Art von „schwarzem“ Markt einfach nicht: Es handele sich um unlauteren Wettbewerb dem offiziellen Handel gegenüber; er fördere die Armut und die Randexistenz; die Volkskultur dieser Leute sei unvereinbar mit einem modernen Unternehmergeist… All diese Meinungen müssen neu überdacht werden, um die Wirtschaftsprozesse der meisten Länder Lateinamerikas verstehen zu können, denn hier ist der informelle Sektor eine Riesenfirma, ein Arbeitgeber, der das Überleben eines großen Teils der Bevölkerung gewährleistet.
Um sich in diesen Ländern innerhalb der Legalität zu bewegen, braucht man Geld und viel Zeit. Genau das, was die Randschichten nicht besitzen, die täglich zwölf oder fünfzehn Stunden arbeiten müssen, um ein Einkommen zu haben, das hinten und vorne nicht reicht. Wie Mario Vargas Llosa aufzeigt, wird die wirtschaftliche und soziale Apartheid von dem riesigen Spinngewebe, das die sogenannte Legalität darstellt, nur noch verstärkt: „Wenn die Legalität ein Privileg ist, zu dem man nur durch wirtschaftliche oder politische Macht Zugang hat, bleibt dem Volk keine andere Alternative als die Illegalität.“ [4]
Ein Forscherteam, das das Buch mit dem Titel „El otro sendero“ („Der andere Pfad“) schrieb, hat es selbst ausprobiert. Durch die Anmeldung von fiktiven Finnen stellte es fest, wie lang und dornig der Weg durch die Instanzen tatsächlich ist. Zum Beispiel wurde die offizielle Genehmigung zur Eröffnung einer Werkstatt nach 289 Tagen erteilt, und auch das nur nach zweimaligem Zahlen von Schmiergeldern. Eingerechnet Gebühren, Bestechungsgeld und investierte Zeit beliefen sich die Gesamtkosten auf l .231 Dollar. Gleichfalls berechnete dieses Team den Kostenaufwand und die Zeit, die es braucht, um eine Wohnung registrieren zu lassen: sechs Jahre und 2.156 Dollar.
Die Bearbeitung ganz gleich welcher Papiere funktioniert in offiziellen Organismen nur dann reibungslos, wenn ein paar Geldscheine ihren Besitzer wechseln. Für diese Schmiergelder hat jedes Land seinen eigenen Ausdruck: mordida, coima, palada, serrucho, liga… Um jede offizielle Institution gruppiert sich ein Heer von Mittelsmännern oder Zwischenhändlern, die jedes Dokument schnell und problemlos besorgen, was allerdings einiges kostet. Diese Mittelsmänner sind so tüchtig, daß sie mühelos einen Instanzenweg von mehreren Monaten auf ein paar Stunden reduzieren. Sie beschaffen Führerscheine für Leute, die noch nie am Steuer gesessen haben, besorgen Wehrpässe, Führungszeugnisse, Universitätstitel, Einfuhrlizenzen oder Bescheinigungen für fiktive Exporte… Alles – oder fast alles – bekommt man schnell und ohne Schlange zu stehen, wenn man nur Geld hat. Wie ein kolumbianisches Sprichwort sagt: „Für Geld tanzen auch die Hunde“.
An dieser Illegalität innerhalb der Legalität nimmt praktisch die gesamte Gesellschaft teil. Auch wenn man das vielleicht nicht mit hundertprozentiger Sicherheit von allen lateinamerikanischen Ländern behaupten kann, ist Kolumbien jedenfalls ein Land von Gaunern und Schwindlern erster Güte. Es gibt tausende von Tricks, Steuern zu hinterziehen; anstatt eine Geldstrafe zu bezahlen, schmiert man lieber einen Verkehrspolizisten; und es ist allgemein üblich, Beamten und Angestellten staatlicher Einrichtungen eine Provision zu zahlen, um an irgendwelche Vorteile oder Verträge zu kommen.
Die Schwarz- und Gelegenheitsarbeiter bleiben aus einem einfachen Grund außerhalb dieser Legalität: Ihre Einkünfte sind nicht hoch genug, um das Eintrittsgeld in das offizielle Rechtssystem zu zahlen und die Kosten für ein Verbleiben in ihm aufzubringen. Darum betrachtet man sie mit einer gewissen Verachtung, aber in Wirklichkeit ist dieser informelle Sektor in vieler Hinsicht produktiver als der Staat selbst. Er schafft Arbeitsplätze aus dem Nichts und war immer ein Notventil für die riesigen sozialen Unterschiede in den meisten der lateinamerikanischen Länder.
Es ist also nicht logisch, daß der Staat zuerst seinen Bürgern keine Arbeit, keine Wohnung und kein Transportmittel gibt und sie dann, wenn sie sich das alles selbst beschafft haben, im Namen des Gesetzes unterdrückt.
Hernando de Soto schlug ein paar einfache Formeln vor, um den Wirkungsmöglichkeiten der informellen Arbeiter nicht so viele Steine in den Weg zu legen: Vereinfachung der bürokratischen Formalitäten; Legalisierung der spontanen Werkstätten und Kleinbetriebe, damit sie Kredite beantragen und Verträge abschließen können; Ausstellung von Grundstücksurkunden für die Landbesetzer.
Obwohl logischerweise diesen Punkten von keiner Seite widersprochen wurde, glauben nicht alle an ihre volle Wirksamkeit. „De Soto übertreibt“, sagt Hugo Lopez, ein kolumbianischer Volkswirtschaftler und Experte auf dem Gebiet der informellen Ökonomie. „Selbst wenn man den Leuten die Papiere schenkte, wäre das Problem damit nicht gelöst. Das Problem der informellen Wirtschaft heißt Produktion und Rentabilität. (…)“
Die Zukunft: Eher trübe als heiter
Die letzten Daten über die inflationäre und schuldenbeladene lateinamerikanische Wirtschaft lassen die Zukunft nicht gerade rosig erscheinen. Der sogenannte dritte Sektor wächst und damit die Gelegenheits- und Schwarzarbeit, eben die Informalität.
Die Informalität ist ein sozialer Makel, der auf der einen Seite Abwesenheit einer verantwortlichen Autorität des Staates den sozialen Gruppen gegenüber bedeutet und dadurch das Entstehen paralleler Macht- und Kontrollformen begünstigt. Auf der anderen Seite versperrt dieser Staat breiten Bevölkerungsschichten den Zugang zu Erziehung, Gesundheitsfürsorge und anderen Sozialleistungen, die jeder Staat verfassungsrechtlich verpflichtet ist, seinen Bürgern zu gewähren. Jahre sind vergangen, seitdem die Studie „El otro sendero“ veröffentlicht wurde, und nichts hat sich wirklich verändert. Mario Vargas Llosa, der das Vorwort zu dem Buch schrieb und aus den darin enthaltenen Vorschlägen ein politisches Programm machte, verlor die letzten Präsidentschaftswahlen in Peru. Trotz seiner Versprechungen zogen es die Bewohner des informellsten Landes Lateinamerikas vor, den politischen Neuling Alberto Fujimori zu wählen.
Es wäre vernünftig, die Empfehlungen de Sotos anzuhören. Vermutlich sind sie kein Allheilmittel, aber sie könnten dazu beitragen, die Lebensbedingungen breiter Bevölkerungssektoren zu verbessern. Um endgültige Lösungen zu finden, braucht es tiefgreifende Veränderungen. Wenn Lateinamerika einen Ausweg aus der Armut und seinem Dritte-Welt-Status finden will, muß es große und komplexe Probleme bewältigen: In seinen Beziehungen zu den Ländern der entwickelten Welt muß es einen gangbaren Ausweg aus dem Labyrinth der Auslandsschuld finden, bessere Bedingungen für den Warenaustausch aushandeln und Technologien einführen, die das enorme Gefalle etwas mildern und den Lebensstandard der Bevölkerung ein wenig anheben können. Im inneren Bereich müssen die Agrarkonflikte gelöst, eine Umverteilung des Einkommens erreicht, Städtereformen durchgeführt und eine Reihe von politischen Reformen in Angriff genommen werden, die eine höhere Beteiligung der traditionell von der Macht ausgeschlossenen Gruppen bewirken können.
Es handelt sich nicht darum, den informellen Sektor in eine monströse Legalität einzubeziehen, sondern um ein Fortschreiten des Aufbaus der lateinamerikanischen Nationen und die Demokratisierung des politischen Lebens.
aus: Weißbuch Lateinamerika, Peter Hammer Verlag
_____________________________
Quellen:
[1] de Soto, Hernando: El otro sendero. Editorial Oveja Negra, 1987, S. 82
[2] Uribe, Maria Teresa: Cien Dias. Centro de Investigaciön y Educación Popular. Nr. 11, Juli-September 1990.
[3] de Soto, Hernando, op. cit.
[4] Vargas Llosa, Mario: El otro sendero. Vorwort, S. XIX