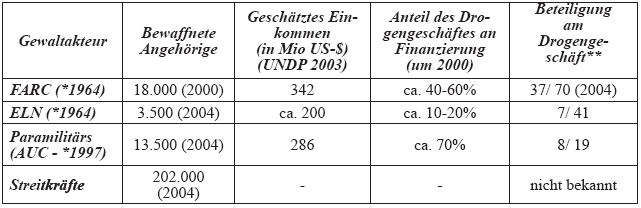Im folgenden sollen einige Reflexionen zum Verhältnis von kapitalistischen neoliberalen Strukturreformen und den Demokratisierungsprozessen in Lateinamerika vorgestellt werden, d.h. es geht darum, das problematische Nebeneinander von Redemokratisierungsprozessen seit Ende der 70er bzw. seit Beginn der 80er Jahre (Nicaragua, Peru, Bolivien, Argentinien, Uruguay, Brasilien, Chile, Paraguay etc.) und der tiefgreifenden ökonomischen Krise seit Beginn der 80er Jahre (im Zusammenhang mit den darauffolgenden entsprechenden Anpassungspolitiken) zu analysieren. Wie schon häufig zu Recht bemerkt worden ist, widerspricht diese Kombination von langandauernder, tiefer ökonomischer Krise und anhaltender Demokratisierungswelle lange Zeit gehegten Erwartungen und formulierten Hypothesen, wonach nur auf der Basis einer relativ dauerhaften Prosperität auch demokratische Stabilität gedeihen könne (Modernisierungstheorie) oder aber umgekehrt, wonach in einer tiefenteilweise systembedrohenden ökonomischen Krise die Tendenz zu diktatorischen Lösungen bzw. bürokratisch-autoritären Regimevarianten die wahrscheinlichste Antwort auf diese Situation sei. Ein ganzer neuer Forschungszweig, der sich „Transition-Forschung“ nennt, hat sich an diese eigentümliche Konstellation angeschlossen.
Zunächst gilt es m. E., den Charakter der Krise und ihr Verhältnis zu den neoliberalen Anpassungspolitiken genauer zu bestimmen. Eine Reihe von Autoren ist offenbar einig in der Auffassung, daß die Krise der 80er Jahre in Lateinamerika keine bloße Verschuldungskrise war, daß umgekehrt die Verschuldung die Krisenmomente temporär überdeckt, den Krisenausbruch verzögert und drittens schließlich die Tiefe der dann ausgebrochenen Krise mitbestimmt hat. Einigkeit besteht auch darüber, daß diese Krise der 80er Jahre in ihren verschiedenen Dimensionen seit der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er und zu Beginn der 30er Jahre die dauerhafteste und eingreifendste Krise in Lateinamerika gewesen ist.
Die Anfang der 80er Jahre aufgebrochene Krise ist auch eine Krise des bisherigen Entwicklungsmodells
Es scheint auch demzufolge nicht übermäßig strittig zu sein, daß die Anfang der 80er Jahre aufgebrochene Krise nicht bloß zyklischer Natur war, sondern in ihr eine strukturelle Komponente wirksam war bzw. ist, d.h. sie auch eine Krise des bisherigen Entwicklungsmodells bzw. der bisherigen Entwicklungsstrategie sei. Das in diesem Zusammenhang häufig vorgetragene Standardargument lautet, verkürzt, etwa wie folgt: Die populistischen Regime der 30er und 40er Jahre brachten die Politik der Importsubstitution und Industrialisierung nach Lateinamerika; beides geschah unter aktiver Intervention des Staates in die ökonomischen Prozesse und unter erheblicher Abschirmung der nationalen Wirtschaftsräume vor dem Weltmarkt (hohe Schutzzölle). Dies habe zu einer Industrialisierungsstruktur geführt, welche nicht Weltmarkt-konkurrenzfähig sei und daher (im Verein mit den traditionellen Agrarstrukturen) die relative Abkoppelung Lateinamerikas vom Weltmarkt und schließlich die strukturelle Krisensituation hervorgebracht habe. Eine Öffnung zum Weltmarkt, eine Anpassung an Weltmarkterfordernisse und ein Rückzug des Staates aus der Ökonomie sei gleichermaßen zur Sanierung der lateinamerikanischen Volkswirtschaft notwendig. Die gleichzeitig eintretende Demokratisierung in fast allen Ländern des Subkontinents durchlaufe insofern eine Durststrecke, als durch die Anpassungspolitiken die Krisenausmaße sich zunächst noch vergrößerten, diese danach aber auf dem sicheren Weg der „gesunden Markt wirtschaftlichen Gleise“ umso größere Chancen für die Zukunft habe. Mit dieser Argumentation wird eine Entwicklungsstrategie (import substituierende Industrialisierung) oder ein Entwicklungsstil und nicht die ihnen zugrunde liegende Produktionsweise für das Krisendilemma verantwortlich gemacht. Gelegentlich gewinnt man den Eindruck, als ob der „Entwicklungsstil“ den Charakter von grundlegenden Produktionsverhältnissen und systembestimmende Dignität zugewiesen erhält. Etwas realistischer erscheint es, diesen aus einer spezifischen sozial strukturellen Konstellation erklären zu wollen. „Das Verharren bei traditionalen Formen der Weltmarktspezialisierung und einer im portintensiven industriellen Importsubstitution, die spätestens Ende der 60er Jahre erschöpft war, führten in die Verschuldungs- und Modellkrise der 80er Jahre…
Wichtigstes Transitionshemmnis ist in den Ländern Lateinamerikas ein wirtschaftliches, politisches, institutionelles und kulturelles Geflecht, welches das bisherige Wachstumsmodell hervorbrachte und durch dieses weiter verstärkt wurde. Dieses Geflecht ist stabil, weil es auf einem elastischen Kompromiß zwischen Rohstoffexporteuren, Industrieunternehmern, städtischen Mittelschichten und organisierter Arbeiterschaft beruht.“(K. Eßer,11). Hier klingt im Grunde schon an, daß die Krise sich nicht irgendeiner temporären und leicht zu korrigierenden wirtschaftspolitischen Strategie verdankt, sondern daß diese letztlich aus den abhängigen und rückständigen Formen der kapitalistischen Produktionsweise resultierte und nun seit vielen Jahren in der jeweiligen Sozialstruktur der einzelnen Länder verankert ist. Die hervorgebrachten defizitären Strukturen des abhängigen, strukturell heterogenen
Kapitalismus (gering verflochtene industrielle Strukturen, hoher Konzentrationsgrad und Monopolisierung der Industrie, Preisstarrheit und Angebotsinelastizität, große Diskrepanzen zwischen den Wirtschaftssektoren, Abwesenheit einer autochthonen Fähigkeit zur Generierung angepaßter Technologien im eigenen Land etc.) sind charakteristisch für die Entfaltung des Kapitalismus in Lateinamerika und können nicht einfach im Namen eines idealen Kapitalismus, den es in der Dritten Welt nie gab und nie geben wird, wegdiskutiert oder weggewünscht werden. Wenn also die Entwicklungsstrategie (importsubtituierende Industrialisierung) und die Momente ihres relativen Scheiterns nur auf der Basis der ihr zugrunde liegenden Produktionsweise zu begreifen sind, ist gerade zu analysieren, warum eine andere, rein ökonomisch gesehen, rationalere Strategievariante offenbar in Lateinamerika nicht zu realisieren war. Dies kann hier nicht in extenso geschehen. Nur soviel ist anzudeuten: der neuralgische Punkt muß in den stoff- und wertmäßigen Defekten (bzw. Deformationen) des Akkumulationsprozesses in Lateinamerika gesehen werden; die internen interindustriellen Verflechtungen waren so mangelhaft, daß die industrielle Außenhandelsbilanz immer negativer wurde. Diese Struktur des industriellen Produktionsapparates ist nicht zu erklären, wenn nicht die wesentliche Prägung durch einheimische monopolkapitalistische Gruppierungen und die starke Kontrolle durch ausländisches Kapital (gerade in den dynamischen Industriebranchen) in Rechnung gestellt werden. Ihr Interesse an einer Bedienung des Binnenmarktes und nicht so sehr das Interesse am Aufbau einer homogenen und flexiblen, die Massenbedürfnisse abdeckenden Produktionsstruktur sind für das hohe Maß an Heterogenität des industriellen Sektors und damit seine charakteristischen Defizite verantwortlich.
Nach Aufbrechen der Verschuldungskrise mußten fast alle Länder Lateinamerikas, früher oder später, härter oder sanfter, sich den IWF-Anpassungsprogrammen unterwerfen, um ihre sog. Kreditfähigkeit aufrechtzuerhalten. Da die Krisenanalyse des IWF selbstverständlich nicht die kapitalistisch erzeugten Disproportionen des Produktionssystems thematisierte, sondern in einer „Übernachfrage“ die Gründe für die Inflation, die Überbewertung der Landeswährung, den Importüberschuß, die Zinsüberhöhung und die geringen Investitionsraten etc. sah, waren die wirtschaftspolitischen Empfehlungen entsprechend dieser Sicht der Dinge angelegt. Diese orientierten sich infolgedessen weniger an der Aufhebung oder gar systematischen Beseitigung der erzeugten Disproportionen, sondern bezogen sich allesamt darauf, die so genannte Übernachfrage abzubauen.
Eine eindeutige Zuordnung der Phasen des Krisenprozesses zu Phasen der Redemokratisierung bzw. Demokratisierung läßt sich m.E. nicht vornehmen.
Die Frage ist nun, wie die verschiedenen Phasen des Krisenprozesses (Krisenbeginn, Krisenmanagement durch Austeritätspolitik, Auswirkungen der Austeritätspolitik etc.) mit den Phasen des Demokratisierungsprozesses verwoben sind; ob es Zusammenhänge, Parallelitäten oder gar Kausalbeziehungen gibt, oder ob beides relativ unabhängig voneinander und zufällig eingetreten ist.
Eine eindeutige Zuordnung der Phasen des Krisenprozesses zu Phasen der Redemokratisierung bzw. Demokratisierung läßt sich m.E. nicht vornehmen. Dazu sind die internen Voraussetzungen für die Demokratisierungsprozesse zu verschieden gewesen. In Nicaragua z.B. war der antisomozistische Kampf eine Bewegung gegen eine langjährige Diktatur, welche relativ unabhängig vom ökonomischen Krisengeschehen oder gar einer Antikrisenpolitik der bestehenden Regierung war; in Peru waren die großen Protestbewegungen, die schließlich zur Redemokratisierung beigetragen haben, vor allem durch die Praktizierung der IWF-Stabilisierungsprogramme seit 1977/78 ins Leben gerufen worden.
In Brasilien schließlich begannen die ersten entscheidenden Ansätze für eine Redemokratisierung Ende der 70er Jahre, als sich die ersten deutlichen Krisenzeichen der weiteren ökonomischen Entwicklung offenbarten. D.h., daß die Demokratisierungsprozesse, ihre Anfänge und ihre Ausreifung, in ganz verschiedene nationale politische Situationen und Phasen ökonomischer Entwicklung gefallen sind. Dennoch kann sinnvollerweise gefragt werden, was die (starken) Militärdiktaturen bewogen haben mag, einen solchen Redemokratisierungsprozeß zuzulassen bzw. selbst einzuleiten. Da mit Ausnahme Nicaraguas (vielleicht auch mit Abstrichen Argentiniens) die Opposition nirgendwo so stark war, „die Rückkehr zur Demokratie ( zu ) erzwingen“ (Nohlen, 10), muß gefragt werden, welche anderen kausalen Determinanten für die Erklärung dieses Wandels herangezogen können.
Wenn es zutrifft, daß dem Übergang vom Militärregime zur zivilen Regierung noch nicht einmal eine wesentliche Kräfteverschiebung innerhalb der Segmente der herrschenden Klasse und zwischen dieser und der Arbeiterklasse bzw. anderen werktätigen Schichten zugrunde lag, drängt sich die Frage nach den Gründen, der inneren Logik eines solchen „Demokratisierungsprozesses“ auf.
a) Festzuhalten ist, daß die Demokratisierung in den meisten Fällen nur sehr oberflächlich war, insofern als sich die Militärs überall entweder gewisse verfassungsmäßige oder faktisch politisch wichtige Kontroll- und Überwachungsfunktionen gegenüber den Zivilregierungen vorbehielten. Überall außer in Argentinien – wurde ihnen Straffreiheit zugesichert. In Argentinien ist die Bestrafung im Zuge des sukzessiven „roll-back-Prozesses“ (verschiedene Gesetze, neue Putschversuche) fast ausschließlich auf die Junta-Mitglieder beschränkt worden.
b) Die Demokratisierung bedeutet – insbesondere in Argentinien, aber auch in anderer Form in Brasilien, Uruguay etc.- eine Verstaatlichung bzw. Sozialisierung der Verluste, die durch die staatliche Kreditaufnahme- und Vergabepolitik, durch Wechselkursmanipulationen etc. entstanden sind, und die wesentlich die Verschuldungskrise und die fast parallel dazu sich entfaltende Kapitalflucht verursachte. Für die von der Diktatur aufgenommenen Auslandskredite, die an Inländer zu günstigen Wechselkursrelationen weitergegeben wurden (d.h. an die Export- und Finanzoligarchie) und die damit entweder im Inland spekulative Geschäfte tätigten oder diese Gelder gleich im Ausland wieder anlegten, soll nun die Allgemeinheit, offenkundig repräsentiert durch die demokratisch gewählte Regierung, geradestehen.
c) Die Opposition der Massen gegen die Militärs hat potentiell gefährlichere Konsequenzen als gegen eine gewählte Regierung, die Opposition kann formal in demokratische Bahnen kanalisiert und abgemindert werden; die Spielregeln der Demokratie werden offenbar von allen anerkannt, ein Konsensus kann leichter herbeigeführt werden.
d) Nach den traumatisch wirkenden Erfahrungen mit der Diktatur, die vor allem in Chile und Argentinien sowie in Uruguay zu den grausamsten ihrer Geschichte zählte, sind die Massen (zunächst und vielleicht auch noch für einige Zeit) bereit, gewissermaßen im Austausch gegen das hohe Gut der politischen Demokratie und der relativen Rechtsstaatlichkeit, auch (weiterhin) ökonomische Opfer zu bringen. Aus all diesen Gründen bringt eine solche moderate, kontrollierte Demokratie in dieser Situation viele Vorteile für den herrschenden Block an der Macht im Inland ebenso wie für die entsprechenden Kreise im Ausland, ohne allzu hohe Risiken dabei einzugehen. Besonders erleichtert wurde für die Herrschenden der Übergang zur politischen Demokratie durch tiefgreifende Sozialstrukturveränderungen, die während der Zeit der Militärregierungen stattgefunden haben.
Sozialstrukturveränderungen seit Mitte der 60er bis Mitte der 80er Jahre haben zu einer enormen Schwächung der Oppositionsbewegungen geführt
Die Sozialstrukturveränderungen seit Mitte der 60er Jahre bis Mitte der 80er Jahre lassen sich – in ihren politischen Konsequenzen – alle dahingehend zusammenfassen, daß durch sie tatsächliche und/oder potentielle Oppositionsbewegungen gegen die existierende sozioökonomische Grundstruktur enorm geschwächt wurden. In fast allen Ländern haben sich diese sozialstrukturellen Folgen mehr oder minder stark durchgesetzt:
- abnehmende Lohnabhängigenquote, entsprechender Anstieg des „Cuenta-propismus“, d.h. des Anteils der „Arbeiter auf eigene Rechnung“ (Kioskbesitzer, Losverkäufer, Schuhputzer etc.).
- Abnahme des Anteils der industriellen Arbeiter an den Lohnabhängigen insgesamt; dem Rückgang der industriellen Produktion in vielen Ländern (speziell in Argentinien, Chile und Uruguay) entsprach in der Regel eine noch stärkere Reduktion der industriellen Beschäftigten, was auf starken Produktivitätsanstieg in diesen Bereichen hindeutet.
- Die Lohnquote sank in dieser Periode der Militärherrschaft in der Regel bemerkenswert stark, auch die Reduktion der durchschnittlichen Reallöhne war in den meisten Ländern deutlich spürbar. Da von den Massenentlassungen überproportional Großbetriebe (z.B. der Automobilindustrie, aber auch solche im staatlichen Sektor: Eisenbahner, Elektrizitätswerke etc.) betroffen waren, kam es auch zu einer gewissen De-Konzentration der Arbeiterklasse, was natürlich ebenfalls zu ihrer Schwächung beitrug.
Zu der Rechtlosigkeit, der zahlenmäßigen Reduktion, dem starken Reallohnverlust und dem Wegfall von sozialen Leistungen kam als weiteres Schwächungsmoment der Arbeitenden die bewußte Politik der weitgehenden Lohndifferenzierung zu. Die angestrebte Verringerung der internen Homogenität der Arbeiterklasse durch die Einführung einer, sehr breitgestaffelten Lohnskala hatte ebenso wie häufig die Verabschiedung neuer Gewerkschafts- und Arbeitsgesetze zum Ziel, die Arbeiterbewegung als kollektive Gegenmacht durch Individualisierung, Entsolidarisierung und Dezentralisierung zu entkräften. Die Vernichtung oder Exilierung von Arbeiterführern und Vertretern der kritischen Intelligenz, die Tradition der korporativen Einbindung zumindest von Teilen der Gewerkschaftsbürokratie sowie die – zumindest in einigen Ländern – traditionell geringe Bedeutung der politischen Parteien waren weitere Gesichtspunkte dafür, eine formale Demokratisierung in den Augen des Kerns der herrschenden Klasse als ungefährlich erscheinen zu lassen. Demnach kann der Übergang von einem Militärregime zu einer bürgerlichen Demokratie in vielen Fällen eher als Resultat eines nüchternen, situationsadäquaten Kalküls des Blocks an der Macht denn als Vorgang, der aus einer wesentlichen Veränderung der gesamtgesellschaftlichen Kräfteverhältnisse resultiert, verstanden werden. So gelangen selbst Politikwissenschaftler wie D. Nohlen zu der Auffassung, „daß der Wechsel zwischen Militärregimen und demokratischen Herrschaftssystemen für die gesellschaftlich priviligierten Gruppe nur einem Wechsel zwischen zwei gleichermaßen mehr oder weniger akzeptierten politischen Formen entspricht – wobei sich die Bewertung im Einzelfall nach der tatsächlichen oder perzipierten Bedrohung des eigenen gesellschaftlichen Status quo durch Sozialrevolutionäre Kräfte bemißt.“ (Nohlen 16).
Dennoch kann aus einer Analyse der sehr begrenzten und höchst ambivalenten Erfolge neoliberaler Wirtschaftspolitik nicht unmittelbar auf die Fragilität oder hohe Gefährdung der politischen Demokratie geschlossen werden. Ein klarer Zusammenhang zwischen Regimetyp und der Art der wirtschaftlichen Entwicklung existiert nicht, weder historisch noch aktuell. Dies gilt zunächst für die „objektiven Daten“ der wirtschaftlichen Entwicklung und der Art des politischen Regimes. Noch anders stellt sich allerdings das Problem, wenn die Wahrnehmung dieses Zusammenhangs durch relevante Bevölkerungsteile betrachtet wird; in diesem Fall könnte durchaus – entgegen den objektiven Befunden – eine Vorstellung etwa von der Art auftauchen, daß autoritäre Regime die ökonomisch bessere, effizientere Wirtschaftspolitik betreiben können und diese Regime sogar die Fürsorge für sozial schwache und unterprivilegierte Schichten besser besorgen könnten als dies den demokratischen Regierungen und beim Obwalten bloßer Marktgesetze möglich ist. Diese zur Mentalität verdichtete Sichtweise ist in Lateinamerika (und sicherlich auch anderswo) in gewissem Ausmaß (noch) verbreitet, wenngleich sie durch die fast in jeder Hinsicht desaströsen Erfahrungen mit den Militärdiktaturen in Lateinamerika an Glauben und Verbreitung zweifellos eingebüßt hat.
In der Bevölkerung könnte die Vorstellung auftauchen, dass autoritäre Regime die ökonomisch bessere, effizientere Wirtschaftspolitik betreiben könnten.
So braucht bloß partielles ökonomisches Wachstum wie auch eine verallgemeinerte Krisenkonstellation in Lateinamerika oder einzelnen lateinamerikanischen Ländern weder die Variante neuerlicher autoritärdiktatorischer Experimente noch die Fortdauer formell-demokratischer Herrschaftsformen auszuschließen. Die oben gestellte Frage nach der Vereinbarkeit neoliberaler Wirtschaftspolitiken mit überwiegend negativen Konsequenzen für die Bevölkerungsmehrheit mit der bürgerlichen Demokratie ist in dieser Form wahrscheinlich zu abstrakt, denn wesentlich kommt es darauf an, welche Organisationsprozesse, Bewegungen und politische Auseinandersetzungen parallel zur ökonomischsozialen Entwicklung stattfinden bzw. sich herausbilden. Wenn eine ernsthafte Opposition mit realen Alternativvorstellungen fehlt, kann – trotz zunehmender oder fixierter hoher sozialer Polarisierung der Bevölkerung – die bestehende politische Herrschaftsform (also der politischen Demokratie) durchaus weiter existieren. Zwar sind die generellen gesellschaftlichen und politischen Bedingungen für eine neue progressive soziale Bewegung durch die Redemokratisierungsprozesse in Lateinamerika zweifellos verbessert worden. Aber aufgrund der „Fernwirkung“ der Militärdiktaturen, d.h. der sozialstrukturellen Atomisierungstendenzen und der ideologischen Wendungen zahlreicher ehemals linker Politiker, Intellektueller etc. scheint die Perspektive für die Herausbildung einer starken systemkritischen Bewegung in den meisten Ländern Lateinamerikas geringer geworden zu sein; insofern besteht für die bürgerlichdemokratischen Regimes kein Anlaß sich zurückzuziehen, oder es besteht kein Grund dafür, daß sie ausgewechselt werden müssen. Umgekehrt sind die Militärs in den meisten Ländern immer noch so stark in ihrem Prestige angeschlagen, daß auch sie als denkbare Alternative auf der politischen Bühne in naher Zukunft noch ausscheiden….
Insofern ist es denkbar und sogar – nach Lage der Dinge – am wahrscheinlichsten, daß die mäßigen Ergebnisse neoliberaler Strukturreformen die zweifellos vorhandenen Spannungen zur politischen Demokratie – mangels realer Alternativen – nicht per se zuspitzen werden, d.h. grundlegende ökonomische Verbesserungen und/oder politische Veränderungen sind in Lateinamerika (und vielleicht auch sonst in der Dritten Welt) in näherer Zukunft nicht in Sicht.
Literaturhinweise:
Eßler, K.(1989): Lateinamerikas wirtschaftliche und politische Transition, in: Zeitschrift für Lateinamerika, Nr. 37, S. 7-23
Nohlen, D. (1986): Militärregime und Redemokratisierung in Lateinamerika, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 1. März 1986, S. 3-16
Nohlen, D. (1989): Mehr Demokratie in der Dritten Welt?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 17.6.1989, S. 3-18