Remesas – Rücküberweisungen aus dem Ausland – sichern Millionen Familien das Überleben und stützen die nationalen Ökonomien
Abermillionen Menschen in Lateinamerika und in anderen Gegenden unseres Planeten können nur deshalb überleben, weil Familienangehörige als Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen in den reichen Staaten unter oft widrigsten Bedingungen schuften und das verdiente Geld regelmäßig an ihre Familien zu Hause senden. Diese Geldüberweisungen (spanisch: remesas) betrugen laut Weltbank 2006 weltweit 199 Milliarden Dollar – eine Verdoppelung binnen fünf Jahren! Davon erhielten die Menschen in Lateinamerika und der Karibik 53 Milliarden Dollar. Aktuelle Schätzungen für 2007 nennen für Lateinamerika inzwischen einen Betrag von 70 Milliarden Dollar an Remesas.
Diese immensen Geldtransfers (in jeweils kleinen Summen von 150, 200, 300 oder auch 400 Dollar monatlich) sind für die Empfänger-Familien zunächst einmal im Wortsinn ein Überlebensmittel. Darüber hinaus sind sie oft auch die einzige Chance auf Teilhabe der Kinder und Jugendlichen an schulischen und beruflicher Bildung und der Familienangehörigen an einer basismedizinischen Versorgung. Die Remesas wirken aber weit über den familiären Rahmen hinaus. So manche nationale Ökonomie steht und fällt mit dem Export von Arbeitskraft. So manche staatliche Wirtschaft eines Landes der sogenannten „Dritten Welt” wäre ohne die Geldüberweisungen ihrer im Ausland schaffenden und schuftenden BürgerInnen zusammen gebrochen, wie Volkswirtschaftler erklären.
Wenn soviel Geld der kleinen Leute von Nord nach Süd transferiert wird, dann weckt das Begehrlichkeiten. Dann lässt das auch die Weltbank nicht ruhen! Sie hat in den Dollars der Armen ein „Entwicklungspotential“ entdeckt , das sie – wie manche Heimatländer der ArbeitsmigrantInnen auch – für die nationalen Wirtschaften nutzen möchte. So eine Art Entwicklungshilfe von Unten also, von den eigenen Landsleuten.
Der „Export von Arbeitskraft“, eine neue Wortschöpfung der Globalisierung, hat im Laufe der Jahre ein ungeheures Ausmaß angenommen. Einige Zahlen verdeutlichen dies. So hat in Nicaragua, dem zweitärmsten Land auf dem amerikanischen Kontinent, fast ein Viertel der arbeitsfähigen Bevölkerung die Heimat verlassen, vor allem in Richtung USA und Costa Rica. Über dreizehn Prozent der 6,8 Millionen Honduraner leben der Arbeit wegen im Ausland. Schätzungsweise zehn Millionen Mexikaner haben ihre Angehörigen auf der Suche nach Broterwerb in Richtung USA verlassen und jährlich kommen (trotz der verschärften Grenzkontrollen) etwa 500.000 hinzu. Aus dem kleinen El Salvador versuchen mindestens eine Million Menschen, in den USA – meist illegal – für sich und ihre Angehörigen daheim Geld zu verdienen.
Immer mehr Familien sind auf die Remesas ihrer Angehörigen angewiesen, vor allem eine Folge der gnadenlosen wirtschaftlichen Liberalisierung und Globalisierung und der dadurch unentwegt weiter auseinander klaffenden Schere zwischen Arm und Reich. In Mexiko erhält jetzt fast ein Fünftel der Gesamtbevölkerung regelmäßige Überweisungen aus dem Ausland, die inzwischen die – nach dem Erdöl – zweitwichtigste Einnahmequelle des Landes darstellen. Die Untersuchung einer mexikanischen Universität hat ergeben, dass die Armut in Mexiko um weitere 30 Prozent steigen würde, wenn die regelmäßigen Remesas ausblieben.
Wie Mexiko hängen auch zahlreiche andere lateinamerikanische Länder wirtschaftlich am Geldtropf ihrer ArbeitsmigrantInnen. El Salvador beispielsweise ist mit einem Rücküberweisungsanteil von 16 Prozent am Bruttoinlandprodukt (BIP) eines der Länder, in denen die Geldtransfers volkswirtschaftlich am bedeutesten sind. Aber auch in den Staaten Guatemala, Honduras und Nicaragua sind die Remesas mit weit über zehn Prozent Anteil am BIP für die Volkswirtschaft essentiell. Nach offiziellen Angaben liegen in Nicaragua die Rücküberweisungen höher als die Summe der gesamten Exporte des Staates. In zahlreichen Ländern übersteigen die Geldtransfers der eigenen Leute die von den Ländern des Nordens erbrachte Entwicklungshilfe um ein Vielfaches.
Für welche Bedürfnisse oder Zwecke geben die Angehörigen im Heimatland das Geld der Rücküberweisungen aus? „Vor allem für Nahrungsmittel“ lautet die generelle Antwort. Eine Studie in der mexikanischen Stadt León ergab, dass dort 77 Prozent der Remesas für den Kauf von Lebensmitteln verwendet wurden; 70 Prozent sind weitgehend Standard. Im Allgemeinen werden die Überweisungen vorrangig dazu genutzt, den Lebensunterhalt der Familien zu sichern, ein Mindestmaß an gesundheitlicher Versorgung der Familie und die Ausbildung der Kinder zu gewährleisten. Oft auch gilt es, vorhandene Schulden abzubauen oder die kleinen Häuser und Unterkünfte zu renovieren; seltener wird in bescheidenem Rahmen neu gebaut. Manchmal wird auch versucht, das Geld – wenn es denn reicht – als Grundlage für einen kleinen Laden, meist im informellen Sektor, zu nutzen. Mit all den dazu gehörenden Risiken.
Ökonomen, Finanzierungsfachleute sowie die Strategen der Weltbank und andere Globalisierungsbefürworter üben seit langem und zunehmend Kritik daran, dass das Geld der Remesas hauptsächlich für die grundlegenden Lebensbedürfnisse der Menschen verwendet wird und nicht primär in den `produktiven Sektor’ investiert wird. Gemeint sind damit Industrialisierungsmaßnahmen und Infrastrukturprojekte (beispielsweise Straßenbau, Energie) der Länder.
Dahinter steht die alte, aber weitgehend widerlegte These, dass nur durch Industrialisierung und die ihr entsprechende Infrastruktur die Armut sozusagen zwangsläufig beseitigt werde. Wirtschaftliches Wachstum führt nicht unausweichlich und gradlinig auch zu sozialem Fortschritt für die arme Bevölkerungsmehrheit. Das Gegenteil ist fast immer der Fall, wie z.B. die Umsetzung des Plan Puebla – Panamá (PPP) in ganz Mittelamerika von Mexiko bis Panamá beweist: Gigantische Infrastrukturmaßnahmen nehmen der Bevölkerung ihre verbliebene bescheidene Existenz in der Subsistenzwirtschaft (Eigenversorgung und Kleinhandel z.B. in der Landwirtschaft), verhindern regionale eigenständige Entwicklung, zerstören die Umwelt und schaffen so ein neues Heer von ArbeitsmigrantInnen. Diese müssen dann wiederum Remesas zum Überleben an ihre Familien schicken. Ein Teufelskreis! Menschengerechte und umweltverträgliche Entwicklung und verantwortungsvolle
Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der strukturellen Armut sehen anders aus.
Es gibt aber noch ganz andere Konstellationen im Zusammenhang mit den Rücküberweisungen: „Die Remesas werden als Mittel der Armutsbekämpfung gesehen und als Hilfsmittel zum Erreichen der von den Vereinten Nationen gesetzten Millenniumsziele“, kritisiert Karen Bähr Caballero in einem Artikel in den Lateinamerika Nachrichten das Vorhaben von Weltbank & Co.. Danach rechnen Weltbank- Experten vor, dass eine Lockerung der restriktiven Grenzkontrollen in den hochentwickelten Ländern des Nordens den Anteil von MigrantInnen der erwerbsfähigen Bevölkerung des Südens erheblich steigern würde und folglich auch die Summe der Remesas, die jetzt schon weit über der Entwicklungshilfe liegt. Im Klartext heißt das doch wohl: Viel mehr Menschen als bisher – sowohl ungelernte wie auch vor allem gut ausgebildete – sollen ihre „entwicklungsbedürftige” Heimat verlassen, im Norden fehlende Arbeitskräfte ersetzen und meist zu Dumpinglöhnen arbeiten. Und dann das erarbeitete Geld in die Heimatländer überweisen, damit dort die Entwicklung vorangetrieben wird – gemäß den Vorstellungen der Industriestaaten und der multinationalen Wirtschaftsinteressen. (Siehe die Auswirkungen von PPP – Plan Puebla-Panamá!) Wird das Ergebnis dann lauten: Millenniumsziele dank Investitionsremesas erreicht?
Die sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Migration bleiben gegenüber den finanziellen Konsequenzen im öffentlichen Bewusstsein oft im Hintergrund. Ob in Nicaragua, El Salvador oder Mexiko – in ganz Lateinamerika gibt es unzählige ländliche Gemeinden, die „ausbluten“, wie Soziologen sagen. In Mexiko gibt es Landgemeinden, in denen die Zahl der zurückgebliebenen Einwohner niedriger ist als die der ausgewanderten Männer und Frauen. Zurückbleiben die Kinder und die Alten. Oft müssen die Großeltern ihre Enkel erziehen und fühlen sich nicht selten damit überfordert. Sie sind auch vielfach nicht in der Lage, die Jugendlichen auf Gefahren wie Drogen, Waffenhandel oder kriminelle Jugendbanden vorzubereiten. So belegt z.B. eine aktuelle Studie aus El Salvador, dass die Väter vieler Jugendlicher, die zu den kriminellen Jugendbanden – den marás – gehören, Arbeitsemigranten sind.
Familien zerbrechen
Die Familien zerfallen immer rascher, auch weil die ausgewanderten Väter und Mütter wegen der immer brutaleren Grenzabschottung der USA keine Möglichkeit zu einem Besuch bei der Familie mehr sehen, ohne Gefahr für ihre Freiheit oder ihr Leben. Auf die gesellschaftlichen Probleme, die sich auch aus der familiären Desintegration ergeben, gibt es bisher kaum adäquate Antworten oder unterstützende Maßnahmen in den Gemeinden und Staaten. Zweifelsohne bestimmt die Migration auch den sozialen Charakter eines Landes.
Ein anderer Aspekt im Zusammenhang mit den Remesas und ihren Auswirkungen auf die Heimatländer betrifft die Migration von teils hochqualifizierten Männern und Frauen. Ihre Rücküberweisungen sind beachtlich, aber gleichzeitig fehlen vielerorts in der Heimat Menschen mit genau diesen beruflichen Qualifikationen. Zum Beispiel in Nicaragua: 30 Prozent der NicaraguanerInnen mit einem Universitätsabschluss leben und arbeiten laut einer aktuellen Untersuchung nicht im eigenen Land. Ihr Wissen und Können kommt der Wirtschaft eines anderen Staates zugute, nicht aber der Entwicklung ihres Heimatlandes. In seinem jüngsten Jahresbericht beklagt das Weltkinderhilfswerk UNICEF, dass beispielsweise viel zuviel medizinisches Personal aus den Entwicklungsländern auswandere. Besonders Kinder würden unter dem Brain Drain genannten Exodus der klugen Köpfe leiden, während die reichen Nationen davon profitierten. In Ghana verlassen beispielsweise innerhalb von zehn Jahren nach Ausbildungsabschluss 75 Prozent des medizinischen Personals das Heimatland.
Fazit: Die wenigen Beispiele und Informationen zeigen, wie zwiespältig die Auswirkungen der Arbeitsmigration und des Geldflusses sind. Frei von politischer Erpressung sind sie auch nicht. Drohten doch einschlägige Kreise der USA vor den Präsidentschaftswahlen in El Salvador und in Nicaragua offen damit, bei einem Wahlsieg der linksgerichteten FMLN bzw. FSLN, die Überweisungen der MigrantInnen zu unterbinden!
Der Wille, zur Entwicklung der Länder des Südens beizutragen, sieht anders aus.
—————————————–
Remesas als Hilfe zum Aufpolieren der Entwicklungshilfe-Bilanzen?
Anfang Februar meldete der internationale Pressedienst IPS, dass Regierungen reicher Industriestaaten die Idee verfolgen, Rücküberweisungen (Remesas) der Arbeitsmigranten als Gelder der Entwicklungshilfe anzurechnen. Der pakistanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Munir Akram, hatte gegenüber einem IPS-Korrespondenten von Bemühungen einzelner Industrieländer gesprochen, sich diese Auslandsüberweisungen als Entwicklungshilfe gut schreiben zu lassen. Namen nannte er nicht, betonte aber: “Sie versuchen das zu tun.“
Verwundern würde eine solch perverse Aktion zur Aufpolierung der eigenen Entwicklungshilfe-Bilanzen bei einigen reichen Nationen des Nordens nicht. Denn das von den Vereinten Nationen 1970 (!) formulierte Ziel, mindestens 0,7 Prozent des Bruttosozialproduktes für öffentliche Entwicklungshilfe auszugeben, haben 38 Jahre später mal gerade fünf Staaten erreicht: Dänemark (mit 1,06 Prozent Spitzenreiter), die Niederlande, Schweden, Norwegen und Luxemburg. Die Bundesrepublik dümpelte 2006 bei 0,36 Prozent herum.
Allerdings denkt die Bundesregierung nicht daran, Remesas als Entwicklungshilfe zu verbuchen. Auf Anfrage der Nicaragua-Zeitung erklärte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), dass es „vollkommen ausgeschlossen ist, die Leistungen von Privatpersonen als Entwicklungshilfe zu verbuchen.“ Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit könne ihrer Definition nach „nicht von Privatpersonen erbracht werden“. Dem BMZ seien auch keine derartigen Pläne anderer Geberländer bekannt, wurde mitgeteilt.
Dieser Beitrag erschien im März 2008 in der Nicaragua-Zeitung. Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung der Autorin und dem Nicaragua Verein Hamburg e.V., Herausgeber der Nicaragua-Zeitung.





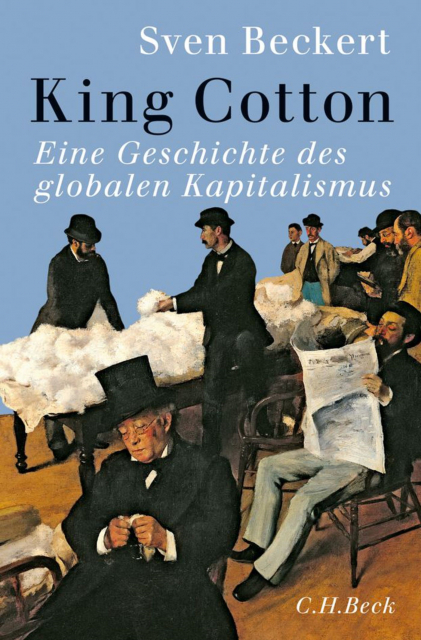
1 Kommentar