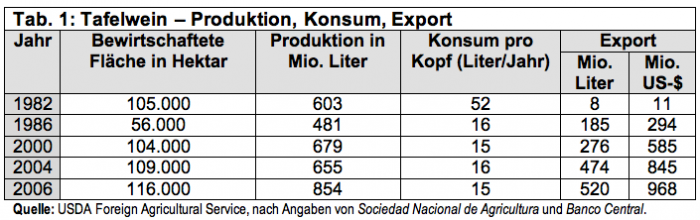Jahrelang hat der Gewerkschafter Javier Castillo vergeblich vor einem Unglück in der Mine San José gewarnt.
Copiapó – Javier Castillo hat harte Tage hinter sich, sie stehen ihm ins Gesicht geschrieben. Die Augen wirken müde, fast erloschen, die Mundwinkel sind tief nach unten gezogen, und die Stimme ist dünn. Seit dem Einsturz der Gold- und Kupfermine in der chilenischen Atacama-Wüste vor fast zwei Monaten ist der Gewerkschafter rastlos durch das ganze Land gereist. Er hat erzählt, beraten, gerechtfertigt und angeklagt. Vor ein paar Tagen erst war er im Kongress in Valparaíso und hat den Abgeordneten von den skandalösen Zuständen in vielen Minen Chiles berichtet.
Aber der schwerste all dieser Termine, bei dem es um das Schicksal der 33 Mineros in ihrem feucht-heißen Verlies geht, steht ihm erst jetzt bevor. Es ist Donnerstag, Tag 42 seit dem Unglück, und oben im „Campo Esperanza“, im Hoffnungslager gleich bei der Mine, warten Angehörige mit besorgten Gesichtern und Bergmänner in Overalls auf den Gewerkschafter. Es ist eine Art Betriebsversammlung, und sie findet in einem großen weißen Zelt statt, das sonst als Aufenthaltsraum und Speisesaal für die Angehörigen dient.
Castillo nimmt auf einer dieser langen Holzbänke Platz und hört erst einmal zu. Da sind die Klagen der anderen rund hundert Minenarbeiter von San José, denen ihr Arbeitsplatz zusammengebrochen ist, die aber dennoch jeden Morgen in voller Montur im fernen Copiapó in den Bus steigen und die gute Stunde Fahrt rauf zum Bergwerk machen. „Wir bieten unsere Arbeit an, wir wollen dem Unternehmen keinen Vorwand liefern, uns rauszuschmeißen“, sagt ein Mann mit gegerbtem Gesicht unter dem weißen Helm. So was kann in Chile recht schnell gehen.
Dann steht Castillo auf, drückt den runden Rücken durch und redet so, wie halt Gewerkschafter reden: „Die Welt feiert, dass die Kollegen, leben, aber nur wir wissen, was es wirklich heißt, da unten so lange Zeit eingeschlossen zu sein“. Jeden Satz unterstreicht er mit einer Handbewegung: „Sie sitzen im Gefängnis, ohne ein Verbrechen begangen zu haben“. Applaus erfüllt das Zelt.
Seit fast 150 Jahren ausgebeutet
Aber dann sagt der Gewerkschafter etwas, das nicht aus dem Sprachbaukasten des Arbeitnehmervertreters stammt, sondern aus dem Herzen von Javier Castillo: „Seid versichert, dass ich mich mitschuldig daran fühle, dass dieses Unglück passiert ist“. Denn der 42-Jährige war in den vergangenen Jahren so etwas wie der einsame Rufer in der Wüste, der Prediger, den niemand erhörte. Castillo ist im Vorstand der chilenischen Minengewerkschaft. Und als solcher warnte er lange vor dem Unglück schon vor den gefährlichen Zuständen in der Mine San José. Kaum jemand weiß besser um die Feuchtigkeit in dem Bergwerk, die losen Gesteinsbrocken. Schließlich hat Castillo als Bergmann zwischen 1996 und 2005 selber neun Jahre lang Gold und Kupfer aus dem harten Berg geklopft.
Und so berichtet Castillo davon, dass die Minenbetreiber sogar die Trennwände zwischen den Stollen, die einmal 30 Meter dick waren, abtragen ließen, um auch daraus noch Edelmetall zu gewinnen. Kurz vor dem Einsturz waren manche gerade noch zehn Meter dick und kaum in der Lage, den Druck der Gesteinsmassen zu halten. Wo waren die Leitern an den Notausgängen, als sie am 5. August gebraucht wurden?
Seit Jahren weist Castillo die Behörden auf die prekären Arbeitsbedingungen und fehlenden Sicherheitsstandards hin, am 1. Juli sagte er es sogar Minenminister Laurence Golborne persönlich. Zwei Tage danach fiel dem Kumpel Gino Cortés ein großer Gesteinsbrocken auf das Bein. Es konnte nur noch amputiert werden.
San José wird mit Unterbrechungen seit fast 150 Jahren ausgebeutet. Der Kupfer- und Goldgehalt ist relativ niedrig, aber dank der hohen Weltmarktpreise ist die Mine nach Angaben der Betreiber, der „Compañía Minera San Esteban“ noch viele Jahre lang lukrativ: Allein vergangenes Jahr stiegen die Kupferpreise um über 200 Prozent. Dieses Jahr steigt der Preis weiter. Die Arbeitskosten hingegen sind niedrig. Rund 1200 Dollar im Monat verdient ein Kumpel in San José, einer mittelgroßen Mine Chiles. In den gigantischen Kupferminen der Multinationalen oder des Staatskonzerns CODELCO weiter oben im Norden des Landes, verdienen die Arbeiter meist das Doppelte.
Ein Unglück wie das vom 5. August war nur eine Frage der Zeit. „San José und die Nachbarmine San Antonio haben über die Jahre mehrere Tote und viele Amputierte auf dem Gewissen“, sagt Castillo. Nachdem 2004 ein Bergmann im Bergwerk San José tödlich verunglückt war, wurde die Mine vorübergehend geschlossen. Drei Jahre später gab es ein weiteres tödliches Unglück, wieder folgte nur eine Schließung von einem Jahr. Der Druck des Unternehmens und die fehlende Kapazität der staatlichen Aufsichtsbehörde waren zu groß. „ Chile ist ein neoliberales Land, und dem Markt seine Vormachtstellung zu verweigern, ist hier ein Verbrechen“, betont Gewerkschafter Castillo. „Das Leben der Arbeiter kommt immer erst an zweiter Stelle“. 373 Kumpel sind in Chile im vergangenen Jahrzehnt bei Arbeitsunfällen in Minen ums Leben gekommen.
Betriebsversammlung unter dem Zeltdach
Seit den Zeiten der Pinochet-Diktatur (1973 bis 1990) genießen Unternehmen in Chile paradiesische Freiheiten. Sie zahlen so gut wie keine Steuern und konnten lange Zeit die natürlichen Ressourcen ausbeuten, ohne dass darauf Abgaben erhoben wurden. Erst vor anderthalb Jahren gelang es dem Parlament, einen minimalen Obolus durchzusetzen.
Seither müssen die internationalen Bergbaukonzerne, die über 70 Prozent des chilenischen Kupfers abbauen, vier Prozent ihrer Gewinne in die wissenschaftliche Forschung investieren. Mitte des Monats beschloss das Unterhaus eine schrittweise Erhöhung der Abgaben auf sieben Prozent. Ob das Gesetzesvorhaben auch die Hürde im Senat nimmt, ist unklar.
900 Kilometer vom Bergwerk San José entfernt sitzt Manuel Riesco an seinem Schreibtisch in der Hauptstadt Santiago und ärgert sich. „Die Unternehmen dürfen in Chile machen was sie wollen“, sagt der Ökonom und Experte für Bergbau am alternativen Forschungsinstitut CENDA. „Firmen können hier ihre Konditionen durchsetzen, und die Arbeiter müssen sich fügen“. Oder sich einen neuen Job suchen.
Wer den Unternehmern volle Freiheiten zugesteht, der braucht auch kaum noch eine Aufsichtsbehörde. Die Minenaufsicht Sernageomin verfügt nur über 18 Fachkräfte, denen die Kontrolle aller Minen des Landes obliegt. Eine unlösbare Aufgabe, zumal der Bergbau die Hälfte der Devisen des Landes generiert und die Politiker darauf drängen, die Unternehmen ungestört arbeiten zu lassen. Hätte die Aufsichtsbehörde ihren Job gemacht, sagt Manuel Riesco. „Dann hätten wir dieses Drama nicht“.
Die Betriebsversammlung unter dem Zeltdach ist zu Ende. Auf Javier Castillos Gesicht legt sich kurz ein Lächeln der Erleichterung. Doch dann kommt er sofort wieder auf das Thema zu sprechen, das ihm am Herzen liegt. Er denkt an die 33 verschütteten Bergleute, aber er denkt auch an die Chancen, die in dem Unglück liegen. „Jetzt ist die Möglichkeit für Veränderungen da“, sagt Castillo. Jetzt wo die Augen Chiles und der ganzen Welt auf den Bergbausektor gerichtet sind. Dann entschuldigt sich der Gewerkschafter, weil er zum nächsten Treffen muss. Aber nach ein paar Schritten bleibt er nochmal stehen, dreht sich um und ruft: „Hoffentlich lernt Chile daraus. Das Land hängt von seinen Bergmännern ab“.
——————————
Dieser Artikel erschien bereits am 24. September 2010 in der Frankfurter Rundschau. Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Autors.
Bildquelle: desierto_atacama