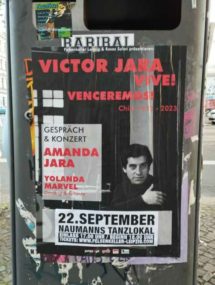Am 17. Oktober 2025 begehen die Peronisten zum 80. Mal den Día de la lealtad (dt.: Tag der Treue),
im Grunde das Jubiläum der Entstehung ihrer für das moderne Argentinien prägenden politischen Bewegung. Neben dem runden Jahrestag steht er dieses Jahr im Zeichen der für den 26. Oktober angesetzten Teilwahlen zum Kongress. Deren Ergebnis wird nicht nur das weitere Schicksal der ultraliberalen Regierung des Präsidenten Javier Milei entscheidend bestimmen, sondern auch die künftige Rolle der peronistischen Bewegung. Diese ist seit Anbeginn sehr heterogen, was im folgenden Zitat ihres Namensgebers seinen Ausdruck findet:
„Wir haben doch eine Ideologie und eine Doktrin innerhalb derer wir uns entwickeln. Einige stehen rechts innerhalb dieser Ideologie, andere links, aber sie befinden sich in dieser Ideologie. Die Rechten protestieren, weil es die Linken gibt, und die Linken protestieren, weil es die Rechten gibt. Ich weiß nicht, wer von beiden recht hat. Aber das ist eine Sache, die mich nicht interessiert. (…) Meine Mission ist die größtmögliche Zahl einzubinden, denn die Politik besitzt jene Technik: die größtmögliche Menge an zugeneigten und denkenden Menschen zusammenzuführen, hin zu den Zielen, die man verfolgt. Jeder, der so denkt oder fühlt, muss dabei sein.“[i]
Wer war Juan Domingo Perón? – Die Vorgeschichte des 17. Oktober 1945
Bevor die Ereignisse des historisch für Argentinien bedeutsamen Tages betrachtet werden, erscheint es angezeigt, die Person Peróns näher unter die Lupe zu nehmen.
Auch wenn die Gewerkschaften und die arbeitende Bevölkerung Protagonisten jenes Tages waren, war er alles andere als ein geborener Arbeiterführer. Seine Herkunft und Funktion als Militär deutet aber bereits die einzigartige Verbindung von gesellschaftlichen Gruppen an, die bis zu seinem Agieren wenig 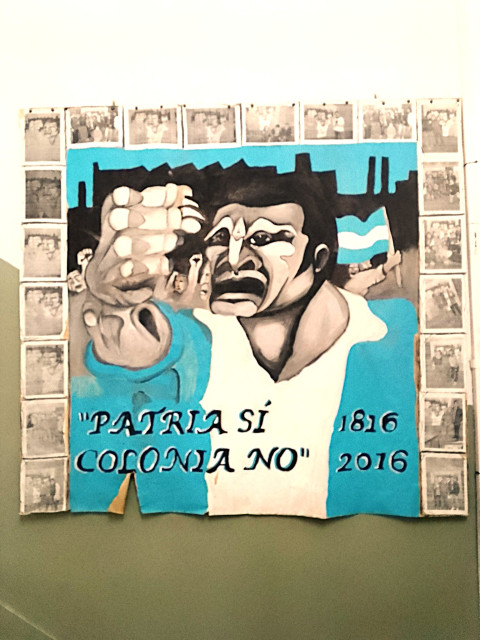 miteinander gemein hatte. Die Institution des Militärs diente bis dahin auch in Argentinien der herrschenden Oligarchie häufig zur Bekämpfung der Arbeiterbewegung, woran Perón in seiner Vergangenheit als junger Offizier auch beteiligt war, namentlich an der Repression Streikender in der sogenannten Semana Trágica – der Tragischen Woche – 1919 in Buenos Aires.
miteinander gemein hatte. Die Institution des Militärs diente bis dahin auch in Argentinien der herrschenden Oligarchie häufig zur Bekämpfung der Arbeiterbewegung, woran Perón in seiner Vergangenheit als junger Offizier auch beteiligt war, namentlich an der Repression Streikender in der sogenannten Semana Trágica – der Tragischen Woche – 1919 in Buenos Aires.
Juan Domingo Perón wurde am 8. Oktober 1895 in der Kleinstadt Lobos in der Provinz Buenos Aires geboren. Seine Familie entstammte kleinbürgerlichen Verhältnissen und war väterlicherseits italieni-scher Herkunft. Im Jahr 1900 zog sie nach Patagonien, wo Peróns Vater eine Estancia erworben hatte. Hier verlebte Juan einen Großteil seiner Kindheit. Viel Zeit verbrachte er damals mit den Gauchos, die im Dienst seines Vaters standen. Vielleicht trug diese frühe Erfahrung dazu bei, dass Perón später diesen bemerkenswerten Schwenk vollzog und sich für die Belange der Arbeiter einsetzte.
1904 schickte ihn seine Familie zu seiner Großmutter nach Buenos Aires, wo er seine schulische Ausbildung fortsetzen und abschließen sollte. Gegen den Willen seiner Familie trat er anschließend in das Colegio Militar – eine vom Militär betriebene Sekundarschule mit entsprechenden Strukturen und Abläufen im Vorort Olivos, ein. 1913 schloss er seine dortige Ausbildung als Unterleutnant ab.
Inzwischen Leutnant des Heeres geriet Perón 1919 in den Strudel der Ereignisse der erwähnten Tragischen Woche. Sein damaliges Agieren wird sehr ambivalent bewertet. Während einige Autoren seinen Einsatz in Vermittlungsmissionen zwischen Streikenden und Unternehmern hervorheben und darin eine Bestätigung seines frühen Interesses für Belange der arbeitenden Schichten sehen, betonen andere seine Rolle bei der Repression von Arbeiterprotesten. So befehligte Perón eine Kompanie, die auf streikende Metallarbeiter schoss. In den 1920ern setzte er seine militärische Laufbahn fort. So übte er an mehreren Ausbildungseinrichtungen des Heeres Lehrtätigkeiten aus.
Als Argentinien 1929 von der Weltwirtschaftskrise betroffen war, wuchs in Teilen der Bevölkerung und auch der Streitkräfte die Unzufriedenheit mit der Regierung des damaligen Präsidenten Hipólito Yrigoyen. Am 6. September 1930 kam es schließlich zum ersten Militärputsch in der Geschichte des Landes. Perón beteiligte sich aktiv an diesem Umsturz. Nach dem Staatsstreich wie auch nach den wahrscheinlich gefälschten Wahlen 1931 regierten Kräfte, die aus den Streitkräften hervorgingen oder ihnen zumindest nahestanden. Durch diese erfuhr Perón starke Förderung. So stieg er von einer Professur an der Escuela Superior de Guerra zu verschiedenen Positionen im Verteidigungs-ministerium auf. 1936 wurde er Militärattaché in Chile. 1939 schickte ihn das Ministerium schließlich zu einer Mission nach Italien. Dieser Aufenthalt war für ihn politisch sehr prägend, was in einer anhaltenden Bewunderung Mussolinis und des italienischen Faschismus seinen Ausdruck fand.
Nach seiner Rückkehr wurde er als Direktor der Ausbildungsstätte der argentinischen Gebirgstruppen in Mendoza bald wichtiges Mitglied der innerhalb der Streitkräfte operierenden Geheimorganisation GOU (Grupo de Oficiales Unidos – Gruppe der vereinten Offiziere). Des Akronym stand zugleich für das Motto der Bewegung: „Gobierno, Orden, Unidad“ (dt.: „Regierung, Ordnung, Einheit“). Diese Gruppierung, die mit den Achsenmächten Deutschland, Italien und Japan sympathisierte, spielte beim Militärputsch vom 4. Juni 1943, der mitten in einer innenpolitischen Krise stattfand, eine wichtige Rolle. In den folgenden Monaten stieg Perón, gefördert von General Edelmiro Farrell, in der Junta auf. Zunächst Staatssekretär im Verteidigungsministerium wurde er schließlich Ende jenes Jahres Leiter des neugeschaffenen Sekretariats für Arbeit und Soziales.
Dieses Amt mag auf dem ersten Blick recht unbedeutend erscheinen, sollte Perón jedoch rasch dem Aufbau einer Massenbasis dienen. Es gelang ihm, große Teile der im Dachverband CGT (Confederación General del Trabajo) organisierten Gewerkschaften auf seine Seite zu ziehen. Dies geschah mitunter durch politischen Druck, hauptsächlich aber durch Unterstützung ihrer sozialpolitischen Forderungen und in der Folge eines massiven Ausbaus des Sozialstaates.
Mit der Niederlage der Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg wurde die Situation für die Junta in Buenos Aires, die inzwischen unter Führung von Peróns Freund und Förderer Farrell stand und eine achsenfreundliche Neutralitätspolitik praktizierte, immer schwieriger. Sowohl die Alliierten als auch die liberale und linke Opposition innerhalb Argentiniens übten zunehmend Druck auf sie aus, ihre Positionen zu ändern.
Angesichts der starken Proteste verschiedener Bereiche gegen die Junta und insbesondere gegen Oberst Perón, der vielen als deren graue Eminenz galt, sah sich Farrell im extrem angespannten politischen Klima Anfang Oktober 1945 gezwungen, seinen Freund abzusetzen. Am 11. Oktober wurde dieser sogar verhaftet und auf der Insel Martín García im Río de la Plata festgesetzt.
Dies befriedete die Situation jedoch keineswegs. Ganz im Gegenteil: Argentinien stand kurz vor dem Siedepunkt. Die CGT rief ihre Mitglieder für den 17. und 18. Oktober zum Generalstreik und zu Massenmobilisierungen für die Freilassung Peróns auf.
Der 17. Oktober 1945 – ein Wendepunkt in der Geschichte Argentiniens
An jenem Tag wurde Buenos Aires von Hunderttausenden Arbeitern aus den Vorstädten und ihren Familien regelrecht überflutet. Jetzt erwies sich der Rückenhalt, den Perón bei den Gewerkschaften genoss, als entscheidender Faktor. Sehr bemerkenswert war, dass weder die Beamten der Provinz- noch die der in der Hauptstadt für die Sicherheit zuständigen Bundespolizei sie daran hinderten. Ganz im  Gegenteil zeigten die Angehörigen der Sicherheitskräfte eine große Sympathie für die Demonstranten aus der Arbeiterklasse, ein bis dahin in der Geschichte Argentiniens einmaliger Umstand.
Gegenteil zeigten die Angehörigen der Sicherheitskräfte eine große Sympathie für die Demonstranten aus der Arbeiterklasse, ein bis dahin in der Geschichte Argentiniens einmaliger Umstand.
Dieses Ereignis, das schon wenig später mit Mussolinis Marsch auf Rom verglichen wurde, machte überdeutlich, dass Peróns Anhängerschaft eine nicht mehr zu vernachlässigende Größe im Land war. Entsprechend eindrucksvoll war seine Rückkehr ins politische Leben, an der Seite seiner baldigen zweiten Ehefrau Eva Duarte, die von ihren Anhängern liebevoll Evita genannt wurde.
Zusammenfassend schreibt die Historikerin Gisela Cramer zum 17. Oktober 1945: „Peróns Triumph kam im Augenblick seiner größten Schwäche. Es ist, als habe erst seine Demütigung seine Anhänger dazu gebracht, ihn vollends als einen der Ihren zu sehen und zu lieben.“[ii]
Nach diesen Ereignissen, die Félix Luna treffend „el huracán de la historia“ nannte, setzte die Militärjunta für Februar 1946 Wahlen zum Kongress und zum Präsidentenamt an. Daraufhin bildeten sich zwei politische Blöcke, die um die Gunst der Wählerschaft warben. Auf der einen Seite stand die Arbeiterpartei Partido Laborista, die von der CGT zur Unterstützung der Kandidatur Peróns gegründet worden war. Ihr stand das Bündnis Unión Democrática gegenüber, zu dem sich die Traditionspartei UCR, Sozialisten, Demokratischen Progressisten und Kommunisten zusammengeschlossen hatten, gegenüber. Sein einziger gemeinsamer Nenner war, den Wahlsieg Peróns zu verhindern.
Die Wahl am 24. Februar endete mit einem Wahlsieg Peróns und „seiner“ Partei, die durch das damals geltende Mehrheitswahlrecht eine überwältigende Mandatsmehrheit im Kongress erhielt. Damit hatte Perón politisch ziemlich freie Hand in seiner ersten Amtszeit, an die er nach Verfassungs-änderung eine zweite anschließend konnte.
Der 17. Oktober nach 1945
Der Tag selbst wurde in den Folgejahren unter dem erwähnten Namen Día de la lealtad ein wichtiger Feiertag im peronistisch regierten Argentinien, der mit Großkundgebungen, Reden und der Akklamation der politischen Führung durch ihre Anhängerschaft gegangen wurde. Nach dem Sturz Peróns durch einen Militärputsch im September 1955 änderte sich seine Bedeutung grundlegend. In einem Land, in dem die peronistische Partei, peronistische Symbolik und selbst die öffentliche Nennung der Namen Peróns und Evitas verboten war, wurde der Tag zu einem des peronistischen Widerstandes. Von den 1950er bis in die frühen 1970er Jahren war er geprägt von illegalen Kundgebungen, großen Polizeiaufgeboten, die jedes Mal massiv mit Tränengas und Wasserwerfern vorgingen und heftigen Straßenschlachten.
Als Perón schließlich 1973 aus dem Exil in Spanien zurückkehrte und seine Bewegung bei den folgenden Wahlen erfolgreich war, kehrte der Tag noch einmal zu seiner alten Rolle zurück.
Heute, nach der vor allem auch für die peronistische Linke grausamen Militärdiktatur und vierzig Jahren teilweise konfliktreicher bürgerlicher Demokratie, ist der 17. Oktober für die Peronisten ein wichtiger Feiertag für ihre politische Bewegung über alle Spaltungen hinweg geblieben, auch um daraus Kraft für ihr weiteres politisches Wirken zu ziehen.
Literatur:
o. A.: 17 de octubre de 1945, in: Ayer y hoy. La memoria argentina, o. O., Nr. 1/1995
Colegio Nacional de Buenos Aires (Hg.): Historia de los partidos políticos argentinos. 26: Perón y el 17 de octubre: de Martín García al balcón … . Beilage der Zeitung Página12, Buenos Aires 2004
Cramer, Gisela: Perón und der Peronismus, in: Nippel, Wilfried (Hg.), Virtuosen der Macht. Herrschaft und Charisma von Perikles bis Mao, München 2000, S. 244-259
Duarte de Perón, Eva: La razón de mi vida. Buenos Aires 2004
Finchelstein, Federico: Orígenes ideológicos de la “guerra sucia”. Fascismo, populismo y dictadura en la Argentina del siglo XX. Buenos Aires 2016
Horowicz, Alejandro: Los cuatro peronismos. Buenos Aires 2005
Murmis, Miguel / Portantiero, Juan Carlos: Estudios sobre los orígenes del peronismo. Edición definitiva. Buenos Aires 2004
Luna, Félix: El 45. Crónica de un año decisivo. Buenos Aires 1999
Perón, Juan Domingo: Libro Azul y Blanco. Versión completa. Conforme a la 1ª edición de1946. Buenos Aires 2001
Rock, David: Argentina 1516 – 1987. Desde la colonización española hasta Raúl Alfonsín. Madrid 1988.
Romero, José Luis: Las ideas políticas en Argentina. Buenos Aires 2001 (19. Auflage)
Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina. Buenos Aires 2004 (6. Auflage)
Saborido, Jorge / De Privitellio, Luciano: Breve historia de la Argentina. Madrid 2006
Sebreli, Juan José: Los deseos imaginarios del peronismo. Buenos Aires 1992
Seoane, María: Argentina. El siglo del progreso y la oscuridad (1900 – 2003). Barcelona / Buenos Aires 2004
Sidicaro, Ricardo: Los nombres del poder. Juan Domingo Perón. La paz y la guerra. Buenos Aires 1996
Vázquez-Rial, Horacio: Perón. Tal vez la historia. Madrid 2005
Waldmann, Peter: El peronismo 1943 – 1955. Caseros 2009
[i] Juan Domingo Perón, 1973, zitiert nach Garrone, Valeria / Rocha, Laura: Néstor Kirchner. Un muchacho peronista y la oportunidad del poder. Buenos Aires 2003, S. 15 (Übersetzung des Autors)
[ii] Cramer, Gisela: Perón und der Peronismus, in: Nippel, Wilfried (Hg.), Virtuosen der Macht. Herrschaft und Charisma von Perikles bis Mao, München 2000, S. 248
Bildquellen: [1, 2] Quetzal-Redaktion, mceniza