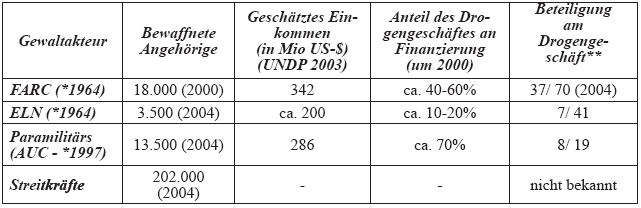Die Weltöffentlichkeit wird fast täglich mit neuen Schreckensmeldungen aus den unterschiedlichsten Weltteilen über ethnisch motivierte Gewaltkonflikte konfrontiert. Lateinamerika, sonst ein Teilkontinent der Katastrophen und Eruptionen in Natur wie in Gesellschaft, ist daran gemessen eine vergleichsweise ruhige Region. Zwar weist die lateinamerikanische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert im Vergleich zur Kolonialzeit eine Zunahme kollektiver physischer Gewalttaten auf, aber diese waren, um es vereinfacht zu formulieren und all die damit verbundenen Abgrenzungsprobleme einmal beiseite zu lassen, meist sozialer oder politischer, nicht ethnischer Art.
Dies mag überraschen, weil Lateinamerika eine in ethnischer Hinsicht hochkomplexe Region darstellt und damit zahlreiche Konflikte vorstellbar wären. Ethnische Gegensätze waren in Lateinamerika nicht erst nach 1500 verbreitet und nahmen im Zuge der Nationenbildungen seit 1800 vermutlich zu. In der Literatur finden sich vielerlei Belege für das Unverständnis, nicht selten die Aggressivität und Ungeduld, mit der die liberalen Regierungen in Lateinamerika und deren positivistisch gesonnenen Berater im späten 19. Jahrhundert „ihre“ Indianerfrage zu lösen versuchten. Große ethnische Gewaltkonflikte und vor allem ethnische Kriege blieben aber dennoch die Ausnahme oder zumindest von zweitrangiger Bedeutung. Eine Betrachtung der ethnischen Gewaltkonflikte in Lateinamerika ist deshalb immer auch kontrafaktischer Art und fordert den Vergleich mit anderen Weltregionen geradezu heraus: Warum verliefen die ethnischen Kriege in Lateinamerika im 19. Jahrhundert auf einem im Durchschnitt vergleichsweise niedrigen Niveau? Und warum fügen sie sich so wenig in das Bild prinzipieller Konflikte zwischen Kulturen, das wir aus anderen Weltgegenden kennen, sondern waren stattdessen eher pragmatischer Art? Um sich einer Antwort auf diese Fragen zu nähern, können zunächst grob zwei Konstellationen unterschieden werden, in denen es seit dem 19. Jahrhundert zur Entstehung ethnischer Kriege kam. Das Unterscheidungsmerkmal dabei ist, ob integrative oder aber dissoziative Prozesse vorherrschten. Die erste Variante umfaßt die mittlerweile bereits als klassisch geltenden Entwicklungen in Europa. Dort führte die Ausbildung der modernen Nationalstaaten im 19. Jhd. auch zur Entstehung ethnischer Nationalismen. Ethnisch motivierte Gewaltanwendungen, die von ethnisch motivierten Staatenkriegen bis hin zur terroristischen Gewaltpraxis regionalistischer Bewegungen reichen konnten und denen wir in der Gegenwart nach wie vor begegnen, waren die Folge. Die zweite Variante ist neuerer Art und ursprünglich eher in den außereuropäischen, peripheren Zonen in der südlichen Hemisphäre angesiedelt. Ihr lagen postkoloniale Entwicklungen zugrunde, in denen es zu Staatszerfallsprozessen bzw. politischen und sozialen Desintegrationen kam. Ethnische Kriege äußerten sich als Folge davon zum Beispiel als „Tribalisierungen“ (auch dieser Begriff wird kontrovers diskutiert) gesellschaftlicher Konflikte, wie in Afrika.
Führen wir uns die Ausgangssituation der modernen Nationalstaatenbildungen in Lateinamerika um 1810 vor Augen, so werden die Unterschiede schnell deutlich. Zunächst ist zu konstatieren, daß der Zerfall des spanischen Imperiums und die Krise staatlicher Herrschaft in Lateinamerika im frühen 19. Jahrhundert nicht durch eine Stärkung ethnischer Bindungen und Gemeinschaftsgefühle kompensiert wurde. Zumindest galt dies für die neuen kreolischen Führungsgruppen. Als Folge des Reichszerfalls und der Krise staatlicher Strukturen, Institutionen und Herrschaftslegitimierungen fand vielmehr eine Verlagerung staatlicher Funktionen in Herrschaftsverbände statt, die durch personale Loyalitäten integriert waren. Die caudillistischen Systeme, die damit entstanden, prägten in Lateinamerika die gesamte Übergangsphase, die zwischen dem Bruch der kolonialen Ordnung um 1810 und der nur mühsamen, immer wieder von Rückschlägen unterbrochenen Konsolidierung der republikanischen Staaten nach etwa 1860 lag. Auch blieben Ethnisierungen der Nation (der Nationsbegriff wird hier für Lateinamerika im Sinn einer damals verbreiteten regulativen politischen Idee gebraucht) in der Folge fast völlig aus.
Zwar war es in einzelnen Städten Lateinamerikas in der Phase der bourbonischen Reformen in den Kreisen zugewanderter Eliten, wie baskischer Kaufleute, zur Bildung von ethnic communities gekommen. Diese organisierten geschäftliche Vorteile, soziales Prestige und verwandtschaftliche Bindungen. Nationale Bewegungen vermochten sie aber nicht hervorzubringen, als um 1810/ 20 die politische Lösung Amerikas von Spanien anstand. Diese Funktion übernahm statt dessen mehr schlecht als recht der clanhaft organisierte kreolische Patriotismus. Dieser wies starke lokale Identifikationen auf, kannte aber kein ethnisches Gemeinschaftsempfinden. In Regionen mit überwiegend indianischen Bevölkerungen, wie in Mesoamerika oder im Andenraum, war es den kreolischen Eliten ohnehin nicht möglich, einen ethnischen Nationsbegriff glaubwürdig vorzutragen und politisch dann auch durchzusetzen. Früh legte davon der liberale Politiker und Arzt Pedro Molina Zeugnis ab, der in der Stadt Guatemala eine eigene Zeitung herausgab. 1821 und noch im Vorfeld der Emanzipation des Generalkapitanats Guatemala von Spanien ließ er darin einen indianischen Kaziken und einen spanischen Offizier ein (fiktives) Streitgespräch über die Unabhängigkeit Amerikas führen. Dabei räumte der Kazike ein, daß Guatemala in kultureller Hinsicht Spanien verwandt sei, sich aber leider aus politischen Gründen abtrennen müsse. Molina umschrieb damit bereits das ganze Dilemma des kreolischen Nationalismus. Ethnonationale Bewegungen entstanden in Lateinamerika erst spät, meist als Folge des beschleunigten sozialen Wandels im frühen 20. Jahrhundert. In diesem Zeitraum wurden sie aber in erster Linie von mittleren, aufstiegsorientierten Bevölkerungsgruppen in den Städten getragen.
Es wäre nun allerdings verkehrt, daraus den Schluß ziehen zu wollen, daß ethnische Kriege in Lateinamerika im 19. Jahrhundert gar nicht vorgekommen oder völlig bedeutungslos geblieben wären. Für die Menschen, die in diesen Kriegen töteten oder selbst umkamen, verletzt wurden, Leid zufügten und erlebten, galt das eh nicht. Ethnische Kriege gab es durchaus, freilich unter den besonderen Gegebenheiten Lateinamerikas damals und in daran angepaßter Form. Dies mag miterklären, warum Betrachter heute mitunter schwanken, ob den ethnischen Gewaltkonflikten damals der Status von Kriegen überhaupt zugesprochen werden kann.
Bei dem Begriff des ethnischen Krieges wie des Kriegsbegriffs überhaupt ist zu berücksichtigen, daß die lateinamerikanischen Staaten im 19. Jahrhundert, von Ausnahmen wie im Portalianischen Staat in Chile nach 1833 abgesehen, nicht in der Lage waren, die Ausübung kollektiver Gewalttaten dauerhaft an sich zu ziehen und entscheidend zu prägen. Kriegerische Auseinandersetzungen mußten häufig unterhalb der Ebene staatlicher Organisation geführt werden. Nur schwer entwirrbare Übergänge zwischen der kriegerischen und der nichtkriegerischen Gewalttat waren die Folge. Eine präzise Definition des Kriegsbegriffs bzw. seiner Unterform des ethnischen Krieges ist deshalb für Lateinamerika im 19. Jahrhundert recht schwierig. Eher sind es Umschreibungen, mit denen wir uns behelfen. So können wir ethnische Kriege als kollektive Gewaltkonflikte verstehen, in denen wenigstens eine der beiden Parteien sich nach ethnischen Merkmalen definierte. Die organisierte Tötungsabsicht mußte im Vordergrund der Kampfhandlungen stehen. Notwendig war ferner, daß Kombattantengruppen entstanden, deren Mitglieder einen staatlich, kulturell oder anders verfaßten Status als Krieger besaßen. Die schärfsten Ausprägungen erfuhren die ethnischen Kriege in Lateinamerika im 19. Jahrhundert in den Frontiergesellschaften, die eine Schnittmenge zwischen spanisch-kreolischen und unabhängigen indianischen Bevölkerungsgruppen bildeten. Die Frontiergesellschaften waren der Schauplatz für die massivsten ethnischen Gewaltanwendungen, die von der Vertreibungsgewalt bis zur Durchführung von ethnischen Massakern und zur Anwendung der Exterminierungsgewalt reichten. Zwar waren indianische Bevölkerungsgruppen in Amerika seit 1500 vielfach durch gezielte kriegerische Unternehmungen der Spanier oder durch die eher ungeplanten Folgen des Kontakts mit den Europäern getötet worden oder umgekommen, die Exterminierungsgewalt im Sinn eines politisch-militärischen Konzepts ist davon jedoch zu trennen. Über weite Strecken der Kolonialgeschichte hatte der spanische Staat in Amerika die Kriegsführung gegen indianische Bevölkerungen als eine abschreckende Erziehungsmaßnahme definiert. Dies änderte sich erst in der Zeit der bourbonischen Reformen. Damals begannen Regierungen im La Plata-Raum oder im Norden Mexikos, die Exterminierung indianischer Bevölkerungen als ein politisch-militärisches Konzept zu definieren und zu erörtern. Das Aufkommen des Exterminierungskonzepts stellte insofern ein Produkt staatlicher Zentralisierungs- und Modernisierungsabsichten dar, und diese Herkunft des Exterminierungskonzepts aus Wachstumsprozessen des Staates sollte auch in der Folgezeit sein wichtigstes Merkmal bleiben. Zur Anwendung konnte es deshalb erst kommen, sobald zwei Voraussetzungen erfüllt waren. Zum einen mußte der Staat über die hinreichenden Mittel verfügen, um die Option der militärischen Vernichtung indianischer Bevölkerungen Wirklichkeit werden zu lassen. Dies war auch aufgrund waffentechnischer und infrastruktureller Neuerungen (Eisenbahnbau, Telegraphenwesen) meist erst seit dem letzten Drittel des 19, Jahrhunderts der Fall. Zum anderen mußte das Exterminierungskonzept natürlich politisch gewollt und durchsetzbar sein. Dies war aber keineswegs selbstverständlich. Besonders in den Fällen, in denen die Interessen der mächtigen Familien und Clans, deren Ambitionen in der Frontiergesellschaft lagen, und die der Regierung bzw. der politischen Kreise in den städtischen Zentren auseinanderklafften, kam es darüber zu Kontroversen.
Wenden wir uns von den Grenzräumen ab und dem Hinterland Lateinamerikas zu, so stoßen wir hier auf eine andere, kleinere Form der ethnischen Kriege. Diese waren lokaler Art, wurden von einzelnen Dörfern und Gemeinwesen ausgetragen und waren primär gegen benachbarte Gemeinden gerichtet. Ein Beispiel hat Ricardo Falla in einer Studie über die Konflikte zwischen den Gemeinden Santa Maria Chiquimula und San Antonio Ilotenango, im westlichen Hochland Guatemalas gelegen, beschrieben. Ursache der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Dörfern, die zwischen ca. 1830 und 1850 eskalierten, waren ungleiche demographische Entwicklungen und weit in die Kolonialgeschichte zurückreichende Landstreitereien. Ausschlaggebend war nach Falla das Versagen juristischer Lösungen: Lange Zeit hatten die beiden Gemeinden versucht, ihre Streitigkeiten auf gesetzlichem Wege zu regeln. Erst Verschleppungen der Angelegenheit durch die koloniale Bürokratie und scheinbar völlige Inkompetenz der späteren republikanischen Verwaltung führten zum offenen Gewaltausbruch. In den mündlichen Überlieferungen in den Dörfern ist noch heute von den „Kriegen“ die Rede, die die Dorfbewohner damals gegeneinander führten. Diese kleinen ethnischen Kriege ähnelten den blutigen Streitereien zwischen, benachbarten Dörfern, wie sie auch in Europa anläßlich von Markttagen oder von Patronatsfesten immer wieder üblich waren. Sie waren deshalb aber nicht damit identisch. Vielmehr können wir in bezug auf die interkommunalen Auseinandersetzungen erst dann von ethnischen Kriegen sprechen, wenn die mangelnde Kraft des Staates, Konflikte zwischen lokalen Gesellschaften nach seinen Regeln zu lösen, und die Herauslösung der ethnischen Gemeinwesen aus der vom Staat beanspruchten Zuständigkeit zusammenfielen. Oder anders formuliert: Die Dörfer und Gemeinwesen (comunidades) mußten, anders als in der Kolonialzeit, die Legitimation der Regierungen und die Autorität und Schlichterfunktion des Staates nicht mehr anerkennen. Bei den ethnischen Kriegen in Lateinamerika im 19. Jahrhundert fällt auf, daß sie in beträchtlichem Maße klientelar steuerbar waren. Überwiegend stellten sie keine Prinzipienkonflikte, Kulturenoder Zivilisationenkriege dar. Zwar suggerierte die politische Rhetorik dies immer wieder, sobald eine gewaltsame Auseinandersetzung stattfand. Tatsächlich blieben aber die politischen Interessenlagen gesellschaftlicher Teilgruppen, wie zum Beispiel der mächtigen Clans in den Frontiergesellschaften, sowie die verfügbaren Ressourcen und Mittel des Staates dafür ausschlaggebend, ob klientelare Einbindungen ethnischer Gruppen und Gemeinwesen in die „Nation“ gelangen oder aber abgebrochen werden mußten. Erst im zweiten Fall war der Weg für kriegerische Gewalthandlungen offen.
Bei der Betrachtung ethnischer Konflikte wird in der Literatur nach wie vor häufig mit Modernisierungstheorien gearbeitet. Eine „Modernisierung“ kollektiver Gewaltformen und Gewaltmodalitäten hatte in der europäischen Geschichte die Ausbildung eines zumindest vorübergehend stabilen staatlichen Gewaltmonopols zur Voraussetzung. Dazu kam es in Lateinamerika im 19. Jahrhundert (und in der Regel bis heute) jedoch nicht, so daß auch die kollektiven Gewaltphänomene dort andere Verläufe nahmen. Vor allem wäre es ein Irrtum zu glauben, daß die Verlagerung der ethnischen Gewaltanwendungen aus lokal geprägten, vergleichsweise überschaubaren und nur gering organisierten Gruppen in sekundäre, stärker ausdifferenzierte, komplexere Organisationssysteme und die damit verbundene Zunahme an Steuerung und Rationalisierung der Gewaltpraxis deren Ausmaße eingeschränkt oder „unnötige“ Grausamkeiten vermieden hätte. Eher scheint das Gegenteil der Fall gewesen zu sein: Der Verlust der Möglichkeit, ethnische Konflikte über vergleichsweise überschaubare, lokal geprägte klientelare Netze zu steuern, wirkte gewaltfördernd. Umgekehrt trugen vom Staat geplante, kontrollierte und inszenierte Gewaltanwendungen zu ethnischen Gewaltsteigerungen bei. Zumindest in diesem Punkt waren die ethnischen Kriege in Lateinamerika recht „europäisch“.
Der Autor ist Historiker, Professor für Geschichte Iberoamerikas am Historischen Seminar der Universität Leipzig
————————————————-
Vgl. ausführlich zu diesen Überlegungen Michael Riekenberg: Ethnische Kriege in Lateinamerika, Stuttgart 1997. Ferner möchte ich hinweisen auf den demnächst im Bühlau-Verlag erscheinenden Sammelband Politische und ethnische Gewalt in Südosteuropa und in Lateinamerika im Vergleich. Herausgegeben von Wolfgang Höpken und Michael Riekenberg.
Escritos del Doctor Pedro Moiina. Conteniendo la reproducción integra de los escritos del primer semestre del periódico El Editor Constitucional. Bd. l. Guatemala 1969, S. 644, S. 655. Ricardo Falla: Actitud de los indigenas de Guatemala en la Epoca de la independencia 1800-1850. In: Estudios Centroamericanos 278 (1971), S. 702-718.