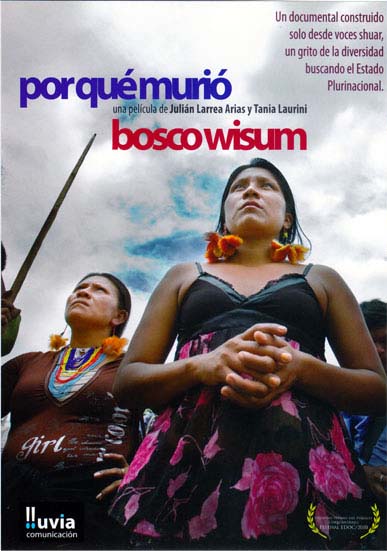Statistische Schätzungen besagen, daß im Jahr 2000 die Zahl der Maya auf zehn Millionen angewachsen sein wird. Hinter dieser dürren Aussage verbirgt sich eine Reihe von Fragen und Problemen. Dies beginnt bereits bei den Zahlen selbst. Schließlich sind die Statistiken Guatemalas, wo die Mehrzahl aller Maya beheimatet ist, nicht gerade für ihre Zuverlässigkeit bekannt. Wenn man zudem bedenkt, daß der letzte landesweite Zensus 1981 vorgenommen und dort die indianische Bevölkerung lediglich mit etwas mehr als 2,5 Millionen beziffert wurde, dann kann man ermessen, wie unsicher derartige Angaben sind. Stellt man sich die Frage, nach welchen Kriterien über die ethnische Zugehörigkeit entschieden wird, gerät man noch mehr ins Grübeln. Schließlich und endlich muß man sich mit dem Problem auseinandersetzen, was die Maya eigentlich darstellen – eine Gruppe indianischer Ethnien, deren Vorfahren einst als „Griechen Amerikas“ galten, die heute aber nur noch die linguistische Verwandtschaft eint, oder bereits ein pueblo maya – ein Maya-Volk, wie im „Abkommen über Identität und Rechte der indigenen Völker“ zwischen der guatemaltekischen Regierung und der Guerilla-Organisation URNG vom 31.3.1995 vermerkt. Beginnen wir mit den (halbwegs) sicheren Angaben. In Mittelamerika gibt es 28 (nach anderen Angaben 30) Maya-Sprachen, davon 21 in Guatemala, 12 in Mexiko, 3 in Belize und eine in Honduras – einige durch Ländergrenzen zerschnitten. Die zahlenmäßig größten Ethnien sind K’iche\ Mam, Q’eqchi‘ und Kaqchikel mit jeweils mehr als einer Million Angehörigen. Zwischen mehreren Hunderttausend und einigen Zehntausend liegt die Zahl derjenigen, die Q ‚anjob ‚al, Tz’utujil, Ixil, Poqomchi‘, Poqomam oder Achi (in Guatemala), Yucateco (in Mexiko und Belize), T-otzil, Tzelial, Chol oder Huasteco (in Mexiko), Jakalteko oder Chuj (wie Main in Guatemala und Mexiko beheimatet) sprechen. Mit 60% Anteil der Maya an einer (geschätzten) Gesamtbevölkerung von 11 Millionen gilt Guatemala nicht nur als „Kerngebiet“ der Maya-Bevölkerung, sondern zugleich als das „am meisten indianische Land Amerikas“. Sieht man von den herkömmlichen technischen Schwierigkeiten statistischer Erhebungen ab, so kreisen die oben aufgeworfenen Fragen um das Problem der Identität. Hier muß man berücksichtigen, daß gerade in den letzten Jahren unter den guatemaltekischen Maya eine Verschiebung .und Neubestimmung im Gange ist, die auf die Nachbarländer ausstrahlt und ihrerseits durch den Aufstand der Zapatisten in Chiapas zusätzlich stimuliert wird.
Die Identitätsfindung der Maya wird durch mehrere Faktoren bestimmt und hat verschiedene Etappen durchlaufen. Als Opfer der spanischen Conquista und per Definitionsmacht der siegreichen Kolonialherren wurde die ursprüngliche Vielfalt der indianischen Urbevölkerung Lateinamerikas in die graue Masse der Indios verwandelt, die lediglich als Quelle von Tributen, Steuern, Arbeitskräften und Agrarprodukten von Interesse war. Anfangs ausschließlich verächtlich, diskriminierend und rassistisch gemeint, erhielt der Begriff des indio mit dem Indigenismus und der Glorifizierung der indianischen Vergangenheit im 20. Jahrhundert eine modernistische und zugleich romantisierende Note. Diese Außensicht blieb jedoch seitens des Staates und seiner indigenistisch begründeten Assimilierungspolitik insofern der traditionell paternalistischen und kolonialistischen Grundhaltung verhaftet, als daß die indios für den angestrebten Modernisierungskurs ein „Problem“ darstellten, dessen Lösung in der „Zivilisierung“ (sprich: Assimilierung) der indianischen Bevölkerung zu suchen war. Mit Gewalt und Akkulturation entledigten sich die meisten zentralamerikanischen Staaten ihres „Indioproblems“ und führten die mestizische Nationenbildung so zu einem zweifelhaften Erfolg. Reduziert und marginalisiert umfaßt die indigene Bevölkerung dort einen Anteil, der trotz einer gewissen „indianischen Renaissance“ zu Beginn der 90er Jahre unter 10% liegt. In Guatemala hat der „ladinozentristische* Entwicklungsweg“ in die Sackgasse des Bürgerkriegs geführt. An dessen Ende mußte die Regierung des Landes im oben genannten Abkommen erstmals den multiethnischen, plurikulturellen und mehrsprachigen Charakter der Nation eingestehen.
Entscheidend für das Scheitern der mestizischen Nationenbildung in Guatemala war der Überlebenswille der Maya. Als organisatorische Grundlage der von ihnen praktizierten „Kultur des Widerstands“ fungierte die Dorfgemeinschaft. Unter ihrem Dach überlebten zahlreiche Elemente der ursprünglichen Maya-Kultur, die sich mit kolonial-spanischen Einflüssen, Praktiken und Institutionen vermischten. Die Sprache, eine auf Harmonie zwischen Mensch und Natur gerichtete Weltsicht, die Verehrung der Vorfahren, traditionelle Rechtssprechung, wichtige religiöse und historische Überlieferungen sind das lebendige Erbe der alten Maya. Obwohl die Anhänger der traditionellen Lebensweise (costumbristas} unter dem Druck der katholischen Kirche und evangelischer Sekten an Einfluß verloren haben, sind der rituelle Maya-Kalender (tzolkiri), eine eigene Priesterschaft (chuchkajau oder ajk’ij), Heiligenverehrung und Bruderschaften (cofradias) fester Bestandteil der kulturellen Identität der heutigen Maya. Aus den Reihen der cofradias, die sich gleichermaßen dem Dienst an den Ortsheiligen wie an der Gemeinschaft verschrieben haben, gehen die Ältesten (principales) hervor, die nach wie vor als »politische und spirituelle Führer Anerkennung finden.
Anders als noch in den 50er und 60er Jahren vor allem von nordamerikanischen Anthropologen und Ethnologen prognostiziert, hat der beschleunigte Modernisierungsprozeß nicht zu einer umfassenden „Ladinisierung“ der Maya, d.h. zur Preisgabe der ursprünglichen Identität, geführt. Der von außen (Staat, Kirche, Bildungswesen) in dieser Richtung ausgeübte Druck hat vielmehr das Gegenteil bewirkt. So haben zwar viele zeitweilig oder dauerhaft die Dorfgemeinschaft verlassen (müssen). Wie aber beispielsweise eine Studie über die Q’eqchi‘ belegt, haben sie in dem fremden und oft feindseligen Milieu (Stadt, ladinos) ihre Identität auf höherer Stufe bewahren und festigen können: statt sich wie früher über den Herkunftsort zu definieren, verstehen sie sich nun bewußt als Mitglieder einer Sprachgruppe bzw. Ethnie.
Dieser Identitätswandel hängt eng mit einem Politisierungsprozeß zusammen, der mit der Revolution von 1944-54 eingesetzt und die Maya im Kampf gegen die Diktatur Ende der 70er Jahre massenhaft an die Seite der Guerilla geführt hat. In einem blutigen Genozid, der seinen Höhepunkt 1980-83 hatte, wurden mehr als 400 indianische Dörfer zerstört und zehntausende Maya ermordet. Obwohl das politisch-militärische Bündnis mit der Guerilla daraufhin zerbrach, schlugen sich das gewachsene Selbstbewußtsein, die enttäuschten Hoffnungen und die harten Erfahrungen des Kampfes in der Geburt eines „Maya-Nationalismus“ und einer Pan-Maya-Bewegung nieder. In zahlreichen neugegründeten Organisationen und Institutionen begannen die Maya mit Beginn der Demokratisierung erstmals als eigenständige Kraft zu agieren.
Ungeachtet aller Fortschritte sind die Maya gesellschaftlich weiterhin marginalisiert und benachteiligt, auf staatlicher Ebene noch immer unterrepräsentiert und organisatorisch zersplittert. Zu 80% auf dem Lande lebend ist ihre Lebenserwartung gering (45 Jahre statt des nationalen Durchschnitts von 62), ihr Analphabetismus am höchsten (drei Viertel aller indianischen Frauen sind davon betroffen und von 100 Schülern sind nur 25 indigenas) und ihre Armut am größten. Während sich die „soziale Tendenz“ unter den Maya-Organisationen auf die Lösung dieser Probleme konzentriert und sich als Teil der Volksbewegung begreift, geht es der „kulturellen Tendenz“ vor allem um die Anerkennung und den Schutz der Maya-Identität. Hier deutet sich ein grundlegender Identitätswandel an, der mittel- und langfristig das gesamte Land vor neue Herausforderungen stellt. Inzwischen verfügen die guatemaltekischen Maya über eigene Intellektuelle sowie Führer von nationaler und internationaler Ausstrahlung, die als Träger und Sprachrohr einer Maya-Identität auftreten, welche über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie hinausgreift und diese in ihrer Gesamtheit als Teile eines gemeinsamen Maya-Volkes (pueblo mayd) versteht. Gerade die ethnisch-kulturelle Vielfalt der Maya wird von den Gegnern des „Pan-Mayaismus“ bemüht, um diesen Gedanken ad absurdum zu führen. Dessen Protagonisten machen im Gegenzug die Gemeinsamkeiten aller Maya-Herkunft, kulturelles Erbe, Geschichte, gesellschaftliche Ausgrenzung und Weltanschauung (cosmovisión) – geltend. Für sie ist das subjektive Bekenntnis als Maya ausschlaggebend. Die Maya-Intellektuellen wirken dabei nicht nur als Stifter nationaler Identität, sondern auch und vor allem als deren Propagandisten. Sie wiederholen damit die Erfahrungen des osteuropäischen Nationalismus. Identitätsstiftend im Sinne eines Maya-Nationalismus wirkt besonders die Abgrenzung gegenüber den ladinos, die von den Maya traditionell als Fremde, Unterdrücker, Betrüger und Ausbeuter wahrgenommen werden. Als Produkt biologischer Vermischung und kultureller Assimilation verleugneten diese ihr indianisches Erbteil und seien deshalb ihrer Identität nicht sicher. Die wachsende Unsicherheit unter den ladinos drückt sich auch in einer unbestimmten Furcht vor dem Anwachsen indianischen Selbstbewußtseins aus. Hohe Militärs und Teile der Presse gießen noch Öl ins Feuer, indem sie mit Blick auf die Autonomieforderungen der Maya „ethnische Kriege“ und die Gefahr der „Jugoslawisierung“ herbeizureden suchen. Wie auch immer die Maya in Zukunft ihre Identität bestimmen werden, der einmal erreichte Grad an Selbstbewußtsein läßt sich weder ignorieren noch rückgängig machen. Ob sie auf ihrem langen Marsch der Selbstfindung tatsächlich zur Maya-Nation reifen, liegt in ihren Händen. Welchen Weg das pueblo maya dabei nehmen wird, hängt nicht zuletzt von der Lernbereitschaft des pueblo ladino ab. Eines ist jedoch gewiß: Ohne die Maya oder gar gegen sie ist in Guatemala kein Staat mehr zu machen.
————————————-
*Ladino ist ein Begriff, der aus der Kolonialzeit stammt und mit dem all jene bezeichnet wurden, die – anders als die Indios – keiner festen Gemeinschaft angehörten und die im Unterschied zu den Spaniern oder Criollos (in Amerika geborene Europäer) kein Land besaßen und kein Amt in der Kolonialadministration innehatten. Heute bezieht er sich vor allem auf den Teil der Bevölkerung, der mestizischen Ursprungs ist und weder zur indianischen noch zur afro-karibischen Volksgruppe zählt. Da ladino zugleich als Synonym für die rassistische Diskriminierung der Maya gilt, bezeichnen sich neuerdings immer mehr Angehörige dieser Bevölkerungsgruppe als mestizo (Mestize).