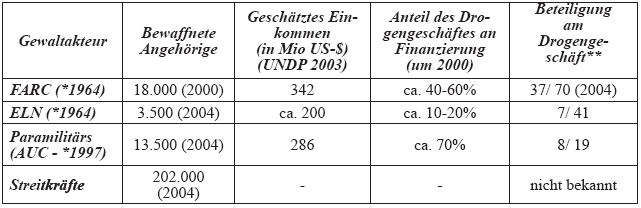Das Jahr 1968 scheint für Lateinamerika nicht jene herausragende Bedeutung zu haben wie für Europa. Studentenunruhen waren für den in der westlichen Hemisphäre gelegenen Kontinent seit der Revolte von 1918 in Argentinien fast schon Normalität und im lateinamerikanischen Kalender des 20. Jahrhunderts haben andere Jahreszahlen ein größeres Gewicht. Die Revolutionen von 1910 (Mexiko), 1952 (Bolivien), 1959 (Kuba) und 1979 (Nikaragua) sind ebenso wie die USA- Interventionen der 20er (Mittelamerika und Karibik), 50er (Guatemala), 60er (Kuba, Dominikanische Republik) und 80er Jahre (Nikaragua, Grenada, Panama) und die Militärputsche von 1964 (Brasilien), 1968 (Peru) und 1973 (Chile) Ereignisse von kontinentalem, in einigen Fällen (Mexiko, Kuba, Chile, Nikaragua) auch von internationalem Rang. 1968 stand für die Dritte Welt ebenso wie in der Ost-West-Auseinandersetzung Vietnam im Brennpunkt der Auseinandersetzungen. Europa selbst befand sich im Banne des Pariser Mai-Aufstands und des Prager Frühlings, die beide auf höchst unterschiedliche Weise die in sie gesetzten Hoffnungen denn doch nicht zu erfüllen vermochten. In Gestalt des zur Legende gewordenen Ché war Lateinamerika jedoch aufs engste mit Vietnam, Prag und Paris verbunden. In einer Botschaft an die Völker der Welt hatte er 1967 gefordert, „zwei, drei, viele Vietnams“ (Ché Guevara 1985:355) zu entfachen, um den Imperialismus durch einen weltumgreifenden Aufstand der „Verdammten dieser Erde“ (Fanon 1986) zu besiegen. Er selbst kämpfte im Kongo und in Bolivien für dieses Ziel. Spätestens seine Ermordung am 9. Oktober 1967 im bolivianischen La Higuera unter aktiver Beteiligung der CIA machte ihn zum Idol der Pariser Studenten und seine Ansichten fanden Eingang in die 68er Bewegung.
Man weiß zwar nicht, wie er auf die militärische Niederwerfung des Prager Frühlings reagiert hätte. Aber seine herbe Kritik an der Sowjetunion und den sozialistischen Staaten Osteuropas auf dem Wirtschaftsseminar der Afro-Asiatischen Solidarität Anfang 1965 in Algier, die er der Aufgabe des revolutionären Internationalismus zieh (Che Guevara 1985:341 ff.), verdeutlicht ebenso wie sein Konzept vom „hombre nuevo“, dem „neuen Menschen“, wie tief die Gräben zwischen seinem revolutionären Idealismus und der „sozialistischen“ Realität im Zeichen des Sowjetsterns schon waren.
Die Ereignisse in den drei Epizentren des Aufbruchs von 1968 in Ost (Prager Frühling), West (Pariser Mai) und Süd (Vietnam), die bis heute unsere Erinnerungen an jenes stürmische Jahr prägen, überstrahlen auch die mehr unterschwelligen Veränderungen in Lateinamerika. Mit der Niederlage Ché Guevaras in Bolivien schienen auch die Hoffnungen auf ein zweites Vietnam, diesmal vor der Haustür der USA, begraben. Im Rückblick wird deutlich, daß das Jahr 1968 für diese Region eher den Charakter einer „verdeckten“ Zäsur hat, in der unterschiedliche Bewegungen und Prozesse zusammenlaufen oder durch sie ausgelöst werden. Der Begriff „Schaltjahr“ entspricht wohl noch am ehesten dieser Bedeutung von 1968 als Weichenstellung und Wendepunkt kontinentaler Entwicklungen, die erst später im chilenischen Weg zum Sozialismus, in der Errichtung reaktionärer Militärdiktaturen auf dem Südkonus und schließlich in der nikaraguanisachen Revolution ihren sichtbaren Ausdruck fanden.
Die Niederlage und der Tod Ernesto Ché Guevaras in Bolivien sind gerade heute Gegenstand widerstreitender Interpretationen, deren Kern an die Frage rührt, welche Chancen Revolution in Lateinamerika im Allgemeinen und 1968 im Speziellen hat(te). Der Bedeutung des Jahres 1968 folgend, stehen drei Aspekte dieser komplexen und komplizierten Frage im Mittelpunkt dieses Beitrages, ohne daß hiermit der Anspruch verbunden wäre, der Wahrheit letzten Schluß zu verkünden. Der Einordnung des lateinamerikanischen „68″ in die internationale Situation jener Zeit soll die historische Verortung im lateinamerikanischen Kontext folgen, um dann abschließend einen Ausblick auf mögliche Perspektiven dreißig Jahre danach zu wagen.
Hoch oder Tief auf der globalen Wetterkarte?
Aus der Sicht des revolutionären Antiimperialismus jener Jahre hielten sich damals Hoch und Tief im internationalen Geschehen die Waage. In die erste Hälfte des Jahres 1968 fielen so hoffnungsvolle Ereignisse wie die erfolgreiche Frühjahrsoffensive der südvietnamesischen Nationalen Befreiungsfront, die sich zum Generalstreik ausweitenden Studentenunruhen in Frankreich und die durch den Prager Frühling getragenen Reformhoffnungen in Osteuropa. Im Osten, Westen und Süden schien die Welt im Umbruch. Daran gemessen durchlebte der „weltrevolutionäre Prozeß“ in Lateinamerika eher eine durch Unruhe und Unsicherheit geprägte Atempause.
Andere Weltgegenden verbreiteten einen größeren revolutionären Schwung als die „Neue Welt“. Vietnam stand im Brennpunkt des als antiimperialistisch verstandenen Kampfes der Völker der Dritten Welt. Die Weltmacht USA war eben mit ihrer „zweiten strategischen Gegenoffensive“, an der sich 1,2 Millionen Soldaten (darunter 500.000 Nordamerikaner) beteiligt hatten, gescheitert und der nordvietnamesische Ministerpräsident Pham Van Dong sprach erstmals davon, daß „sich das Ende des Krieges abzuzeichnen beginnt“ (Lulei 1969:62); eine Einschätzung, die durch die überraschende und erfolgreiche Tet-Offensive vom 30. Januar nachhaltig unterstrichen wurde. Die USA kamen nun nicht mehr umhin, sich mit den Nordvietnamesen in Paris an den Verhandlungstisch zu setzen. Auch wenn der Krieg erst 1975 mit der Wiedervereinigung Vietnams unter sozialistischen Vorzeichen endete, so wurden doch 1968 die Weichen dafür gestellt.
In gewisser Weise sollten sich sogar später die Worte Che Guevaras, der den USA mehrere Vietnams in Lateinamerika prophezeit hatte, erfüllen. Die Nordamerikaner glaubten ihrem durch die schmähliche Niederlage in Südostasien verursachten Vietnam-Trauma gerade in Lateinamerika entrinnen zu können. Die von Präsident Reagan in El Salvador in den 80er Jahren betriebene konterrevolutionäre Politik geriet zwar zum größten Counterinsurgency – Einsatz der USA nach Vietnam, ohne jedoch den erwarteten Erfolg zu zeitigen.
In der militärischen Besetzung der kleinen Karibikinsel Grenada (1983) und der Intervention in Panama (1989) glaubten die Nordamerikaner dann die bessere Medizin gegen ihr Vietnam-Syndrom gefunden zu haben. Aber auch aus der Sicht der Revolutionäre bestätigte sich weder in den 60er noch in den 80er Jahren die Hoffnung auf einen Sieg ä la Vietnam in Lateinamerika. Dennoch hatten die zentralamerikanischen Guerilla-Bewegungen erstmals seit Kuba gezeigt, daß der „Koloß im Norden“ selbst in seinem unmittelbaren Hinterhof vor erfolgreichen Revolutionen nicht sicher ist. Zur historischen Wahrheit gehört ebenfalls, daß die Sandinisten 1990 von der Regierung durch eine Mehrheit des nikaraguanischen Volkes abgewählt wurden und die salvadorianische FMLN sich vom bewaffneten Kampf verabschieden mußte, ohne die Macht auf diesem Weg erobert zu haben. Inzwischen mußten sich auch die militärisch erfolgreichen Vietnamesen mit der übriggebliebenen Supermacht USA arrangieren.
Will man den Erfolg der nationalen Befreiungsbewegungen der Dritten Welt um das Jahr 1968 in seiner regionalen Differenziertheit bemessen, dann lag Lateinamerika – etwas salopp ausgedrückt – auf der antiimperialistischen Erdbebenskala zwischen dem erfolgreichen Vietnam und dem vom israelischen Sieg 1967 unangenehm überraschten Nahen Osten. Kuba litt zwar unter dem US-Embargo, war aber weder politisch noch – wie 1961/62 – militärisch unmittelbar gefährdet. Weniger positiv fiel die Bilanz auf dem übrigen Kontinent aus.
Obschon die von Fidel Castro unterstützte Guerilla in fast allen Ländern Lateinamerikas aktiv geworden war, rollte diese Welle aus, ohne ein weiteres Regime gestürzt zu haben. Sein engster Kampfgefährte Ernesto Che Guevara hatte seinen Traum von der kontinentalen Revolution mit seinem Leben bezahlt, ohne daß ihm ein sichtbarer Erfolg beschieden gewesen wäre. Lateinamerika 1968 – also ein bedeutungsloses Jahr im Kalender der antiimperialistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts?
Auf halbem Weg von Kuba nach Nikaragua
Die eigentliche Bedeutung jenes Jahres enthüllt sich erst auf den zweiten Blick, wenn man es in den historischen Gesamtprozeß Lateinamerikas einordnet. In der Langzeitperspektive des lateinamerikanischen Revolutionszyklus liegt 1968 genau zwischen den beiden einzigen Revolutionen, in denen unter den Vorzeichen sozialistischer Orientierung Linke die Macht erobern konnten: zwischen Kuba 1959 und Nikaragua 1979. Aus dieser Perspektive ist 1968 ein Schaltjahr zwischen zwei siegreichen Revolutionen. In dieses Bild fügt sich auch ein, daß die Niederlagen der ländlichen Guerilla in Venezuela, Peru, Nikaragua, Guatemala und Bolivien durch den Aufschwung der Stadtguerilla in Uruguay (Tupamaros) und Argentinien (Montoneros) wenigstens partiell kompensiert wurden.
Während jedoch in Südamerika der bewaffnete Kampf außer in Kolumbien und Peru in den 80er Jahren anderen Strategien weichen muß, nimmt er in Zentralamerika während der 70er Jahre einen deutlichen Aufschwung und weitet sich in den 80er Jahren schließlich zum Regionalkonflikt aus. Auf dem Isthmus waren unter dem Eindruck der kubanischen Revolution in Nikaragua (1959) und Guatemala (1960) bewaffnete Widerstandsbewegungen entstanden, die in der ersten Hälfte der 60er Jahre mehr (Guatemala) oder weniger (Nikaragua) erfolgreich gegen die dortigen Diktaturen kämpften.
In Guatemala leitete der Militäraufstand vom 13. November 1960, der in seiner unmittelbaren Zielsetzung (Sturz der antikubanisch eingestellten Regierung Ydigoras) gescheitert war, die bis 1996 währenden Auseinandersetzungen zwischen Guerilla und Regierung ein. Die illegal ins Land zurückgekehrten Meuterer, unter ihnen die später legendären Guerilla-Comandantes A. Yon Sosa und T. Lima, schlössen sich im Dezember 1962 mit den bewaffneten Abteilungen der Kommunistischen Partei des Landes (PGT) und aufständischen Studenten zu den Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR; dt.: Rebellenstreitkräfte) zusammen. Nach ersten Erfolgen (bis 1966) gestaltete sich die Geschichte der guatemaltekischen Guerilla äußerst wechselhaft: Schon im Juni 1964 kam es zu einer ersten Spaltung, bis Mitte 1967 vereinigten sich die Guerillaverbände erneut unter dem Dach der FAR, um sich dann Anfang 1968 von der KP zu trennen. 1971 folgte dann ein erneuter Schulterschluß mit dem PGT, der die FAR aber die Abspaltung einer Gruppe um G. Ilom kostete, aus der später die Organizacion del Pueblo en Armas (ORPA; dt.: Organisation des Volkes in Waffen) hervorging. Neben FAR und ORPA hatte sich um den ehemaligen FAR-Chef C. Montes mit dem Ejercito Guatemalteco de los Pobres (EGP; dt.: Guerillaheer der Armen) Anfang der 70er Jahre eine dritte Guerillaorganisation gebildet. Alle drei schlössen sich 1982 zur Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG; dt.: Guatemaltekische Nationale Revolutionäre Einheit) zusammen.
In Nikaragua war 1960 die Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN; dt.: Sandinistische Nationale Befreiungsfront) gegründet worden, um den bewaffneten Kampf gegen die Somoza-Diktatur in Nikaragua aufzunehmen. Verschiedene Versuche, von Honduras aus einen Guerilla-Focus aufzubauen, scheiterten jedoch meist schon frühzeitig. 1963/64 gab es an den Flüssen Coco und Bocay die ersten direkten Kämpfe mit der Nationalgarde. 1967 erlitten die Sandinisten dann in Pancasan den härtesten militärischen Rückschlag der 60er Jahre. Es hatte sich gezeigt, daß die notwendigen Bedingungen für einen erfolgreichen Guerillakampf noch nicht gegeben waren. Die Sandinisten konzentrierten sich folgerichtig auf die Akkumulation ihrer politischen und militärischen Kräfte. Erst im Dezember 1974 trat die FSLN mit einer erfolgreichen Kommandoaktion in Nikaragua wieder an die Öffentlichkeit, die sich als Präludium des 1977 eingeleiteten Sturzes der Diktatur erweisen sollte.
Die Entwicklung beider Länder belegt, daß dem Jahr 1968 eine Scharnierfunktion zwischen der kubanischen Revolution 1959 und der nikaraguanischen Revolution 1979 zukommt. Jenes Jahr bildet den Umschlagpunkt zweier Wellen des bewaffneten revolutionären Kampfes in Lateinamerika. Die Niederlagen von 1967 (Bolivien, Nikaragua) und 1968 (Guatemala) leiten jenen Prozeß der Reorganisation und Neuorientierung der Guerilla ein, der 1979 in den sandinistischen „Völkerfrühling“ (R. Arismendi) und die Revolutionsversuche in El Salvador und Guatemala mündet. Die revolutionäre Linke beginnt sich von den falschen, weil mechanistischen Interpretationen der kubanischen Erfahrungen zu trennen. Sie hatte im Ergebnis bitterer Niederlagen erkennen müssen, daß die Kenntnis des eigenen nationalen Terrains (A. Gramsci) das conditio sine qua non eines erfolgreichen Kampfes ist. Die militante Linke im Süden des Kontinents zog aus der Niederlage der ländlichen Guerilla zuvörderst die Schlußfolgerung, daß unter den Bedingungen der Militärdikatur die Stadtguerilla den adäquaten Weg zur Machteroberung weise. Während diese Versuche in Brasilien schon frühzeitig unter der brutalen Repression der Generäle zusammenbrechen, haben die Tupamaros in Uruguay und die Montoneros in Argentinien zunächst mehr Erfolg. Aber auch sie scheitern letztlich in den 70er Jahren mit ihrer Revolutionsstrategie.
Obwohl nach dem blutigen Sieg der Konterrevolution in Chile 1973 noch einmal der bewaffnete Kampf in den Andenländern auflebt, mündet der antidiktatorische Kampf nicht – wie in Zentralamerika – in die Volksrevolution, sondern in die Demokratisierungsprozesse der 80er Jahre. Stand die Entwicklung bis 1967 noch unter dem Motto der bewaffneten kontinentalen Revolution, kommt es ab 1968 zu einer von den nationalen und regionalen Bedingungen diktierten Auffächerung der Wege und Strategien der lateinamerikanischen Linken, die allzu oft in Grabenkämpfen endet. 1968 gabelt sich der Weg und mündet in Zentralamerika in die Revolution, während er – teilweise über Um- und Seitenwege – in den meisten Ländern Südamerikas zum Abdanken der Militärdiktaturen und zur Rückkehr gewählter Zivilregierungen führt. Umschlagpunkt zwischen zwei revolutionären Wellen in Zentralamerika und Wegescheide zwischen Süd- und Zentralamerika im antidiktatorischen Kampf – dies markiert den historischen Ort des Jahres 1968 aus der revolutionären Perspektive Kubas und Nikaraguas.
Ein Schaltjahr des Reformismus
Aus der Perspektive des lateinamerikanischen Reformismus stellt 1968 ebenfalls eine Zäsur dar. Es ist das Geburtsjahr des Militärreformismus und zugleich jenes Jahr, in dem sich die katholische Kirche auf der 2. Lateinamerikanischen Bischofskonferenz in Medellin (26.8.-6.9.) nachdrücklich für einen Reformkurs entscheidet, für den die Christdemokraten in Chile das Modell liefern sollen. Es ist aber auch jenes Jahr, in dem eine schockierte Weltöffentlichkeit erleben muß, wie sich die „institutionalisierte Revolution“ Mexikos als eine zivile Diktatur entpuppt, die ohne Skrupel die protestierenden Studenten am Vorabend der Olympischen Spiele in Mexiko-Stadt auf dem „Platz der drei Kulturen“ blutig niederschießen läßt. Es ist mehr als nur symbolträchtig, wenn sich einerseits die beiden traditionellen Institutionen reaktionärer Politik – Armee und Kirche – bereit zeigen, im Sinne der reformerischen Überwindung der bisherigen Ordnung aktiv zu werden, während sich andererseits ausgerechnet Mexiko – das vor Kuba 1959 den radikalsten Bruch mit den traditionellen Mächten Lateinamerikas für sich reklamieren konnte – in der Konfrontation mit seiner rebellierenden Jugend als reformunfähig und repressiv erweist.
Die Ursachen für die reformistische Wende, die sich nicht auf Armee und Kirche beschränkte, sind mannigfaltig. Seitdem Kennedy 1961 die Allianz für den Fortschritt verkündet hatte, sahen sich lateinamerikanische Reformer erstmals nachdrücklich durch die Hegemonialmacht im Norden legitimiert und bestärkt. Entscheidend aber war, daß sich im Gefolge der kubanischen Revolution eine Radikalisierung der politischen Auseinandersetzungen abzuzeichnen begann, die auch und gerade von den traditionellen Machtsäulen nicht ignoriert werden konnte. Seit Mitte der 60er Jahre hatte sich im Schöße der Kirche eine „Theologie der Befreiung“ herauszubilden begonnen, die vorbehaltlos für die Armen Partei ergriff und die – ausgehend von der Dependencia-Theorie und dem Marxismus – in der sozialwissenschaftlichen Analyse einen konstitutiven Bestandteil der Theologie sah.
Der Machtantritt einer Militärregierung am 3. 10.1968 in Peru, die mit dem Plan „Inka“ ein sorgfältig ausgearbeitetes Programm von Strukturreformen in die Tat umzusetzen gedachte, markiert einen tiefen Einschnitt in der politischen Ausrichtung der Institution Armee von kontinentaler Bedeutung. Die direkte Konfrontation mit nordamerikanischen Multis (Besetzung der Raffinerie der in den USA beheimateten International Petroleum Company am 9. 10.1968) bis hin zur Nationalisierung sowie die nach Mexiko und Kuba radikalste Agrarreform (Gesetz vom 24.6.1969) auf dem Subkontinent waren die Markenzeichen des peruanischen Militärreformismus. Neben Velasco Alvarado (1968-1975) in Peru repräsentierten Lopez Arellano (1972-1975) in Honduras, Torrijos (1968-1978) in Panama, Rodriguez Lara (1972-1975) in Ekuador und Torres (1970/71) in Bolivien den lateinamerikanischen Militärreformismus, der mit ähnlichen Entwicklungen (seit den 50er Jahren) im afro-asiatischen Raum korrespondierte. In Honduras (Agrarreform 1975) und Panama (neuer Kanalvertrag mit den USA 1977) blieben die antioligarchischen Reformen und antiimperialistischen Nationalisierungen in der Summe jedoch deutlich hinter dem peruanischen Schrittmaß, das selbst die kühnsten Erwartungen der zeitgenössischen Linken übertroffen hatte, zurück. In Bolivien stürzten faschistoide Militärs unter General Banzer die Reformmilitärs schon nach kurzer Zeit.
Gilt Peru als Paradefall für Aufstieg und Ende des Militärrefomismus in Lateinamerika, so kann Chile Gleiches in Sachen des „zivilen“ Reformismus für sich in Anspruch nehmen. Nach der Abwahl der sozialdemokratischen Acción Democratica (AD) in Venezuela war 1968 „Chile das einzige Land Lateinamerikas geblieben, in dem sich eine ausgewiesene reformistische Partei noch an der Macht befindet“ (Kubier 1969: 321). 1964 hatten die Christdemokraten unter der Losung „Revolution in Freiheit“ unter Präsident Frei die Regierung übernommen und mit Reformen im Agrarsektor, Erziehungswesen und Wohnungsbau begonnen. Gerechtere Einkommens- und Besitzverteilung blieben jedoch Schall und Rauch, die Bevölkerung litt unter der Inflation und die Agrarreform war steckengeblieben. Spaltungstendenzen und Flügelkämpfe in der Democracia Cristiana waren die Folge. Das Scheitern der „Revolution in Freiheit“ mündete schließlich 1970 in den Sieg der Unidad Populär bei den Parlamentswahlen. Mit Salvador Allende hatte das Linksbündnis die Regierung übernommen. In Chile wurde 1970-1973 das welthistorisch einmalige Experiment unternommen, Sozialismus und Demokratie miteinander zu verbinden. Seine blutige Niederschlagung durch den Putschisten Pinochet ließ das Pendel der Auseinandersetzungen um den Weg zum Sozialismus nach 1973 wieder zugunsten des bewaffneten Kampfes ausschlagen. Nikaragua 1979 schien all jenen Recht zu geben, die daran gezweifelt hatten, daß ein demokratischer Sozialismus auf friedlichem Weg zu erreichen sei. Nach dem Scheitern sowohl des Militärreformismus (Peru 1975) als auch radikaler Strukturreformen unter einer demokratisch gewählten Linksregierung (Chile 1973) schloß sich mit dem schmachvollen Abgesang des kurzzeitig an die Macht zurückgekehrten Peronismus (Argentinien 1976) jener Abschnitt lateinamerikanischer Geschichte, in dem Reformen bei vielen Lateinamerikanern die Hoffnung geweckt hatten, jenseits von bewaffneter Revolution und Militärdiktatur einen Weg aus der Unterentwicklung zu finden. Weit über die zweite Hälfte der 70er Jahre hinaus befand sich Lateinamerika -von wenigen Ausnahmen abgesehen – unter der Fuchtel rechter bis faschistoider Militärdiktaturen. Erst im Wendejahr 1989/90 fielen in Chile und Paraguay die letzten Militärdiktaturen Lateinamerikas unter dem Druck der Demokratiebewegungen dieser Länder.
Dreißig Jahre später
1998 hat sich das Panorama von 1968 grundsätzlich gewandelt. Nachdem nicht nur der Reformismus der 60er und 70er Jahre, sondern auch die Revolution im Zentralamerika der 80er Jahre nach einer Periode des Aufschwungs und der Hoffnung seines ursprünglichen Impetus verlustig gegangen war, präsentieren sich die 90er Jahre vor den Augen des politischen Beobachters als ein Mix von fragiler Demokratisierung, dominantem Neoliberalismus, marginalisierter Bevölkerungsmehrheit, abwartenden Militärs und aufkeimender Hoffnung in die „utopia desarmada“ (dt.: unbewaffnete Utopie; nach J. Castafleda) einer sich erneuernden Linken. Kuba wird zwar nicht mehr als Epizentrum einer kontinentalen Revolution wahrgenommen, zeigt sich aber Überlebensund anpassungsfähig. Der „reale Sozialismus“ ist trotz der in China, Kuba, Korea und Vietnam regierenden Kommunisten weder als Referenzmodell noch als Gegenmacht zu den USA existent. Die verstreute und dezimierte Linke sammelt sich auf der Grundlage des kleinsten gemeinsamen Nenners – der Kritik am Neoliberalismus – im „Foro de São Paulo“. Der Widerstand gegen Verelendung und Ausplünderung bleibt aber – gemessen an der beschleunigten Polarisierung zwischen Arm und Reich – erstaunlich schwach. Ein deutliches „Ya basta!“ – zu deutsch: „Es reicht!“ – war bisher nur aus dem indianisch besiedelten Chiapas im Süden Mexikos zu hören, wo das Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) zu Neujahr 1994 einen bewaffneten Aufstand gegen die Zentralregierung entfacht hatte. Angesichts dieser vielschichtigen, schwer durchschaubaren Situation, die in ihrer Mischung aus Unsicherheit über gerade erst erlebte, aber noch nicht verarbeitete Veränderungen, und Vorahnung anstehender Umbrüche an 1968 erinnert, stellen sich dem zeitgenössischen Betrachter drei Fragen, deren Beantwortung – obschon hier nur angedeutet – eine erste Orientierung geben könnte: Was ist von 1968 geblieben? Welche Chance bot sich damals überhaupt für eine Weichenstellung in eine bessere Zukunft? Welche Möglichkeiten eröffnen sich dreißig Jahre später?
Die Frage, was von 1968 geblieben ist, berührt ein grundsätzliches Problem – das der Fortwirkung vergangener Ereignisse in Gegenwart und Zukunft. Besonders schwer ist sie dann zu beantworten, wenn es – wie bei 1968 der Fall -nicht um eindeutige Entscheidungen, sondern mehr um Weichenstellungen und gescheiterte Hoffnungen geht. Eine der wenigen sichtbaren Nachwirkungen zeigt sich in der Renaissance des 68er Idols Che Guevara. Die damit verbundene „Che-mania“ birgt die Gefahr, daß der Mensch Che hinter dem Mythos Che verschwindet. Die wohl wichtigste und am schwersten zu beantwortende Frage ist die nach den Ursachen seines Scheiterns in Bolivien. Glaubt man dem mexikanischen Ché-Biographen und Krimi-Autor Taibo II, dann sollte Bolivien selbst nicht Aktionsfeld der Guerilla, sondern eher Ausgangspunkt für koordinierte Aktionen in den Nachbarländern Peru und Argentinien sein. Diese Interpretation würde auch der guevaristischen Vision einer kontinentalen Revolution entsprechen. Festzuhalten bleibt jedenfalls, daß es ohne das Scheitern der Guerilla in den 60er Jahren keine erfolgreiche Revolution in Zentralamerika gegeben hätte, und ohne deren positive wie negative Erfahrungen hätten wahrscheinlich die Zapatisten nicht jene Auszahlung gehabt, die im neuartigen Brückenschlag zwischen Revolution und Zivilgesellschaft wurzelt, den die zapatistische Strategie seit 1994 versucht. Ziel ist nicht die Machtergreifung, sondern die Stärkung der Zivilgesellschaft, die diese in die Lage versetzen soll, die Demokratisierung bis zum Sturz des PRI-Regimes voranzutreiben. Die Kritik am guevaristischen Experiment in Bolivien hat schon in den 60er Jahren begonnen und zur Überwindung des Foquismo der 60er Jahre geführt. Dessen ungeachtet sollte in Sonderheit linke Kritik berücksichtigen, daß Revolutionen das letzte Mittel der Subalternen sind, um auf katastrophale Verschlechterungen ihrer Situation aufmerksam zu machen und ihr Schicksal nach enttäuschten Erwartungen selbst in die Hände zu nehmen. Revolutionen sind zumeist eine Antwort auf das Scheitern oder Zuspätkommen von Reformen.
Eine der durch 1968 aufgeworfenen, aber bis heute nicht beantworteten Fragen ist die, ob damals eine Verbindung von Reform und Revolution im kontinentalen wie nationalen Rahmen möglich gewesen wäre. Der „bewaffnete Reformismus“ der Zapatisten ist der lebendige Beweis, daß revolutionäre Guerilla und Reform sich nicht ausschließen müssen. Andererseits zeigt die guatemaltekische Agrarreform von 1952 bis 1954, daß selbst kapitalistisch konzipierte Reformen im lateinamerikanischen Kontext revolutionäre und revolutionierende Wirkungen haben können.
Auch der im Dezember 1996 zwischen URNG und Regierung geschlossene Friedensvertrag birgt Bestimmungen, die – sollten sie ernsthaft in Angriff genommen werden – durchaus die guatemaltekische Gesellschaft revolutionieren könnten. Dies gilt besonders hinsichtlich der durch das Indigena-Abkommen aufgeworfenen Frage nach der ethnischen und staatlichen Neuordnung Guatemalas.
In diesem Sinne bleibt 1968 eine dreifache Mahnung für 1998: Druck von unten ist bei Reformstau die entscheidende Bedingung für die Einleitung eines Reformprozesses. Erst Revolution(Lateinamerika) und Rebellion (Westeuropa) haben in den 60er Jahren den Herrschenden vor Augen geführt, daß Veränderungen unumgänglich geworden waren. Kräfteverhältnisse, nicht Apelle an Vernunft und Moral entscheiden darüber, auf welchem Weg und in wessen Interesse die gesellschaftlichen Konflikte ausgetragen werden. Die Schubkraft der Reformbewegung wird jedoch nicht allein durch den Druck von unten bestimmt, sondern hängt maßgeblich davon ab, ob und wie reformerische und revolutionäre Kräfte zu gemeinsamer Aktion zusammenfinden. Die lateinamerikanischen Militärdiktaturen der 70er und 80er Jahre hätten so wohl am ehesten verhindert werden können. Inzwischen sind Demokratie und Gesellschaftsreform mit ihrem Freiheits- und Gerechtigkeitsanspruch von der bewaffneten Linken Lateinamerikas als der Weg anerkannt worden, der die Perspektive für eine bessere Gesellschaft offenhält. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß jene beiden Versuche, in denen Demokratie und Sozialismus sich am nächsten kamen, von der jeweiligen Hegemonialmacht blutig niedergeschlagen wurden: Prag 1968 im Osten durch die Sowjetarmee und Chile 1970-73 in der westlichen Hemisphäre durch die konzertierte Aktion von putschenden Generälen und USA. Ernstgemeinte Reform ruft also mindestens genauso viele Gegner auf den Plan wie Revolution, braucht einen langen Atem und ihr Schrittmaß fällt eher bescheiden aus. Sollen aber die eigenen Ideale nicht (wieder) elitären oder totalitären Machtgelüsten zum Opfer fallen, dann bietet das pluralistische Zusammenwirken aller demokratischen und reformwilligen Kräfte noch am ehesten die Chance, dies zu verhindern. Zugleich gemahnt 1968 daran, daß die Chancen für Demokratie und Reform – seien sie auch noch so gering – auch konsequent zu nutzen sind. Ansonsten droht ein Umkippen in polarisierte, chaotische und diktatorische Verhältnisse. Dann wird zwar der Ruf nach Revolution als Notbremse gegen die Fahrt nach rechts wieder aktuell und legitim. Ob er in einer solchen Situation aber noch erhört wird oder damit das Steuer herumzureißen ist, wird man erst im Nachhinein wissen.
—————————————————–
Literatur:
Cardona Fratti, A.: Guatemala, Dogma and Revolution, in: tricontinental, Havana No. 8/ 1968, S. 36-58.
Castañeda, J.: La utopia desarmada. Mexico D.F. 1993.
Castañeda, J.: La vida en rojo. Una biografla del Che Guevara. Mexico D.F. 1997.
Che Guevara, E.: Escritos y discursos. Bd. 9. La Habana 1985.
Fanon, F.: Die Verdammten dieser Erde, in: ders., Das kolonisierte Ding wird Mensch, Leipzig 1986.
Gärtner, P.: Linke Politik in Uniform? Überlegungen zum Phänomen „linke Militärs“ in der neueren Geschichte Lateinamerikas, in: Quetzal – Magazin für Politik und Kultur in Lateinamerika, Leipzig, 15-16/ 1996, S.23-26.
Kubier, J.: Diktaturen, Reformen, Revolution – Lateinamerika im Rückblick 1968, in: Asien – Afrika – Lateinamerika 1969. Bilanz – Berichte – Chronik. Zeitraum 1968. Berlin 1969, S.297-325.
Lulei, W.: Vietnam 1968 – Dem Frieden ein Schritt näher, in: Asien – Afrika – Lateinamerika 1969, a.a.O., S. 61-84.
Ortega, H.; 50 años de lucha sandinista. Mexico D.F. 1979.
Taibo II, P.I.: Che. Die Biographie des Ernesto Guevara. Hamburg 1997.
Zinecker, H.: Ist die Granma nach Mexiko zurückgekehrt? Lateinamerikanische Guerilla zwischen Revolution und Demokratisierung, in: Quetzal, a.a.O., S. 8-11.