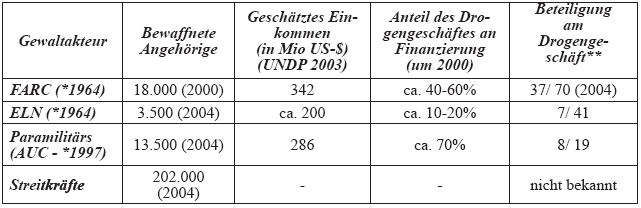Die Opfer, die ihr Land zurückfordern, werden getötet, gefoltert und bedroht. Das Entschädigungskonzept scheitert und führt zu einer blutigen Gegenreform.
Die Opfer, die ihr Land zurückfordern, werden getötet, gefoltert und bedroht. Das Entschädigungskonzept scheitert und führt zu einer blutigen Gegenreform.
Die Paramilitärs hatten langfristige Pläne mit dem Land. Mit vorgehaltener Waffe vertrieben sie fast zwanzig Jahre lang Bauern von ihren Fincas, besetzten Grundstücke und übten Druck aus, um niedrige Kaufpreise zu erzielen. Sie machten sich die Institutionen der Regierung und juristische Manöver zu Nutze, um den Schein der Legalität zu wahren. Sie wollten mit Blut und Feuer eine Gegenreform zur Agrarreform einleiten. Dadurch sollte das Land rechtmäßig in ihren Besitz übergehen, die Regionen politisch kontrolliert und die Paramilitärs die künftige wirtschaftliche Elite werden. Noch immer kämpfen sie um jeden Preis für ihr Ziel, und wenn nicht bald etwas geschieht, werden sie ihren Teil davontragen.
5,5 Millionen Hektar Land wurden verlassen, okkupiert oder in fragwürdigen Geschäften erkauft und 385.000 Familien vertrieben, die heute darum kämpfen, ihr Eigentum zurückzuerlangen. Doch anstatt ihren Grundbesitz zurückzubekommen, erwartete viele nur der Tod. Zehn Morde, 563 Fälle von Bedrohung, der Missbrauch von Frauen und Kindern, Fälle von Körperverletzung, Flugblätter der Águilas Negras (Schwarze Adler), in denen neue Massaker angekündigt werden, die Zerstörung und Plünderung der Büros der Opferorganisationen und permanente Belästigung derjenigen, die ihre Fincas zurückbekommen haben, sind nur Beispiele dafür, was sich im ganzen Land abspielt.
Allein in Urabá starben bereits vier Menschen, die versucht hatten, ihr Eigentum, das sich nun in den Händen von Strohmännern befindet, von den Kommandanten der Paramilitärs zurückzufordern. In Córdoba sehen viele davon ab, ihre Grundstücke zurückzuverlangen, auf denen kriminelle Banden illegale Pflanzungen betreiben, und in El Valle vertreiben Drogenhändler mit Waffengewalt Bauern, die von der Regierung beschlagnahmte Fincas erhalten hatten.
Ein Bild, in dem die Habgier und Gewalt der Mafia einen krassen Gegensatz zur fast nicht existenten Reaktion der Regierung bildet. Die neuen Konflikte um Grund und Boden gefährden den mit Mühe hergestellten Frieden in den betroffenen Regionen. Doch noch schwerwiegender sind die Auswirkungen dieser Gegenreform auf die Demokratie. „Wenn wir das Problem nicht lösen können, wird dies das Ende des Rechtsstaats bedeuten“, sagt Eugenia Méndez, Beraterin für Entschädigungsfragen beim Landwirtschaftsministerium. „Wir müssen das wieder gut machen, was mit Gewalt durchgesetzt wurde, und dafür bleibt uns nur das Gesetz.“
Méndez bereiste Teile des Landes auf abgelegenen Wegen, um zu verstehen, was in den zwanzig Jahren geschah, seit das Land brutal die Besitzer wechselte. Sie fand heraus, dass „diejenigen, die nicht für das Land gezahlt haben, Anwälte bezahlten“, und dass die Paramilitärs ausgefeilte Manöver durchführten, um eine faktische Enteignung legal aussehen zu lassen.
Wie konnte das geschehen?
Es wurden fünf verschiedene Vorgehensweisen festgestellt, mit denen Drogenbosse, Paramilitärs und Grundbesitzer die Betroffenen von ihrem Land vertrieben.
In den schlimmsten Fällen wurden die Menschen mit der Pistole an der Schläfe gezwungen, ihr Land zu einem niedrigen Preis zu verkaufen, so geschehen in Urabá und in den Gegenden, in denen ‚Jorge 40‘ sein Imperium unterhielt. Vor einigen Tagen veröffentlichte das Onlinemagazin Verdad Abierta Briefe von Bauern an ‚Jorge 40’, in denen sie um die Rückgabe ihres Landes ersuchen.
Ein Bauer, der 1999 von INCORA, der kolumbianischen Behörde für die Agrarreform, 40 Hektar Land in San Ángel, Magdalena, erhalten hatte, schreibt dem Chef der Paramilitärs: „Ein Herr namens ‚Tuto Castro‘ kam zu mir nach Hause und sprach mit meiner Frau. Da ich nicht da war, ließ er mir ausrichten, er müsse meine Finca kaufen… Später schickte er noch mehr Männer und ich sollte ihm mein Land durch einen Herrn mit Nachnamen Nieto verkaufen…“. In dieser Region wurden immer wieder ungerechte Verträge beglaubigt, die eine Partei völlig übervorteilten, es gab Unterschriftenfälschungen und andere Formen von Betrug.
Auch in Urabá geschah Ähnliches. Vicente Castaño, Raúl Hasbún und andere Kommandanten der Paramilitärs bedienten sich eines umfangreichen Netzwerks von Strohmännern, um die Überschreibung von Grundbesitz zu erzwingen. Dort fordern die Opfer 30.000 Hektar Land zurück. Dies stellt ein größeres Problem dar, da immer mehrere Besitzer eingetragen sind. Der Streit um diese Ländereien hat bereits vier Menschen das Leben gekostet: Juan Jiménez Vertel, der vermutlich von Strohmännern Vicente Castaños ermordet wurde, die in Chigorodó auch als Águilas Negras bekannt sind; Benigno Gil, der die Geduld verloren hatte und gemeinsam mit anderen Bauern auf die Fincas zurückkehrte, die ihnen die Paramilitärs in Mutatá genommen hatten. Jaime Antonio García wurde im Dezember des vergangenen Jahres ermordet, im Februar starb Alejandro Pino Medrano, als er versuchte, auf seine Finca in Riosucio, Chocó, zurückzukehren, von der er von der AUC vertrieben worden war. Auch jetzt bewegen sich die Anführer der Bauern nur mit Polizeischutz.
Ein weiteres ungelöstes Problem ist die Übernahme von kollektiven Titeln, die afrokolumbianischen Gemeinden ausgestellt worden waren, die einen langen Leidensweg zwischen Unternehmern, Strohmännern und neuen Paramilitärs hinter sich haben.
Eduardo Pizarro, dem Präsidenten der Nationalen Kommission für Entschädigungen (Comisión Nacional de Reparación), zufolge haben sich in vielen Regionen aus den Gewinnern der gewaltsamen Enteignungen neue Agrareliten herausgebildet. „Was die Paramilitärs getan haben, war illegal. Das Verhalten dieser Eliten war es nicht“, sagt Pizarro. Aus kapitalistischer Sicht haben diese Unternehmer und Neureichen nur die Chance der billigen Kaufpreise genutzt. Aber vom rechtlichen Standpunkt her, welcher bei der Entschädigung der Opfer der maßgebende sein sollte, kann die Regierung nicht darüber hinwegsehen, dass tausende Transaktionen mit Grund und Boden noch unter Einfluss des Krieges stattgefunden haben.
Eine weitere Vorgehensweise bei der Enteignung war die Besetzung der betroffenen Ländereien durch bewaffnete Gruppen, Strohmänner oder Invasoren, so dass die Menschen, die eigentlich einen rechtmäßigen Titel auf das Land hatten, nicht zurückkehren konnten. Ein typisches Beispiel dafür war Salvatore Mancuso in Córdoba. In Costa de Oro wurde Anfang der neunziger Jahre eine Finca mit 885 Hektar Land von der Regierung auf 59 Teilpächter aufgeteilt. Diese konnten das Land jedoch nie nutzen, weil es von Fidel Castaño und seinen Männern besetzt war, die immerhin einigen erlaubten, als Hilfsarbeiter oder Pächter dort zu bleiben. Anschließend „verkaufte“ Carlos Castaño die Finca an Mancuso, der den Bauern, die Titel besaßen, den Kampf ansagte, wenn sie nicht zum Verkauf bereit wären. Einige verkauften. Doch jene, die nicht dazu bereit waren, konnten nie auf ihr Land zurückkehren. Erst jetzt, nachdem Mancuso sein Verbrechen gestanden hat, erhalten sie ihr Land zurück. Im ganzen Land gibt es Fälle wie diesen, die durch das Gesetz Gerechtigkeit und Frieden (Justicia y Paz) geklärt wurden; insgesamt geht es dabei um Ländereien mit einer Fläche von weniger als 2.000 Hektar.
Ein weiterer Konflikt spielt sich zwischen den armen Bauern und den Vertriebenen ab. Viele der Vertriebenen waren Besitzer von Grundstücken, die sie von der Regierung erhalten hatten. Nach der Rechtslage vor 2007 konnten diese Grundstücke neu vergeben werden, wenn die Besitzer sich länger als fünf Jahre nicht dort aufgehalten hatten. Das geschah beispielsweise in vielen Orten in Antioquia und Sucre. Heute kehren die Vertriebenen auf ihre Ländereien mit Titeln zurück, die vor über zehn Jahren von INCORA ausgestellt wurden, nur um dort bereits eine andere Familie vorzufinden, die ebenfalls arm ist oder vertrieben wurde, aber auch einen Titel hat. Da der Staat heute nicht mehr die rechtlichen Mittel zur eindeutigen Klärung der Verhältnisse hat, beginnt ein Konflikt zwischen den beiden berechtigten Parteien.
 Darüber hinaus gibt es heute viele Ländereien der Vertriebenen, die verlassen wurden und brach liegen. Dabei handelt es sich um Flächen von über einer Million Hektar in abgelegenen Gebieten, wo aufgrund von illegalen Pflanzungen, Guerillas oder neuen Banden die Sicherheit und Entwicklung für ein würdiges Leben der Zurückkehrenden nicht gewährleistet sind. Das Gebirge Montes de María ist eins der betroffenen Gebiete. Dort kaufen traditionelle Unternehmer, vor allem aus Antioquia, massiv Ländereien zu niedrigen Preisen auf und nutzen damit die Hoffnungslosigkeit der Vertriebenen aus, die keine Lösung mehr erwarten.
Darüber hinaus gibt es heute viele Ländereien der Vertriebenen, die verlassen wurden und brach liegen. Dabei handelt es sich um Flächen von über einer Million Hektar in abgelegenen Gebieten, wo aufgrund von illegalen Pflanzungen, Guerillas oder neuen Banden die Sicherheit und Entwicklung für ein würdiges Leben der Zurückkehrenden nicht gewährleistet sind. Das Gebirge Montes de María ist eins der betroffenen Gebiete. Dort kaufen traditionelle Unternehmer, vor allem aus Antioquia, massiv Ländereien zu niedrigen Preisen auf und nutzen damit die Hoffnungslosigkeit der Vertriebenen aus, die keine Lösung mehr erwarten.
Dies wird noch durch historische Hintergründe in der Region erleichtert. Auf dem Lande gab es nie viele Formalitäten. Die Menschen trafen mündliche Absprachen oder setzten Verträge auf Servietten auf. Dieses Vertrauen geht auf eine Eigenart der Bauern zurück, bei denen das Ehrenwort noch Gewicht hatte und ein Teil der Normen war, doch auch auf die Schwäche des Staates auf lokaler Ebene, wo Transaktionen nach dem Gutdünken der Großgrundbesitzer und Mafiabosse durchgeführt werden.
Das Scheitern der Rückgabe und Entschädigung für Grundbesitz schlägt sich direkt in Zahlen nieder. Die Paramilitärs haben kaum 6.600 Hektar für die Entschädigung der Opfer zurückgegeben. Selbst wenn sie mehr zurückgeben wollen, können sie nicht, weil Acción Social nur lastenfreie Grundstücke mit gültigen Titeln annimmt. Deshalb verbleiben viele der betroffenen Flächen ohne Eigentümer. Gleichzeitig erhielten die Vertriebenen insgesamt nur etwa 60.000 Hektar, die sie zum großen Teil aufgrund neuer Drohungen und Ansprüche der Mafia wieder verlassen mussten.
Doch die Gegenreform schlägt sich nicht nur im Streit um die betroffenen Flächen nieder. Die Drogenkartelle kontrollieren immer noch einen großen Teil der besten Böden des Landes. Daraus beziehen sie ihr Einkommen, während sie der Produktivität des Landes schaden. Sie treiben den Bodenpreis in die Höhe. Alejandro Reyes, Berater des Programms Midas der US-Botschaft, sagt, dass die produktiven Gebiete seit zwanzig Jahren wegen Erpressung und Restriktionen der Guerilla immer weiter verfallen. Die Drogenkartelle kaufen das Land mit der Unterstützung ihrer Privatarmeen billig auf und heben dann den Preis an. „Heute gehört das Land zum großen Teil nicht mehr der Mafia, sondern Unternehmern.“ In Codazzi, Cesar, war beispielsweise früher ein Hektar Land zwei Millionen Pesos wert. Heute liegt der Kaufpreis bei 60 Millionen.
Es steht nicht genau fest, wie viel Grund und Boden heute noch den Drogenbossen gehört, doch innerhalb eines Jahrzehnts konnten nur 457.000 Hektar beschlagnahmt werden, von denen 40.000 Hektar ohne Besitzer sind und nur 3.480 Hektar für die Entschädigung der Opfer zur Verfügung stehen.
Bisher konnte nicht einmal ein Prozent der besetzten Ländereien zurückgegeben werden – eine beschämende Zahl.
Kafka auf dem Lande
In jedem anderen Land der Welt wäre ein Problem, das solche tief greifenden Auswirkungen auf das politische und wirtschaftliche Leben hat, das so viele Menschen betrifft und das den Zustand der Demokratie im Land so deutlich macht, ein zentrales Thema der Debatte. In Kolumbien nicht.
Die Mitglieder der Nationalen Kommission für Entschädigung (Comisión Nacional de Reparación) sind lauter Don Quijotes im Kampf gegen Windmühlen, damit hier und da im Gesetz ein Paragraf auftaucht, der die unmittelbar bevorstehende Legalisierung dieser Gegenreform noch abwendet. In einem Land, das einen Kongress und eine Regierung mit starkem Einfluss auf die Kommunen hat, ist das mehr als eine große Leistung. Nach Jahren der Unterdrückung durch die Gewalt der Paramilitärs, der Manipulation durch die Guerillas und der Zerstörung des sozialen Netzes durch die massive Vertreibung wehren sich die Bauern kaum noch.
 Die Regierung hat lange gebraucht, um zu verstehen, dass, wenn es auf dem Land Krieg gibt, nicht dieselben Landgesetze durchgesetzt werden können wie im Frieden. Das Urteil des Verfassungsgerichts, das den Forderungen der Vertriebenen stattgibt, brachte die Ineffizienz von Behörden wie INCODER ans Licht, die den Vertriebenen innerhalb von zehn Jahren nur 20.000 Hektar zurückgegeben haben. Dank dieses Urteils stiegen im letzten Jahr die Landvergaben.
Die Regierung hat lange gebraucht, um zu verstehen, dass, wenn es auf dem Land Krieg gibt, nicht dieselben Landgesetze durchgesetzt werden können wie im Frieden. Das Urteil des Verfassungsgerichts, das den Forderungen der Vertriebenen stattgibt, brachte die Ineffizienz von Behörden wie INCODER ans Licht, die den Vertriebenen innerhalb von zehn Jahren nur 20.000 Hektar zurückgegeben haben. Dank dieses Urteils stiegen im letzten Jahr die Landvergaben.
Es wurden, wenn auch verspätet, effiziente Maßnahmen eingeleitet, wie etwa der vorübergehende Schutz von drei Millionen Hektar, die weder verkauft noch erworben werden dürfen, bis die Besitzverhältnisse endgültig geklärt sind. Die Regierung ist der Auffassung, dass anstelle großer politischer Maßnahmen die Fälle einzeln und in Übereinstimmung mit den Forderungen der Vertriebenen aufgeklärt werden müssen. Ein langer Weg für die Opfer, denn die Verfahren bis zur gerichtlichen Anerkennung der Landtitel dauern bis zu sieben Jahre.
Deshalb gelten drei Aspekte des Opfergesetzes, das im Kongress diskutiert wird, von vielen als positiv. Erstens wird die Beweislast von den Schultern der Opfer genommen. Zweitens soll eine Wahrheitskommission geschaffen werden, die feststellt, was mit dem Land im Laufe des halben Jahrhunderts der Gewalt geschehen ist. Drittens sieht das Gesetz außergewöhnliche juristische Übergangsregelungen vor, die sich nach den Vorgaben von Justicia y Paz richten sollen.
Dies wäre ein großer Schritt, doch noch lange nicht genug. Obwohl neue juristische Instrumente allgemein für ausreichend gehalten werden, ist bei der Landfrage, die historisch mit der Gewalt und dem Krieg verbunden ist, ein deutlicherer politischer Wille notwendig, vor allem, weil von der Stabilisierung der demokratischen Sicherheit und des Friedens gesprochen wird. In Guatemala, im Sudan oder in Ruanda verlief die Rückkehr der Vertriebenen, die unter ähnlichen Vorzeichen wie in Kolumbien stattfand, blutig.
Patricia Buriticá, Mitglied der Comisión de Reparación, fordert, dass auch über das Erlöschen der Besitzansprüche diskutiert werden muss. „Wenn die Ländereien konfisziert wurden, werden sie den Opfern überschrieben. Dabei handelt es sich um eine halbe Million Hektar.“ In Fällen, in denen die Regierung sich doch gezwungen sieht, das Land mutmaßlichen Drogenbossen zurückzugeben, von denen es ursprünglich konfisziert wurde, sollte sie es erstatten können. Bei einer gut funktionierenden Justiz wären das aber nur Ausnahmen und nicht wie bisher die Regel.
Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Einrichtung von lokalen Kommissionen zur Rückgabe von Eigentum. Da es sich um tausende Streitfälle handelt, gibt es Probleme mit Gewalt und mit der Schwäche lokaler Institutionen. Buriticá befürwortet kommunale Vereinbarungen. „Die Rückgabe muss als ein Prozess der Wiederherstellung des sozialen und politischen Netzes begriffen werden“, was bedeuten würde, lokale Behörden, Großgrundbesitzer und Vertriebene an einen Tisch zu bringen und gemeinsam über die Zukunft der Regionen im Rahmen von Projekten, die Aufschwung und Versöhnung herbeiführen, nachzudenken. In letzter Konsequenz bedeutet es auch ein politisches Problem, nämlich den Staat in die ländlichen Gebiete zu bringen, wo oft die Mafia immer noch mächtiger ist als die Behörden.
Vielleicht ist das viel verlangt, doch es scheint nicht unmöglich. Sicher ist, dass die Vergabe von Landtiteln allein nicht mehr ausreicht. Während neue bewaffnete Gruppen immer mehr Boden gewinnen, die neuen Grundbesitzer sich an den Vertriebenen bereichern und der Staat das Problem kaum beachtet, wird der erste Stein für einen neuen Krieg angestoßen. Oder, und das wäre noch schlimmer, für die Anerkennung der Gegenreform, die nichts weiter ist als ein ungerechtes System, das auf dem Blut und den Tränen vieler Kolumbianer errichtet wurde.
Original-Beitrag aus La Semana vom 14.03.2009, (Ausgabe 1402). Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift.
Übersetzung aus dem Spanischen: Ariane Stark
Bildquellen: [1], [3], [4] Quetzal-Redaktion, ssc; [2] Quetzal-Redaktion, wd